
Erschienen in Heft 1/2007 Soziale Stadt – Bildung und Integration
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bestand die Leistung des sozialstaatlichen Kompromisses darin, die Integration der Gesellschaft zu erhalten und dazu die Inklusion der Individuen in die Gesellschaft und ihre Funktionssysteme (Politik, Wirtschaft, Recht, etc.) zu erleichtern. Dennoch auftretende Erscheinungen sozialer Desintegration konnten "globalen" (demographischen, ökonomischen und politischen) oder individuellen (sozialisatorischen, sozial-ökologischen) Ursachen zugerechnet werden: Desintegration wird dann als individuelles Risiko, aber auch als soziales Problem des Gemeinwesens erlebt bzw. konzipiert, das u. U. "lokal" wohlfahrtsstaatlich bearbeitet werden muss. Die operative Ebene des Sozialstaates ist im Wesentlichen die Gemeinde (bzw. der Kreis) mit den jeweils zuständigen Ämtern, die um ihrer Funktionsfähigkeit willen an der sozialen Integration der Bevölkerung interessiert sein muss. In diesem Beitrag soll nun die These vertreten und erläutert werden, dass auch das lokale Schulsystem einer Gemeinde oder eines Kreises ursächlich für die Erzeugung sozialer Probleme und deren unerwünschte sozialräumliche Verdichtungen oder zumindest deren Verfestigung sein kann. Vorgeschlagen wird eine eigenständige kommunale Bildungspolitik, die sich thematisch der sozialen Integration widmen und sich in einer problembezogenen Verzahnung von Schulentwicklungs- sowie Kinder- und Jugendhilfeplanung realisieren soll.
Beiträge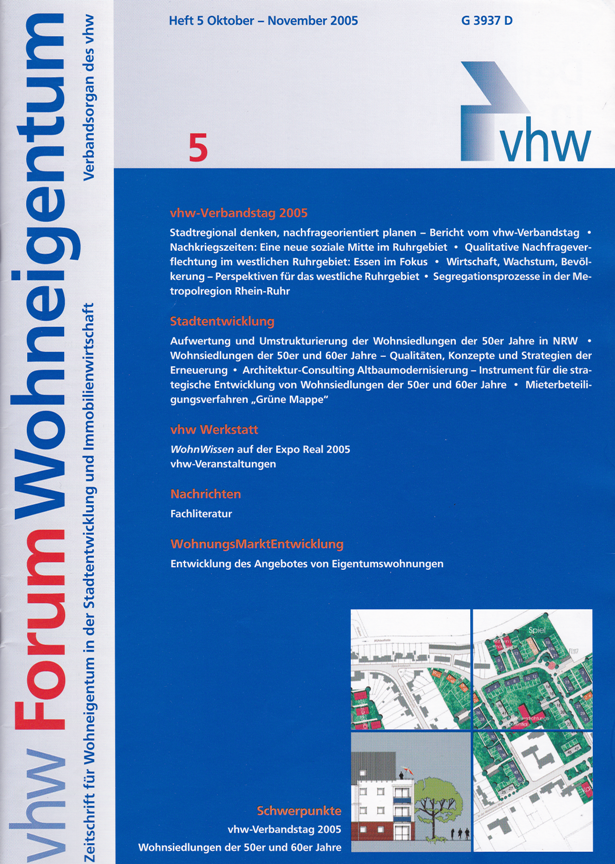
Erschienen in Heft 5/2005 vhw Verbandstag 2005, Siedlungen der 50er und 60er Jahre

Erschienen in Heft 6/2006 Neue Investoren auf dem Wohnungsmarkt – Transformation der Angebotslandschaft
Der Wohnungsmarkt in Deutschland befindet sich in einem grundsätzlichen Umbau. Prägend hierfür ist die immer stärkere Ausdifferenzierung der Wohnungsteilmärkte auf der Angebots- wie auf der Nachfrageseite: – der Subventionsabbau, der sich ausdrückt im Wegfall der Eigenheimzulage und der degressiven Abschreibung im Mietwohnungsbau und in der radikalen Kürzung der öffentlichen Mittel für die soziale Wohnraumförderung, – die deutliche Orientierung auf die Wohnungsbestände und – spiegelbildlich hierzu – der Rückgang des Neubaus, – die Globalisierung in dem Sinne, dass die internationalen Investoren den deutschen Wohnungsmarkt erkannt haben, – die Ökonomisierung der Immobilienlandschaft insgesamt. Aus Immobilienhaltern werden immer mehr Immobilienhändler. In diesem Kontext stellen sich auch die Interessen und Bedarfe der Mieter als Nachfrager anders dar.
Beiträge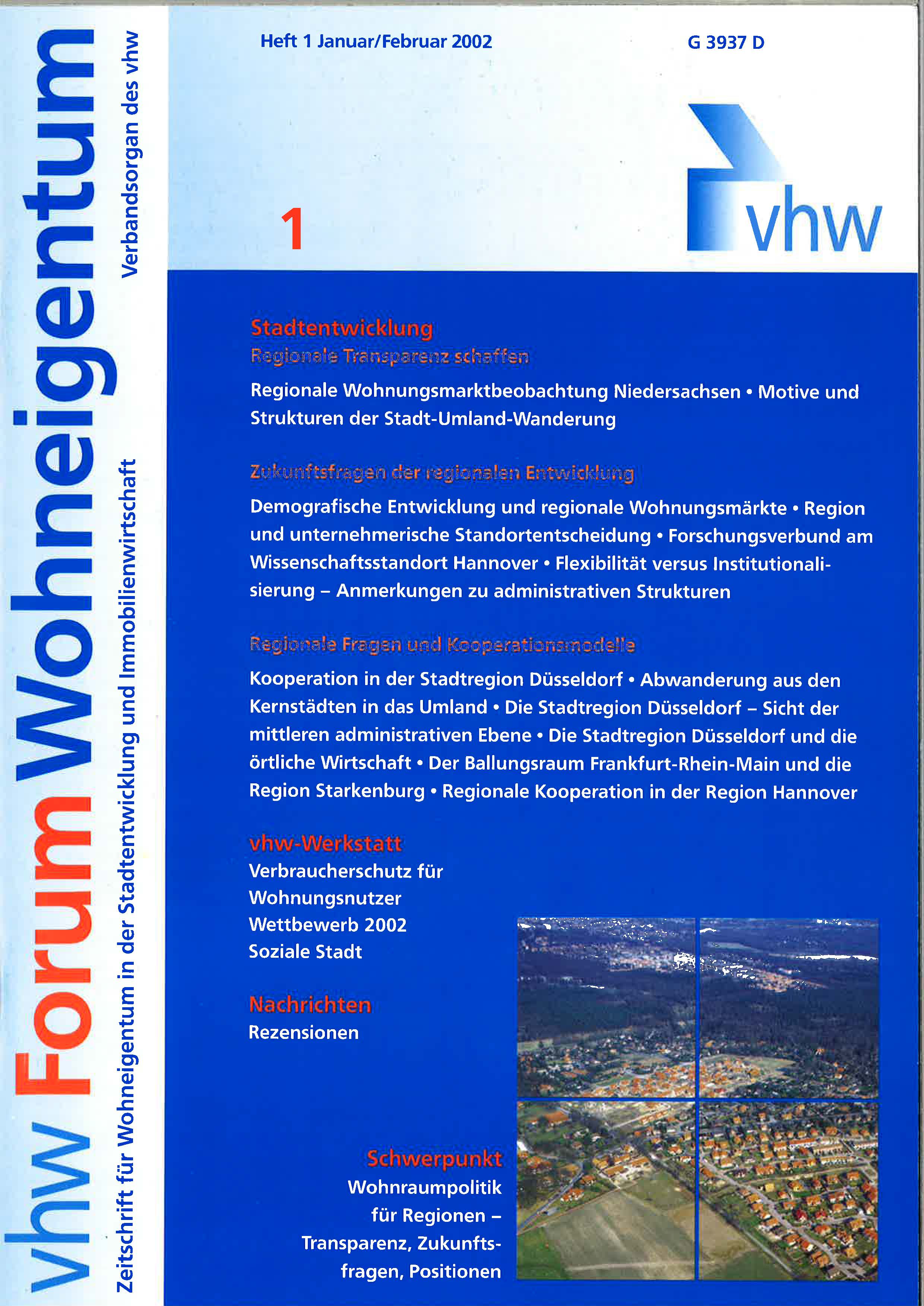
Erschienen in

Erschienen in Heft 1/2014 Ländlicher Raum und demografischer Wandel
Erst allmählich rückt der ländliche Raum in die integrationspolitische Betrachtung. Maßgeblichen Einfluss hatte der Diskurs zum Nationalen Integrationsplan der Bundesregierung, der das Thema auch bei den Kommunen im ländlichen Raum stark befördert hat. Gleichzeitig haben der demografische Wandel und der sich abzeichnende Fachkräftemangel den Blick auf Zuwanderung und Integration in den ländlichen Kommunen gelenkt. Vor diesem Hintergrund hat die Schader-Stiftung zusammen mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dem Deutschen Landkreistag und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund das Projekt "Integrationspotenziale in kleinen Städten und Landkreisen" von 2009 bis 2011 durchgeführt. Mit diesem Projekt wurde erstmalig die Situation von Zuwanderern in Klein- und Mittelstädten des ländlichen Raums bundesweit vergleichend untersucht.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2013 Perspektiven für eine gesellschaftliche Anerkennungskultur
Bürgerschaftliches Engagement entsteht aus den unterschiedlichsten Motiven heraus, die zwischen persönlicher Sinnfindung, dem Wunsch nach Kontakten und Gemeinschaft, der Weitergabe von individuellen Kompetenzen und Gestaltungswille des eigenen Umfeldes liegen können. Die Weiterentwicklung der Zivilgesellschaft und die Gewinnung von Bürgergruppen aus den verschiedenen Milieus und Lebenslagen heraus erfordern nicht nur die Eröffnung neuer Tätigkeitsfelder für ein bürgerschaftliches Engagement, sondern auch verbesserte Vernetzungsstrukturen und die Herausarbeitung differenzierter Rollenanforderungen. Das Miteinander der verschiedenen Akteure vor Ort drückt sich in nicht unerheblichem Maße durch eine gelebte Anerkennungskultur des bürgerschaftlichen Engagements aus.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2020 Kommunales Handeln im europäischen Kontext
Die kommunale Ebene stellt mit ihren über 92.000 Kommunen das Fundament der Europäischen Union (EU) dar. Das Verhältnis der Kommunen zur EU bzw. zur europäischen Integration ist sehr vielschichtig und hat zwei Dimensionen: eine von Emotionen geprägte und zum anderen eine mit rechtlichem und administrativem Charakter. Aus Sicht der Städte und Gemeinden gibt es also ein Europa der Begegnung und Partnerschaften und ein Europa der Richtlinien und Verordnungen. Bei der Vielfalt und Komplexität der Wechselwirkungen zwischen kommunaler und EU-Ebene kann dieser Beitrag nur einen Überblick geben und einige zentrale Aspekte beleuchten.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2020 Perspektiven für Klein- und Mittelstädte
Das Thema ländlicher Raum hat "Hochkonjunktur". Nicht erst seit "Corona" werden, nachdem jahrelang "krankhafte Symptome" diagnostiziert wurden, zunehmend die Potenziale der Dörfer und Kleinstädte gleichberechtigt zu den Herausforderungen wahrgenommen, und das zu Recht, da generelle Aussagen der vielschichtigen Situation dieser Raumkategorie einfach nicht gerecht werden. Vor nicht ganz zehn Jahren berichteten wir in Ausgabe 3/2011 dieser Zeitschrift über Perspektiven von Kleinstädten in Mecklenburg-Vorpommern am Beispiel von Sternberg, Malchow und Gnoien. Was hat sich in dem Zeitraum getan und warum ist der ländliche Raum so sehr ins Zentrum des Interesses geraten?
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2017 Mobilität und Stadtentwicklung
Jede Fahrt hat ihren Ursprung und ihr Ende an einem Standort. Damit eine effiziente und umweltverträgliche Abwicklung des Verkehrsaufkommens garantiert werden kann, braucht es entsprechende Maßnahmen entlang der Wege, aber auch dort, wo der Verkehr entsteht. Das Projekt "MIPA Mobilitätsmanagement in Planungsprozessen von neuen Arealen" hat Letzteres unter die Lupe genommen und entsprechende Hilfsmittel für Behörden und Private geschaffen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2012 Nachhaltigkeit und Wohnen
Während Verbände und Politik noch über die Fortschreibung und Verschärfung der gültigen Energieeinsparverordnung beraten, unterschreiten Architekten wie das Berliner Büro Deimel Oelschläger mit ihren Gebäuden die derzeit für Neubauten geltenden Energiekennwerte um ein Vielfaches. Dabei geht der Trend zu Häusern, die mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen – die sogenannten Plus-Energie-Häuser. Diesen Standard schreibt die EU zwar erst ab 2021 verbindlich vor, jedoch zeigen schon heute Projekte wie die Plus-Energie-Siedlung Newtonprojekt in Berlin-Adlershof, wie die klimaneutrale Siedlung von morgen aussehen könnte.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2014 Zuwanderung aus Südosteuropa – Herausforderung für eine kommunale Vielfaltspolitik
Als lebensweltlich konkreter Ausgangspunkt für meinen historisch angereicherten migrationswissenschaftlichen Blick auf das Thema dienen meine persönlichen Erfahrungen als Duisburger Bürger. Ich beginne mit meinen Beobachtungen und Gesprächen, die ich als Bewohner des Stadtteils Duisburg-Neumühl mit leider erfolgreich von den Medien und der Rechtspopulistischen Partei Pro-NRW "angefixten" Anwohnern geführt habe: Am 9. November 2013, dem Gedenktag zur Reichspogromnacht, brüllten in Duisburg-Neumühl, einer SPD-Hochburg, ca. 30 aus Köln zugereiste deutsche Bürger der zu den nordrhein-westfälischen Kommunalwahlen kandidierenden Pro NRW-Partei zum zweiten Male vor dem leerstehenden Gebäude des ehemaligen St. Barbara-Hospitals "Kein Asyl in Neumühl". Im August war das Gerücht in der Presse verbreitet worden, dort würden 500 Roma untergebracht.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2011 Stadtentwicklung in Klein- und Mittelstädten
Mit gut 50 Jahren zählt der Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" zu den ältesten in Hessen. Heute motiviert er die Bewohner, ein Leitbild und Ziele für die örtliche Entwicklung aufzustellen und Projekte umzusetzen. Da weder externe Planer oder Moderatoren bereitgestellt werden noch Projektmittel fließen, setzt der Wettbewerb bei den Engagementstrukturen an. Er setzt auf die Alltagskompetenz der Bewohner und ihren Gestaltungswillen, spricht aber auch die politisch Verantwortlichen an. Bewertet und gewürdigt wird, wie die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Ausgangssituation aufgreifen und in der Gegenwart die Zukunft gestalten. Dabei gilt der Grundsatz: Jeder Ort ist einmalig! Im Ergebnis stehen sichtbare Veränderungen wie Projekte beispielsweise zur Verbesserung der Infrastruktur oder des Ortsbildes.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2022 Zukunft Landwirtschaft: zwischen konkurrierender Landnutzung und Klimawandel
Die geburtenstarken Jahrgänge scheiden in den nächsten Jahren aus dem Erwerbsleben aus. Bei vielen wird die gesetzliche Rente zur Sicherung des Lebensstandards nicht ausreichen. Ursächlich hierfür sind in hohem Maße hohe Wohnkosten, insbesondere in (Groß-)Städten. Ältere Personen mit kleinen Renten können sich ihre beziehungsweise eine Wohnung in der (Groß-)Stadt nicht mehr leisten. Tatsächlich befinden sie sich nach einem anstrengenden Erwerbsleben mehr oder weniger in einem wirtschaftlichen „Überlebenskampf“. Auf die sozialen Verwerfungen, ausgelöst durch Altersarmut, sei an dieser Stelle hingewiesen.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2022 Zukunft Landwirtschaft: zwischen konkurrierender Landnutzung und Klimawandel
Obwohl sie kontinuierlich auf dem Rückzug ist, ist die Landwirtschaft noch immer der größte Beansprucher von Flächen in Deutschland. Die Raumordnung verfügt über Instrumente, um die Flächenansprüche der Landwirtschaft gegenüber anderen Nutzungsansprüchen auszutarieren. Die einzelnen Bundesländer und Regionen machen von diesen Instrumenten sehr unterschiedlich Gebrauch. Die Regionalplanung hat jedoch kaum Möglichkeiten, auf die Art der Landwirtschaft, etwa im Sinne einer ökologischeren Ausrichtung, Einfluss zu nehmen. Ihre zukünftige Aufgabe ist es, über die reine Verteidigung des Nutzungsanspruches auch räumliche Entwicklungsperspektiven für die Landwirtschaft als Teil der Kulturlandschaft zu entwickeln.
Beiträge

Erschienen in Heft 2/2016 Renaissance der kommunalen Wohnungswirtschaft
Unterbringung von Flüchtlingen, Energiewende, Mangel an altengerechten Wohnungen, Mietpreisbremse, angespannte und entspannte Wohnungsmärkte in wachsenden und schrumpfenden Regionen… Dies sind die Alltagsprobleme in deutschen Wohnungsunternehmen, unabhängig vom Hintergrund der Eigentümerinteressen. Während man bei den Wohnungsbaugenossenschaften den Mitgliedern und bei den Unternehmen der Privatwirtschaft den Anlegern verpflichtet ist, sind die kommunalen Unternehmen im Alltag vielerorts dazu aufgerufen, den Spagat zwischen politischem Willen der Rathäuser und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit zu schaffen und werden gern als Unterstützer von kommunalen Haushalten in Anspruch genommen. Unabhängig von dieser Einschätzung soll der Mieter als Kunde oder Wähler die erste Priorität haben.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2018 Meinungsbildung vor Ort – Chancen für Stadtentwicklung und lokale Demokratie
Bei Bauträgern und Projektentwicklern haben Bürgerbeteiligungsverfahren häufig einen kritischen Ruf: Sie seien teuer, personal- und zeitintensiv. Längst nicht alle erkennen die Vorzüge, nämlich, dass nach Baubeginn mit weniger Gegenwind und Nachbarschaftsklagen zu rechnen ist und das Vorhaben dank einer "Schwarmintelligenz" aus Anliegern, interessierten Bürgern und Planern eine bessere städtebauliche Qualität erhält. Wie gelingen diese Partizipationsmaßnahmen? Welche Fehler sollten vermieden werden?
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2008 Segregation und sozialer Raum
Über Bürgerorientierung, bürgerschaftliche Teilhabe, Partizipation etc. wird zumeist in hoch gestimmtem, positivem Ton gesprochen. Solchen programmatischen Bekundungen steht aber eine Praxis gegenüber, die voller Schwierigkeiten steckt. Wem daran gelegen ist, dass Bürgerorientierung zu einer Grundhaltung wird, die das Handeln von Politik und Verwaltung in den Kommunen prägt (auch als Voraussetzung für ein gedeihliches Zusammenwirken mit dem Engagement der Menschen in der Stadt), der wird sich mit den Problemen und Restriktionen auseinandersetzen müssen die verhindern, dass dieser Zustand bereits erreicht ist. "Wir müssen", so drückte das ein Teilnehmer unserer Tagung in Berlin aus, "statt immer nur Best Practices zu betrachten, auch einmal die ´Best Problems´ zusammenstellen". Erst bei einer offenen Auseinandersetzung mit diesen Schwierigkeiten werden Ursachen erkennbar und damit die Wege frei für eine Suche nach Lösungen. Aus diesen Gründen wurde das Thema "Probleme und Schwierigkeiten" zu einem Schwerpunkt der Arbeit in der ersten Phase des B2-Projekts: Es wurde und wird in den "Ortsterminen" thematisiert, ihm war eine eigene Tagung in Berlin gewidmet und es steht daher auch im Mittelpunkt dieser Zwischenbilanz.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2017 Sozialorientierung in der Wohnungspolitik
Für die wirtschaftlich-soziale Problemkonstellation, mit der sich die deutsche Stadt- und Wohnungspolitik derzeit auseinandersetzen muss, trägt neben der Politik auch der politiknahe wissenschaftliche Diskurs in den letzten drei Jahrzehnten eine Mitverantwortung. Die Wohnungsmarktsituation in deutschen Städten ist ein Ergebnis institutioneller Regeln und Vereinbarungen in Deutschland und auf EU-Ebene. An der Legitimationsbasis dieser Institutionen haben sowohl die deutsche Politik wie die politiknahe Forschung aktiv mitgewirkt. Der Verlust an Vertrauen, den die europäischen Institutionen derzeit erleben, betrifft also auch Forschung und Theorie hierzulande und sollte ein Anlass zur selbstkritischen Rückschau sein.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2014 Ländlicher Raum und demografischer Wandel
Prignitz-Oberhavel – für Menschen außerhalb der Region Berlin und Brandenburg (vielleicht sogar für Menschen außerhalb des nördlichen Bereiches dieser zwei Bundesländer) ist dieses Begriffspaar wahrscheinlich eher eine Unbekannte. Auch Menschen, die zum ersten Mal mit Prignitz-Oberhavel Kontakt aufnehmen möchten, können noch erhebliche Schwierigkeiten haben. Der bisher schönste "Verschreiber" in der Anrede: "Sehr geehrte Damen und Herren in Oberprignitz-Osthavel …". Oberprignitz-Osthavel – das stellt selbst für die Eingeweihten unter uns eine Unbekannte dar!
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2013 Diversität und gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Stadt

Erschienen in Heft 4/2020 Kommunales Handeln im europäischen Kontext
Angesichts spürbarer Auswirkungen des Klimawandels gehen viele Städte bereits ambitioniert voran. Als oft beschworene "Umsetzer" der Energiewende bleibt ihnen häufig auch nichts anderes übrig. Für die erfolgreiche Umsetzung ihrer Klimaziele schauen viele Städte über den eigenen Tellerrand und suchen den Austausch in Netzwerken. Dabei spielt nicht nur Deutschland, sondern zunehmend auch Europa eine Rolle. Der durch den europaweiten Klimaschutzdialog entstehende Mehrwert kann auf lokaler Ebene wichtige Impulse für die Erreichung der Klimaziele geben. Wie das Beispiel BEACON zeigt, können bewährte Herangehensweisen europaweit angewandt werden. Denn beim Klimaschutz kommt es nicht auf die Größe an.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2023 Kommunale Religionspolitik
Dieser Beitrag spiegelt verschiedene Beobachtungen der sehr unterschiedlichen bezirklichen Praxis, auf Berliner Friedhöfen Begräbnismöglichkeiten nach islamischem Ritus einzurichten. Darin zeigt sich das Potenzial, räumlich die Vielfalt von Existenzweisen der Menschen in der Stadt anzuerkennen, zu gestalten und damit zur Transformation der Gesellschaft in ökologischer Verantwortung beizutragen. Die Bedeutung von Friedhöfen als Orten der Verbundenheit zwischen Tod und Leben, Kultur, Natur, Lebenswissen aus den Religionen, wird gerade neu erkennbar. Die Rede von „Integration“ richtet den Blick auf die Leistung der Menschen, die in Migration sind. Sich beheimaten zu können, setzt voraus, dass die Erfahrung des Einräumens von Lebensmöglichkeiten – auch für trauernde – Menschen gemacht werden kann. Exemplarisch scheint mit dem Thema der Friedhöfe die Gegenseitigkeit auf, in der Akteure der gesellschaftlichen und ökologischen Veränderungen zur Gestaltung von Frieden und Gerechtigkeit aufeinander angewiesen sind. Dabei zeigt sich auch eine neue Wahrnehmung des „Religiöse[n] außerhalb der Religion“ (Latour 2014, S. 415), in dem Menschlichkeit im Innehalten regeneriert werden kann.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2020 Kommunales Handeln im europäischen Kontext
Entstanden aus einer losen Interessengemeinschaft von Kaufleuten, beherrschte die Hanse an ihrer Blütezeit vom 13. bis 15. Jahrhundert den Handel in Nord- und Ostsee und entwickelte sich zu einer der einflussreichsten Wirtschaftsmächte Europas. Manche sehen die Hanse gar als Vorläufer der Europäischen Union: Auch, wenn die Hanse nie in eine feste politische Struktur eingebunden war, so handelte die Gemeinschaft der Hansestädte in gewissem Rahmen doch durchaus europäisch: Der Städtebund vertrat seine Handelsinteressen über Stadt- und Ländergrenzen hinaus, verschaffte seinen Mitgliedern Handelsprivilegien und entschied Streitigkeiten durch eine eigene Gerichtsbarkeit, die von den Ältesten, den sogenannten Oldermännern, ausgeübt wurde.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2018 Tourismus und Stadtentwicklung
…braucht man Platz, an dem man ruht. Das trifft zumindest auf Reisen zu, die länger als nur einen Tag andauern. Die Gründe für eine solche Reise können sowohl geschäftlich als auch zu Bildungs- oder Erholungszwecken sein. Dafür befinden sich an den Reisezielen entsprechende Einrichtungen, die die täglichen Bedarfe der Reisenden decken. Hierzu zählen insbesondere Unterkünfte wie Hotels, Pensionen, Ferienhäuser und -wohnungen, Jugendherbergen oder Campingplätze. Die Qualität und Ausstattung variiert je nach Zielgruppe und Lage. Die Sinus-Milieus als Gesellschaftsmodell sollen an dieser Stelle für den Schwerpunkt des Urlaubstourismus in Deutschland sowie für die Urlaubsregionen Berlin und Mecklenburg-Vorpommern Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzeigen.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2017 Mobilität und Stadtentwicklung
Ein Querschnittsthema, an dem viele positive Ansätze und ambitionierte Vorhaben scheitern, sowohl im eigentlichen Verkehrsbereich als auch im Städtebau, ist das Thema "Parken" – der Umgang mit dem ruhenden Verkehr. Vor diesem Hintergrund thematisiert der vorliegende Beitrag, wie Parkraummanagement als frühzeitiges Steuerungsinstrument in städtebaulichen Konzepten eingesetzt werden kann. Dies betrifft sowohl den öffentlichen Raum mit seiner Bewirtschaftung des Parkraums, als auch die Regelungen bei den privaten Bauvorhaben, den Stellplatzsatzungen und ihren in Zukunft notwendigen Anpassungen an neue Mobilitätsformen. Ziel sollte es sein, bisherige Regelungen und Satzungen in übergeordnete Mobilitätskonzepte weiterzuentwickeln, die neue und innovative Mobilitätsformen gebührend berücksichtigen.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2017 Mobilität und Stadtentwicklung
Geschäftsstraßen sind wichtige Orientierungs- und Identifikationselemente im Stadtquartier. Sie sind oft auch Hauptverkehrsstraßen und deshalb prädestinierte "Shared Spaces". Ausgeführte Beispiele zeigen, dass Einkaufen, Flanieren und Verweilen Spaß macht, wenn bei der Gestaltung die Nahmobilität zu Fuß und mit dem Rad im Vordergrund steht, die Geschwindigkeiten bei maximal 30 km/h liegen, das Auto nicht dominiert und der Straßenraum Qualität als Freiraum hat. Die Beispiele zeigen darüber hinaus, dass es ein breites Spektrum gut funktionierender Lösungsansätze gibt, wenn die örtlichen Randbedingungen sorgfältig beachtet und individuelle, maßgeschneiderte Lösungen erarbeitet werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2023 Urbane Daten in der Praxis
Ob Bürgerbüro, Restaurantbesuch oder Sporthalle – viele Menschen besuchen täglich öffentliche Orte und öffentlich zugängliche Gebäude. Auf einen barrierefreien Zugang sind insbesondere Besuchende mit Seh-, Hör- oder Mobilitätseinschränkungen angewiesen. Gleiches gilt für Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit, weil sie zum Beispiel mit Rollator oder Kinderwagen unterwegs sind. Um die Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, gibt es verschiedene Richtlinien für die reale und digitale Welt. Die Stadt Karlsruhe leistet unter anderem mit dem Projekt „Karlsruhe barrierefrei“ ihren Beitrag zum Thema Barrierefreiheit.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2012 Integration und Partizipation
Partizipation schließt in einem weiten Verständnis alle Formen der gesellschaftlichen Teilhabe ein. In einem engeren Sinne zielt Partizipation auf die Beteiligung an politischen Diskussions- und Entscheidungsprozessen, in denen es um legitime und folgenreiche Entscheidungen über die Belange des Gemeinwesens geht. Dabei gelten für demokratisch verfasste Gesellschaften zwei Grundnormen: politische Gleichheit der Bürger in der Einflussnahme auf die Regierungspraxis und die öffentliche Kontrolle staatlichen Handelns. Die Gleichheitsnorm besagt dabei nicht, dass sich immer alle beteiligen müssen, denn auch die Freiheit, sich nicht zu beteiligen, gehört zum demokratischen Selbstverständnis. Politische Gleichheit wird allerdings immer dann verletzt, wenn bestimmten Bevölkerungsgruppen Beteiligungsrechte systematisch vorenthalten werden – sei es durch Gesetze oder durch andere Barrieren.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2010 Stadtumbau – zweite Halbzeit

Erschienen in Heft 4/2024 Transformation des Wohnens
Das Einfamilienhaus (EFH) war und ist eine der bedeutendsten Wohnformen in der Bundesrepublik, doch scheint diese Bedeutung in jüngerer Zeit eine andere Form anzunehmen. Seit den Nachkriegsjahrzehnten etablierten Einfamilienhäuser sich – politisch gefördert – als wohnkultureller Mainstream. Ein Einfamilienhaus zu besitzen, zementiert auch heute noch für viele den Status gesellschaftlichen Erfolgs, verspricht individuelle Freiheit, Familienidyll und langfristige finanzielle Stabilität. Zugleich wird immer deutlicher: Viele dieser Versprechen sind immer schwerer einzulösen, und vor allem aufgrund aktueller Anforderungen an eine klimaverträgliche Gesellschaftsentwicklung besteht im EFH-Segment ein hoher Transformationsbedarf, der einer verstärkten politischen Aufmerksamkeit bedarf.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2021 Digitalisierung als Treiber der Stadtentwicklung
Die Pandemie hat viel verändert – und manches, was schon angelegt war, in seiner Entwicklung beschleunigt. Feststellungen wie diese sind derzeit oft zu hören. Stets verbunden mit der Frage: Was davon wird, was sollte bleiben? Dass Covid-19 Folgen für die Gestaltung von Planungsprozessen haben könnte, lag nicht unmittelbar auf der Hand – und wurde 2020 dennoch sehr bald deutlich. Denn in den gesetzlich normierten Planungsverfahren ist auch die Begegnung von Menschen vorgesehen – insbesondere im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung. Als das nun nicht mehr möglich wurde, gerieten mancherorts Prozesse ins Stocken, was, zum Beispiel, in der verbindlichen Bauleitplanung erhebliche Probleme bereiten kann. Erst mit dem "Planungssicherstellungsgesetz" (Deutscher Bundestag 2020 und 2021) wurde klargestellt, dass etwa Bürgerversammlungen auch digital durchzuführen sind. Aber: Was heißt das? Und: Wie geht das?
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2014 Kommunikationslandschaften
Wer heute die Zeitung aufschlägt oder filmische Dokumentationen über das Leben von Migranten in den Städten anschaut, stößt immer wieder auf einseitige, problemfixierte Berichterstattungen. Eine polarisierende Deutungspraxis scheint im medialen Kontext zur Normalität zu gehören. Sie schreibt Grenzen fest, macht Menschen permanent zu Fremden, reduziert den komplexen urbanen Alltag auf Gegensätze zwischen uns und denen. In diesem Aufsatz werde ich veranschaulichen, welchen Einfluss die massenmediale Kommunikation im Migrationskontext auf die Entstehung eines ‚ethnischen Wissens‘ im urbanen Kontext hat. Davon ausgehend werde ich die Notwendigkeit eines Perspektivwechsels, einer anderen Sicht auf Migration und Urbanität begründen.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2008 Stadtentwicklung und Verkehr
Wenn man das Thema Mobilität betrachtet, ist es selbstverständlich, dass es im Kontext der Alltagswirklichkeit der Menschen steht. Bisher überwiegt jedoch die Betrachtung der Wegeketten und Mobilitätszwecke, ohne diese in einen strukturellen, individuellen Kontext der Menschen zu stellen – eine funktionale, allerdings auch sehr rationale Betrachtung. Neben den umfangreichen Erkenntnissen hinsichtlich der Wohnungsnachfrage, die zur Erstellung von Milieuprofilen auf dem Wohnungsmarkt führten, kann der Milieu-Ansatz auch im Verkehrssektor eine neue Sichtweise liefern. Dieser Beitrag zeigt in kurzer Übersicht, welche Differenzierungsleistung die Milieu-Perspektive in Bezug auf das Verstehen von Mobilitätsmustern beisteuern kann.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2005 Bürgerorientierte Kommunikation / Teilhabe an Stadtentwicklung und Wohnungspolitik

Erschienen in Heft 3/2007 Den demografischen Wandel gestalten!

Erschienen in Heft 6/2006 Neue Investoren auf dem Wohnungsmarkt – Transformation der Angebotslandschaft
Die Realität hat die Kommunalen Wohnungsunternehmen (KWU) eingeholt. Zur Erhaltung und Sicherung ihrer Handlungsfähigkeit mussten die Unternehmen bereits ihren Personalbestand abbauen, Instandhaltung und Investitionen einschränken sowie die Mieten an das Marktniveau anpassen. Insofern sind inzwischen keine bedeutenden Unterschiede in den Geschäftsplänen von KWU und neuen Investoren mehr festzustellen. In der Kunden- und Sozialorientierung, bislang immer einer der Vorteile der KWU, passen sich die neuen Investoren zunehmend an. Vielen Städten bleibt zur Erhaltung ihrer Handlungsfähigkeit nur übrig, Gebühren drastisch zu erhöhen und/oder Beteiligungen zu verkaufen. Diese neue Situation erfordert eine gedankliche Umorientierung im Hinblick auf die Ziele von Wohnraumsicherung und Städtebau. Die für den Laien kaum noch zu überblickenden gesetzlichen Anforderungen an die Vermieter führen zur Verringerung der Anzahl der "Privatvermieter" und zu einer weiteren Professionalisierung des Vermietens. Diese Dimension sowie die wirtschaftliche und soziale Konsequenz einer Verringerung der Zahl privater Vermieter ist derzeit kaum noch zu überschauen.
Beiträge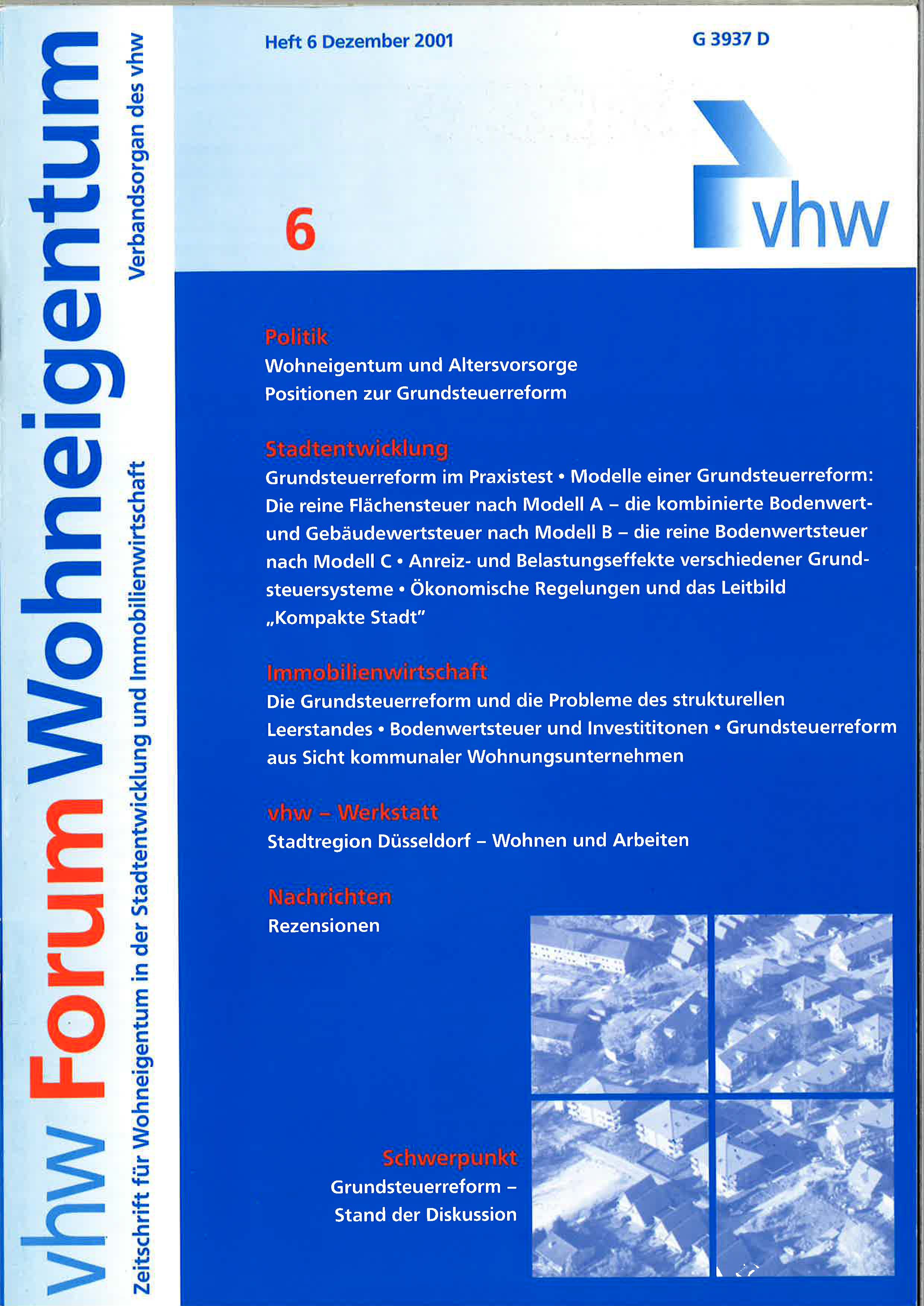
Erschienen in

Erschienen in Heft 4/2017 Gemeinwesenarbeit und Stadtentwicklung
Am Abend des 13. Juni 2017 wurde im Hamburger "Schuppen 52" im Rahmen des 11. Bundeskongresses Nationale Stadtentwicklungspolitik der "Integrationspreis 2017" verliehen. Unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet der Wettbewerb hervorragende Projekte aus, die dazu beitragen, in den Wohnquartieren lebendige Nachbarschaften zu erhalten, Ausgrenzung zu vermeiden und Integration zu unterstützen. Eine elfköpfige Fachjury hat unter dem Vorsitz des ZDF-Moderators Mitri Sirin aus dem großen Feld der qualitätsvollen Bewerbungen die besten Projekte ausgewählt. Zwei von ihnen wurden im Rahmen der Preisverleihung mit dem Integrationspreis in den Kategorien "Nachbarschaften" und "Netzwerke" prämiert. Insgesamt hatten es zwölf Projekte auf die Nominierungsliste geschafft.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2011 Soziale Kohäsion in den Städten

Erschienen in Heft 3/2010 Integration und Stadtentwicklung
Was im Jahr 2005 mit einem Modellprojekt in Osnabrück begann, hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Das Projekt "Integrationslotsen in Niedersachsen" hat in allen Regionen Niedersachsens Fuß gefasst. Über 1.000 Interessierte wurden zu ehrenamtlichen Integrationslotsen qualifiziert. Nach wie vor nutzen weitere Menschen mit und ohne Migrationshintergrund die von Bildungseinrichtungen und anderen Kursträgern angebotenen Qualifizierungskurse. Ein großer Teil der Integrationslotsen unterstützt inzwischen Zugewanderte im Integrationsprozess oder bringt sich durch andere Aktivitäten in das Integrationsgeschehen vor Ort ein.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2010 Integration und Stadtentwicklung
Kommunale Integrationspolitik steht aktuell vor einer doppelten Herausforderung. Neuere Bestandsaufnahmen, wie z.B. das Jahresgutachten 2010 des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration und Migration oder der Migrationsbericht 2008 des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (veröffentlicht im Februar 2010), können als Entwarnung gelesen werden. Die Bundesrepublik steht demnach im internationalen Vergleich integrationspolitisch ganz gut da, die messbare Integration sei in vielen Bereichen "durchaus zufriedenstellend oder sogar gut gelungen". Zudem hat der "Zuwanderungsdruck" so deutlich nachgelassen, dass sich Zu- und Abwanderung nahezu die Waage halten. Gleichzeitig sind die Kommunen auf dem Wege in eine Finanzmisere, die weit über das übliche Szenario hinausgeht.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2011 Städtenetzwerk Lokale Demokratie
Muss man in Zeiten von Stuttgart 21 eigentlich noch erklären, warum man sich mit der Frage der Einbeziehung von Bürgern in politische Debatten und Entscheidungen beschäftigt? Wir denken ja – denn Stuttgart 21, die Hamburger Schulreform und was darüber hinaus an aktuellen Beispielen durch die Medien geht, sind alles Symptome und Anzeichen für einen tiefgehenden Prozess in unserer Gesellschaft. Die Rahmenbedingungen für unsere Demokratie haben sich ebenso verändert wie die Erwartungen der Bürger an politische Teilhabe. Immer weniger Menschen beteiligen sich an Wahlen oder sind bereit, sich in Parteien und Verbänden zu engagieren. Zur gleichen Zeit zeigen aber auch gerade diese Auseinandersetzungen, dass die Bürger Interesse an Politik haben und sie sich an politischen Entscheidungen beteiligen wollen. Unsere repräsentative Demokratie ist durch unterschiedliche Entwicklungen in den vergangenen Jahren unter Druck geraten – Entwicklungen, die eine Vitalisierung der Demokratie in Deutschland, eine Reaktion auf die veränderten Rahmenbedingungen, erforderlich machen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2011 Mehr wissen – mehr wagen – mehr Dialog
Wer "Mehr wissen, mehr wagen, mehr Dialog" fordert, muss diesen Anspruch auch selbst einlösen! Unter diesem Leitgedanken hat der vhw auf seinem diesjährigen Verbandstag und zugleich zweiten Kongress Städtenetzwerk am 6. und 7. Oktober 2011 in Berlin zur aktiven Diskussion eingeladen. Auf 15 Diskussionsinseln wurden am ersten Kongresstag ganz unterschiedliche Themen, die mit dem Kongressthema „Vom Veto zum Votum: mehr Dialog für mehr Demokratie!“ in Zusammenhang standen, parallel diskutiert. Von Infrastrukturprojekten über Segregation hin zu bürgerschaftlichem Engagement – der Dialog zwischen den Akteuren der Stadtgesellschaft spielt in unseren Städten an zahlreichen Stellen eine Rolle und muss von vielen Perspektiven beleuchtet werden. Auf dem Kongress wurde der Dialog nun – auch jenseits der primär theoretischen Abhandlungen im Plenum – ganz praktisch erfahrbar gemacht.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2021 Wohnen in Suburbia und darüber hinaus
Die Coronapandemie und die dadurch ausgelöste Wirtschaftskrise haben den Immobilienmarkt in Deutschland kaum getroffen. Gerade die Preise für Wohnimmobilien sind weiter gestiegen – wenn auch in einigen Segmenten nicht mehr ganz so stark wie noch in den Jahren vor der Pandemie. Vor allem gibt es jedoch Anzeichen für grundlegende strukturelle Veränderungen am Immobilienmarkt, die sich auch langfristig in unterschiedlichen Entwicklungen der Mieten und Kaufpreise für verschiedene Segmente je nach Lage und Objekttyp zeigen könnten. Ursächlich hierfür sind insbesondere Veränderungen in der Arbeitswelt. Die Lockdowns haben gezeigt, dass viele Menschen effizient und produktiv zu Hause arbeiten können. Zwar zeigen sich auch Grenzen des mobilen Arbeitens, weshalb das Büro ein zentraler Ort für Kommunikation und Austausch bleiben wird, doch in vielen Unternehmen wird zumindest ein größerer Teil der Belegschaft auch zukünftig zwei oder drei Tage von zu Hause aus arbeiten. Dies wird auch Folgen für die Wohnungsnachfrage haben.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2014 Infrastruktur und soziale Kohäsion
"We built a better world", dieser Slogan zum Internationalen Jahr der Genossenschaften 2012 bringt eine Philosophie zum Ausdruck, die auch für die zahlreichen gemeinschaftlichen Wohnprojekte, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, gelten könnte. Der Trend zum gemeinschaftlichen Bauen und Wohnen erfährt in jüngster Zeit einen neuen Schub der Aufmerksamkeit und des Wohlwollens – nicht nur bei den beteiligten Protagonisten oder interessierten Nachfragern, sondern vor allem auch bei der Politik, den Stadtverwaltungen, der Wohnungswirtschaft und der Wissenschaft. Vielfach kann man den Eindruck gewinnen, als wäre angesichts nicht bewältigter Wohnungsprobleme in den Städten mit den gemeinschaftlichen Wohn- und Baugruppen ein Allheilmittel gefunden.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2014 Infrastruktur und soziale Kohäsion

Erschienen in Heft 2/2017 Mobilität und Stadtentwicklung
Sharing oder der Trend zum Teilen, Tauschen und gemeinsamen Nutzen von Gebrauchsgegenständen, Dienstleistungen oder auch Wohnraum hält seit einigen Jahren wieder vermehrt Einzug in der Wohnungswirtschaft. Im Rahmen des BMBF-Forschungsprojektes "Nachhaltige Konsummodelle der Share Economy in der Wohnungswirtschaft" (kurz: KoSEWo) wurde 2016 eine bundesweite Online-Befragung von rund 2.000 Mitgliedsunternehmen des GdW – Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass zahlreiche traditionelle Sharing-Angebote bereits fest in der Wohnungswirtschaft etabliert sind. Entwicklungspotenziale ergeben sich vor allem im Bereich der neueren Sharing-Trends, wie Car-Sharing, Tausch- und Leihbörsen oder im Bereich Ernährung. Der Beitrag gibt zudem Einblick in die Motivationen der Unternehmen, in die Wirkungen, die mit Sharing-Angeboten erzielt werden, sowie in Hemmnisse bei der Etablierung von Sharing-Angeboten.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2018 Gemeinwohlorientierung in der Bodenpolitik
Ohne Grund und Boden kann sich der Mensch nicht bewegen, nicht arbeiten, nicht wohnen, nicht leben – Grund und Boden sind eine Voraussetzung für die Entwicklung der Städte. Der Bodenmarkt ist im Übrigen ein dem Wohnungsmarkt vorgelagerter Markt – Bodenmarktprobleme haben damit immer unmittelbare Auswirkungen auf das Wohnen! Die Verfügbarkeit von Boden ist nicht frei. Nutzungsrechte stehen i.d.R. nicht der Allgemeinheit zur Verfügung, sondern liegen beim Eigentümer. Die Interessen der Grundstückeigentümer sowie das Interesse der Allgemeinheit lassen sich aber nicht immer vereinbaren. Dazu kommt, dass Planung dazu beiträgt, Grund und Boden maßgeblich (erst) in Wert zu setzen.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2023 Urbane Daten in der Praxis
Erfassung, Analyse und Auswertung von urbanen Daten sind unverzichtbare Bausteine beim Bestreben, die Lebensqualität in Städten zu verbessern und an verschiedenen Stellen Effizienz zu erzeugen. Nur mit ihrer Hilfe können die Herausforderungen der Planung und Entwicklung vernetzter Städte und Gemeinden angenommen werden. Neben den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten im Kontext Energie, Mobilitäts- und Messwertdaten stellt sich zunehmend die Frage, wie eine bedarfsgerechte Infrastruktur zur Erfassung dieser Daten ausgeprägt und betrieben werden kann. Als Akteur mit langjähriger Expertise in den Bereichen Messtechnik, moderne Kommunikationstechnologie, ganzheitliche IoT-Lösungen sowie als Plattformbetreiber, kann ZENNER International als integrierter Lösungsanbieter unterstützen.
Beiträge