
Erschienen in Heft 1/2021 Religion und Stadt
Der Beitrag beschäftigt sich mit der Funktion von Kirchengemeinden in Hinblick auf Migration. Nach einigen Begriffen zur Unterscheidung werden die sogenannten "muttersprachlichen Gemeinden" innerhalb der katholischen Kirche am Beispiel Berlins skizziert. Die Beschreibung ihrer Rolle neben deutschsprachigen Gemeinden führt zu Überlegungen hinsichtlich der selektiven Wahrnehmung von Migration. Die Autorin problematisiert die Wahrnehmung von "Integration", da sie Veränderungsprozesse und Entwicklung sowohl in der Kirche als auch in der Gesellschaft ausblendet.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2005 Bürgerorientierte Kommunikation / Teilhabe an Stadtentwicklung und Wohnungspolitik
Den partizipativen Verfahren kommt eine zunehmende Bedeutung bei Entscheidungsfindungen in einer Fülle gesellschaftlicher Bereiche zu. Ausgeweitete Formen und Zahl der Arenen der Beteiligung bedeuten aber auch differenzierte und immer wieder neu herzustellende Formen der Kommunikation, die vor allem dann erfolgreich gestaltet werden können, wenn der Sinn der (Sprech-)Handlungen des Gegenüber wahrgenommen und vor dem eigenen Erfahrungshintergrund eingeordnet sowie das eigene kommunikative Handeln in einer Weise beeinflusst wird, um ein kooperatives Ziel anzustreben. Meist ohne es zu wissen, werden von den Akteuren und Akteur in Partizipationsverfahren qualitative Methoden empirischer Sozialforschung angewandt, indem die alltagsnahe Kommunikation systematisiert und Grundlage eines strategischen Partizipations-Kalküls wird.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2007 vhw Verbandstag 2007: Migration – Integration – Bürgergesellschaft
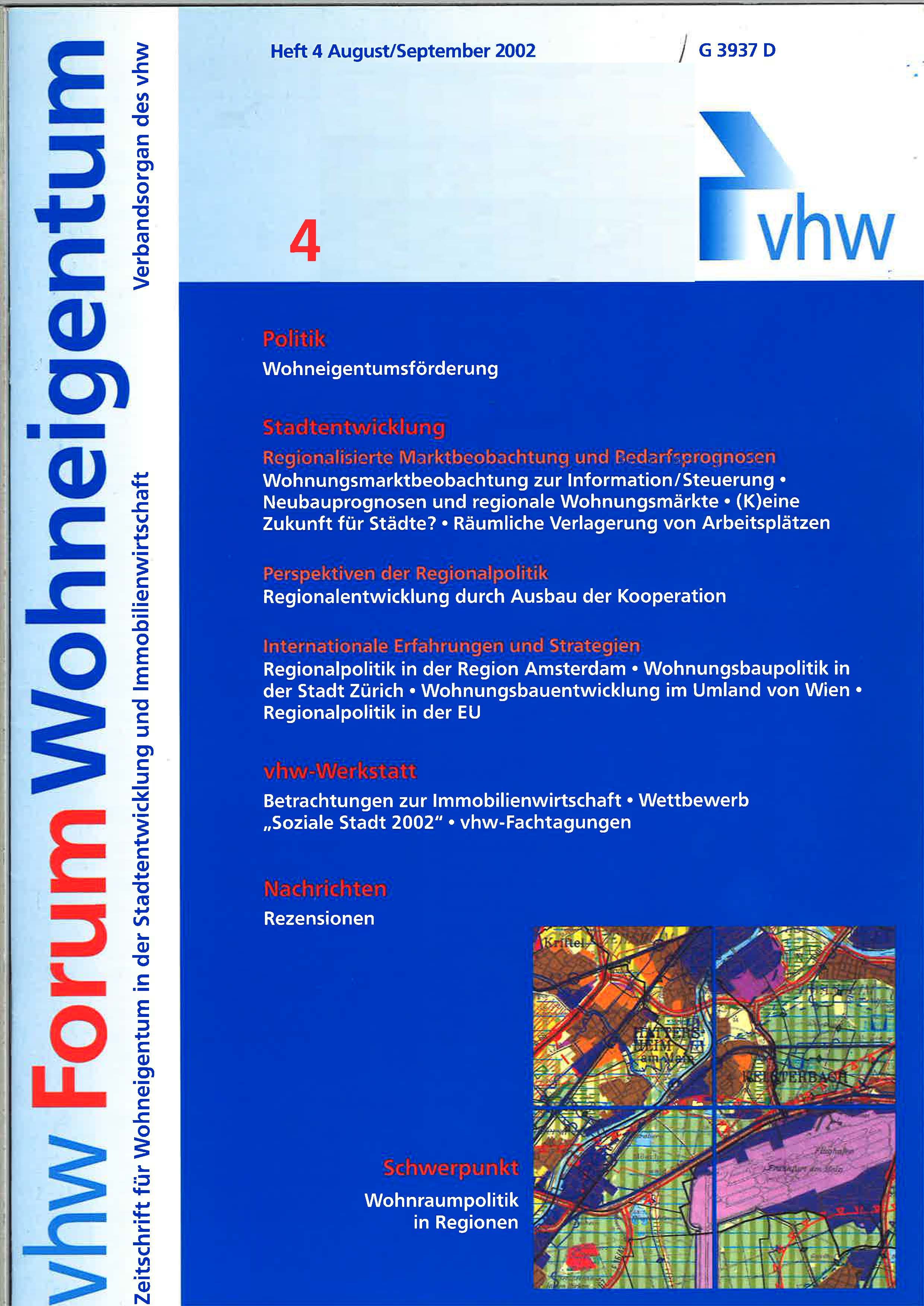
Erschienen in
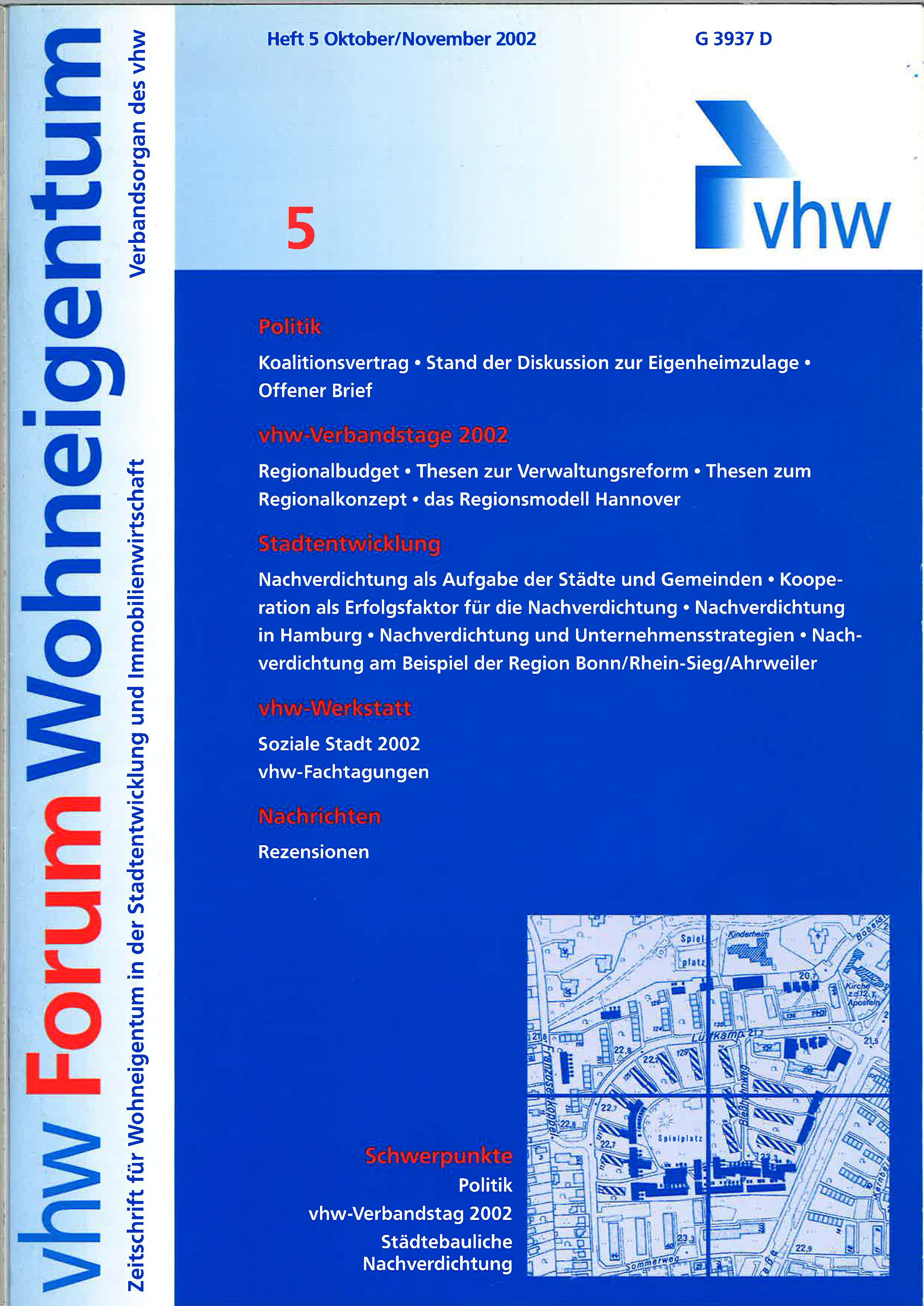
Erschienen in
Die Region Mittelfranken: Zunehmende räumliche Verteilung des Arbeitsplatzangebotes, rückläufige Umlandwanderung
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2011 Mehr wissen – mehr wagen – mehr Dialog
Der Impuls, sich politisch in der lebendigen Demokratie zu engagieren, erfolgt sicherlich aus sehr unterschiedlichen Motivationen heraus. Aber der gemeinsame Nenner ist doch, teilzunehmen, Subjekt und nicht Objekt zu sein, Gutes zu bewirken. Dieser Impuls und diese Motivation muss in jedem und jeder stark sein, wenn man sich über einen längeren Zeitraum in diesem politischen und immer öffentlichen Umfeld bewegt. Und das natürlich gerade deswegen, weil man doch relativ schnell lernen muss, dass der "Fortschritt eine Schnecke ist" wie wir alle bei Günter Grass nachlesen konnten.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2012 Stadtentwicklung und Sport

Erschienen in Heft 6/2023 Kommunale Religionspolitik
Putnams Sozialkapitalansatz beschreibt die Vorteile eines sozialen Netzwerks, das verschiedene gesellschaftliche Gruppen verbindet. Diese Impulse können für die Gestaltung inklusiver Quartiere genutzt werden. Gleichzeitig weist der Ansatz auch darauf hin, dass sich Sozialkapital nicht aus dem Nichts heraus entwickelt. Strukturelle und personelle Ressourcen können diese Entwicklung wirksam unterstützen. Bei meist mittelschichtsorientierten Neubauquartieren ist jedoch die Frage, wie die dafür benötigten Ressourcen gewonnen werden können. Die diakonische Stephanus-Stiftung hat eine modellhafte Vorgehensweise entwickelt, um Neubauquartiere auch ohne Fördermittel inklusiv gestalten zu können.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2023 Kommunale Religionspolitik
Das wissenschaftliche Interesse an jüdisch-muslimischen Begegnungen auf kommunaler Ebene hat in den letzten 20 Jahren stetig zugenommen. Zu den Gründen hierfür zählen die polarisierten Debatten rund um den Israel-Palästina-Konflikt und die Angst vor dem sogenannten importierten Antisemitismus durch muslimische Geflüchtete sowie die antimuslimischen Ressentiments in Teilen der jüdischen Gemeinden. Solch aufgeladene Makronarrative übersehen jedoch häufig lokale Prozesse der religiösen Beheimatung sowie die dadurch entstehenden langfristigen Beziehungen zwischen Juden und Muslimen in urbanen Räumen. Becker (2019) konstatierte durch ihre Nachbarschaftsstudie in Berlin-Kreuzberg einen entstehenden „lokalen, kosmopolitischen Habitus“, der von einer neuen Generation jüdisch-muslimischer Aktivistinnen und Aktivisten und von interreligiösen Initiativen gelebt und beworben wird. Dieser noch junge „local-urban turn“ für die Erforschung jüdisch-muslimischer Begegnungen trägt zur gegenwärtigen Debatte einer postulierten postmigrantischen Gesellschaft bei, in der etablierte, kulturelle, religiöse und nationale Identitäten, Hierarchien und Ressourcen neu verhandelt werden (Foroutan 2015).
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2023 Bildung in der Stadtentwicklung
Welches Bild kommt Ihnen in den Kopf, wenn Sie an Ihren früheren Schulhof denken? Bei vielen wird dieses Bild aus Beton mit ein paar Sitzgelegenheiten, ein bis zwei Bäumen und vielleicht einer Tischtennisplatte bestehen. Die Sommer sind inzwischen heißer geworden, Starkregenereignisse haben zugenommen, und längst ist bekannt, dass Naturerfahrungen in der Kindheit essenziell für eine gesunde Entwicklung und späteres Umweltbewusstsein sind. Dennoch besteht der Großteil der Schulhöfe in Deutschland weiterhin aus eintönigen, versiegelten und in die Jahre gekommene Betonflächen. Oder es sind neugebaute Außenanlagen, auf denen ein Landschaftsplanungsbüro teure Designentwürfe umgesetzt hat, die sich überhaupt nicht mit den Bedürfnissen der Schulgemeinschaft decken und den Anforderungen der Klima- und Biodiversitätskrise in keinster Weise gerecht werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2018 Tourismus und Stadtentwicklung
Berlin ist im Rekordtaumel: 6,2 Mio. Besucher buchten bereits im ersten Halbjahr 2017 knapp 15 Millionen Nächtigungen – fast 4% mehr als im Vorjahr. Zusätzlich drängen sich 300.000 Tagesgäste um die Attraktionen der Kapitale, und weitere 100.000 Menschen kommen täglich privat bei Freunden und Verwandten unter. Dieser beeindruckende Wachstumstrend lässt sich seit sieben Jahren für ganz Deutschland erkennen. Während Touristiker und Regierungen weltweit über Tourismuswachstum jubeln, mehrt sich unter der Bevölkerung Widerstand gegen dieses „Zuviel“ an Besuchern in ihrem Lebensumfeld. Dabei ist Overtourism kein neues Phänomen, sondern so alt wie der organisierte Tourismus selbst.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2017 Mobilität und Stadtentwicklung
Bei der Unterbringung und der Integration von Geflüchteten hat der vhw auch die spezifischen Herausforderungen von kleinen und mittleren Kommunen im Blick. Im Gespräch mit Thomas Scholz, Bürgermeister vom Marktflecken Mengerskirchen (Gemeinde im Landkreis Limburg-Weilburg in Hessen mit 5.787 Einwohnern), wollten wir von einem lokalen Experten erfahren, wie Integration gerade im ländlichen Raum erfolgreich gestaltet werden kann. Anna Becker vom vhw sprach mit ihm über den Umgang mit neuen Aufgaben, pragmatische Lösungsansätze, die kreative Nutzung kommunaler Handlungsspielräume und über die Bedeutung unterstützender Maßnahmen der Landes- und Bundesebene.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2012 Nachhaltigkeit und Wohnen
Das Bedürfnis nach Sicherheit und das Bedürfnis nach Mobilität sind zwei äußerst starke Triebkräfte des gesellschaftlichen Wandels im 21. Jahrhundert. Beides sind gemäß der Jung’ianischen Terminologie archetypische Bedürfnisse, das heißt Bedürfnisse, die dem Homo erectus/sapiens genetisch vorprogrammiert sind. Von der steinzeitlichen Höhle bis zum 40-Quadratmeter-Appartement oder dem Reihenhaus ist der Schutz das primäre Erfordernis an eine Behausung. Erst wenn der Schutz vor Wetterunbill und vor Feinden gegeben ist, steigt der Anspruch an Wohnkomfort.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2018 Gemeinwohlorientierung in der Bodenpolitik
Nachdem das Bundesverfassungsgericht am 10. April 2018 die alte, auf Einheitswerten beruhende Grundsteuer verworfen hat, liegen wieder alle Reformoptionen auf dem Tisch. Der Beitrag stellt kurz die konkurrierenden Reformmodelle und deren Belastungsziele dar. Anschließend wird eine exemplarische Zahllastverschiebungsrechnung für zwei sehr unterschiedliche Städte (Zweibrücken in Rheinland-Pfalz und Berlin) vorgestellt und diese hinsichtlich ihrer Auswirkungen interpretiert. Es zeigt sich die deutliche Überlegenheit von Bodensteuern gegenüber solchen Steuern, die auch das Gebäude mit einbeziehen. Dennoch sind insbesondere bei der reinen Bodenwertsteuer in Metropolen in einzelnen Fällen auch problematische Belastungswirkungen möglich, die sich aber adjustieren lassen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2015 Einfamilienhäuser der fünfziger bis siebziger Jahre

Erschienen in Heft 5/2010 Stadtentwicklung und demografischer Wandel
Menschenleere Landstriche, überalterte Städte, Überforderung der jungen Generation, die die Finanzlast der Alten nicht mehr tragen kann – dies sind Bilder, die immer wieder mit dem demografischen Wandel in Verbindung gebracht werden. In der öffentlichen Diskussion wird die Alterung der Gesellschaft oft als Belastung vor allem für die sozialen Sicherungssysteme gesehen, aber immer mehr werden auch die positiven Seiten des Alter(n)s diskutiert und die Potenziale. In den Diskussionen über den demografischen Wandel wird meist außer Acht gelassen, dass es den demografischen Wandel nicht gibt. Eine Vielzahl unterschiedlicher Entwicklungen stehen hinter diesem Begriff, die eine differenzierte Betrachtung verlangen.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2024 Urbane Resilienz
Naturkatastrophen, Cyberattacken, Pandemie, Folgen internationaler Kriege und politischer Spannungen, Fachkräftemangel: Krisenhafte Ereignisse folgen in immer höherer Taktung aufeinander oder überlagern sich gar. Die Auswirkungen auf Kommunen und Regionen als Wohn- und Arbeitsorte sind immens – so auch auf den Landkreis Coburg. Eine äußerst angespannte Haushaltslage mit einhergehenden Sparzwängen, (drohenden) Insolvenzen von Wirtschaftsunternehmen und im kommunalen Klinikverbund sowie die drohende Unterversorgung mit Hausärzten und der Pflegenotstand erhöhen den Handlungsdruck.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2024 Wasser als knappe Ressource
Die Verfügbarkeit von sauberem Trinkwasser ist als wesentlicher Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge nicht mehr aus deutschen Haushalten wegzudenken. Trotzdem wird hierzulande viel Mineralwasser aus Flaschen konsumiert. Der Umstieg auf Leitungswasser ist ein einfacher Weg, CO2 einzusparen. Mit Blick auf den Klimawandel und die Hitzebelastung wird die Bedeutung des Zugangs zu Trinkwasser in öffentlichen Räumen drastisch zunehmen. Auch deswegen sind neue Konzepte für die Stadtplanung gefragt.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2024 Transformation des Wohnens
Die Wohnungsfrage der Gegenwart wird gern mit der Wohnungsnot zu Beginn des 20. Jahrhunderts verglichen. Als Lösung propagiert werden heute auch die damaligen Ansätze, so etwa das Wohnungsneubauprogramm des Roten Wien in der Zwischenkriegszeit oder die Wohnungsneubauentwicklungen in Großstädten der Weimarer Republik. Das Ziel hieß damals, kurz gesagt, dem Mangel an Wohnungen für die neu in die Stadt ziehenden Wohnungssuchenden sowie für die ansässige Arbeiterklasse in ihrer Wohnungsnot durch gemeinnützigen, meist öffentlichen Wohnbau als Neubau zu entgegnen. Geblieben ist davon bis heute der angesichts von Mangel an Wohnraum oft zu hörende, beschwörungsartige Lösungsspruch: „Bauen, bauen, bauen.“ Weitaus weniger ist geblieben von dem Zusatz, wonach das Gebaute gemeinnützig und kollektiv sein soll.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2018 Kooperationen im ländlichen Raum
Ostdeutschland verändert sich noch immer in einem rasanten Tempo. Gerade das Land und kleine Städte sind zum Sinnbild steckengebliebener Entwicklungshoffnungen geworden. Seit 2012 unterstützt die Robert Bosch Stiftung mit dem Programm „Neulandgewinner. Zukunft erfinden vor Ort“ engagierte Menschen und Initiativen, die Chancen auf Veränderung sehen. Vor diesem Hintergrund entstand die Publikation „Neuland gewinnen – Die Zukunft in Ostdeutschland gestalten“, die 2017 im Christoph Links Verlag erschienen ist. Grund genug für uns, ein Gespräch mit den Herausgebern Siri Frech, Babette Scurrell und Andreas Willisch zu den Entwicklungschancen von Kleinstädten und Dörfern zu führen. Das Interview für unsere Zeitschrift (FWS) führte Frank Jost.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2025 Korruptionsprävention in Kommunen
Fehlende Transparenz und unklare Verantwortlichkeiten begünstigen Korruption in Kommunen und untergraben das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Transparency International Deutschland e. V. stärkt mit einem Netzwerk kommunaler Mitglieder die Integritätskultur vor Ort. Kommunen, die sich zur Korruptionsprävention verpflichten, erfüllen definierte Standards, erneuern regelmäßig ihre Selbstverpflichtung und profitieren vom fachlichen Austausch. Das Netzwerk fördert stetige Weiterentwicklung sowie Transparenz und Rechenschaft in Politik und Verwaltung.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2025 Urbane Räume im digitalen Wandel
Mit abnehmender Mobilität steigen die Herausforderungen im Alltag älterer Menschen, beispielsweise beim Einkaufen, bei Bankgeschäften oder der Suche nach medizinischer Versorgung. Digitale Lösungen und soziale Netzwerke können helfen, diese Barrieren zu überwinden und die soziale Teilhabe zu fördern. Doch oft fehlen Senioren die nötigen Kompetenzen, um diese Technologien zu nutzen. Hier setzt das Projekt Seniorennetz Berlin an, mit dem Ziel, ältere Menschen im Umgang mit digitalen Medien und Informationen zu unterstützen und ihnen so mehr Selbstständigkeit und soziale Integration zu ermöglichen. Ursprünglich im Märkischen Viertel gestartet, hat es sich zu einem berlinweiten Vorzeigeprojekt entwickelt und zeigt, wie die Beteiligung von Senioren und die Kooperation verschiedener Akteure erfolgreich sein kann.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2022 Auswirkungen des Klimawandels und die Anforderungen an das kommunale Krisenmanagement
Die Klimaregion Rhein-Voreifel liegt im linksrheinischen Teil des Rhein-Sieg-Kreises zwischen Köln und Bonn. Sie besteht aus den Kommunen Alfter, Bornheim, Meckenheim, Rheinbach, Swisttal und Wachtberg. Auf einer Fläche von etwa 325 km² repräsentieren diese sechs Städte und Gemeinden zusammen knapp 160.000 Einwohnerinnen und Einwohner. 2006 begannen die Kommunen der Klimaregion damit, sich im Rahmen der Umsetzung des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK) Voreifel-Ville zusammenzuschließen. Gemeinsam sollten Leitprojekte umgesetzt und zentrale Zukunftsaufgaben bewältigt werden. Eines der wichtigen Ziele war die interkommunale Zusammenarbeit beim Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien sowie bei der Steigerung der Energieeffizienz. Und da auch Klimaschutz und Klimawandel nicht an den kommunalen Grenzen haltmachen, vereinbarten die sechs Städte und Gemeinden 2010 das „Regionale Bündnis für Klimaschutz“.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2021 Stadtentwicklung und Vergaberecht
In den zurückliegenden Jahren kletterte die Wohnraumnachfrage in den Speckgürteln vieler Großstädte. Die Pandemie verstärkt diesen Trend, und auch ländliche Regionen sind zusehends gefragt. Aber wie nachhaltig ist er, und wie sollten die vom Boom betroffenen Kommunen reagieren?
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2021 Stadtentwicklung und Vergaberecht
„Konzeptverfahren“ oder „Konzeptvergaben“ sind wettbewerblich organisierte Grundstücksgeschäfte, bei denen eine Kommune ein Grundstück oder ein Erbbaurecht in einem Bietverfahren nicht ausschließlich nach dem höchsten Preis, sondern zusätzlich oder einzig unter Berücksichtigung der Qualität eines von den Auftragnehmern einzureichenden und bei Bedarf zu präsentierenden Nutzungskonzepts vergibt. Aus rechtlicher Sicht handelt es sich hierbei um ein Auswahlverfahren, das rechtsstaatlichen Anforderungen unterliegt, wobei verschiedene Konstellationen zu unterscheiden sind. Konzeptverfahren unterliegen in aller Regel nicht dem Vergaberecht. Da Einzelheiten der Abgrenzung und Einordnung nicht unumstritten sind, empfiehlt sich ein pragmatisches Herangehen durch Orientierung an vergaberechtlichen Grundsätzen.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2022 Kooperationen von Kommunen und Zivilgesellschaft
Die Internationale Bauausstellung (IBA) Thüringen agiert in einem weitgehend ländlich geprägten Raum. Aus der Erfahrung eines mehr als zehnjährigen Projektprozesses mit vielen Akteuren im ganzen Land sollen in diesem Beitrag die Kraft der Zivilgesellschaft und die Potenziale von gut gestalteten, multifunktionalen und offenen Orten hervorgehoben werden. Denn wir brauchen beides: engagierte Menschen und geeignete Orte.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2019 Stadtentwicklung und Sport

Erschienen in Heft 4/2022 Soziale Verantwortung und Mitbestimmung in der Wohnungswirtschaft
Mit der Bildung von Mieterräten 2016 wurde die bereits bestehende Struktur der Mietermitwirkung bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen Berlins ausgebaut und durch die Möglichkeit der Mitbestimmung ergänzt. Der Artikel stellt die Struktur der Mietermitwirkung vor und blickt im Sinne einer ersten Bilanz auf die auslaufende erste Wahlperiode zurück. Nach sechs Jahren hat sich das Gremium als Interessensvertretung der Mieterschaft weitgehend etabliert. Für die kommende Wahlperiode lassen sich auch Empfehlungen zu Kommunikationsstrukturen, zur Tätigkeit im Aufsichtsrat oder zur Vernetzung ableiten, um den von den ersten Mieterräten begonnenen Prozess zu stärken und weiterzuentwickeln.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2022 Soziale Verantwortung und Mitbestimmung in der Wohnungswirtschaft
Der Berliner Wohnungsmarkt wird auf absehbare Zeit Versorgungsengpässe haben, die auch durch Neubau nicht kompensiert werden können. Es wird bei einer Verwaltung des Mangels verbleiben, sodass sich Fragen der Gerechtigkeit und der Transparenz bei der Wohnungsvergabe stellen. Das vorgeschlagene Modell für die Vergabe freier Wohnungen soll eine Abkehr vom bisherigen WBS-Modell und der Kooperationsvereinbarung mit der Senatsverwaltung einleiten. Stattdessen schlagen wir ein transparentes Drei-Säulen-Modell vor, das die Vergabe der Wohnungen nach Dringlichkeit, Benachteiligung und Einkommen regelt. Dazu soll ein Wartelistensystem mit vier Wartelisten in Berlin eingerichtet werden. Der Platz auf der Warteliste richtet sich nach den Punkten, die nach einem Ampelsystem vergeben werden und deren Kriterien zur öffentlichen Diskussion stehen.
Beiträge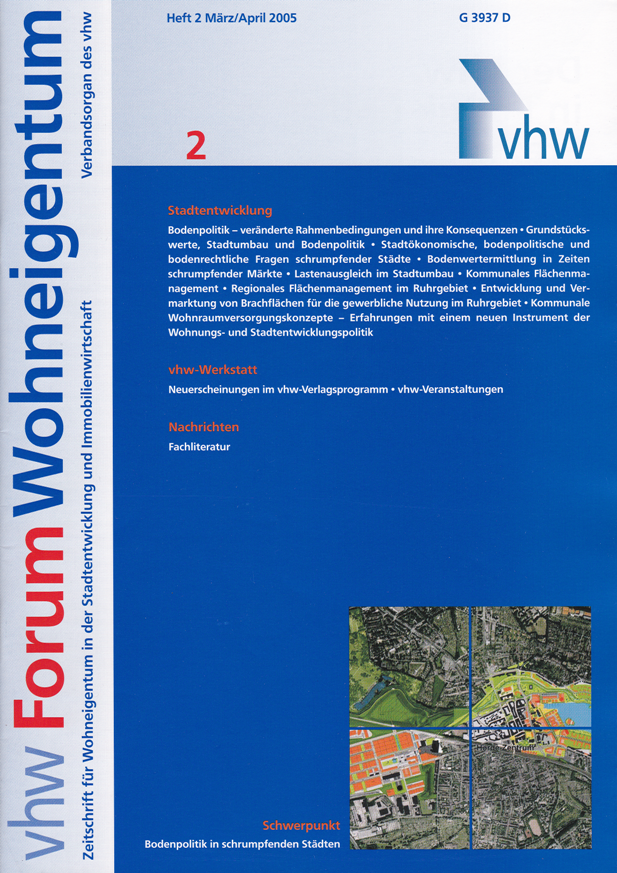
Erschienen in Heft 2/2005 Bodenpolitik in schrumpfenden Städten


Erschienen in Heft 3/2021 Verkehrswende: Chancen und Hemmnisse
Die Konzeption von Neubauquartieren beinhaltet neben der Planung von Gebäuden selbstverständlich die Planung von Straßen, Wegen und Plätzen. Eine intelligente Wegeführung und das Ziel einer bequemen Erreichbarkeit aller Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen innerhalb des Quartiers sowie die optimale Anbindung an ein übergeordnetes städtisches und regionales Verkehrsnetz sind essenziell für das Wohlbefinden der Bewohner in zukunftsfähigen Quartieren – dies ist zunächst keine neue Erkenntnis. Wohnstandortbezogene Mobilitätskonzepte gehen allerdings einen Schritt weiter und verknüpfen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), private Verkehrsmittel, wie Zweirad oder Pkw, und Mobilitätsbausteine, wie Carsharing, Lastenradsharing, die Flexibilisierung von Stellplätzen sowie ein zentrales Mobilitätsmanagement. Sie sind immer häufiger tragende Säule einer modernen Siedlungsentwicklung.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2021 Verkehrswende: Chancen und Hemmnisse
Die Verkehrswende ist in (beinahe) aller Munde. Ihre Notwendigkeit wird zumindest in den verbalen Bekundungen im Grundsatz von fast allen relevanten Akteuren in Politik und Gesellschaft kaum noch bestritten, u. a. angesichts des fortschreitenden Klimawandels und dessen Auswirkungen auf Mensch und Natur, einhergehend mit einem steigenden zivilgesellschaftlichen Engagement für eine aktivere Klimapolitik und einer entsprechend breiteren Unterstützungsbasis auch für weitreichendere Maßnahmen. Aber auch wenn gerade in Pandemiezeiten hier und da in unseren Städten sichtbar geworden ist, wie viel z. B. unsere öffentlichen Räume gewinnen könnten – warum geht die Verkehrswende trotzdem so schleppend voran?
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2016 Kommunalpolitik zwischen Gestaltung und Moderation
Die direkte Demokratie steht in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft hoch im Kurs. Wenn man dem Mainstream in der lokalen Politikforschung und der Wirtschaftswissenschaft folgt, dann kann mit dieser Partizipationsform nicht nur die Politikverdrossenheit der Bürger verringert werden, sondern auch der Output des politischen Systems verbessert sich. Danach können direktdemokratische Elemente Entscheidungsblockaden der repräsentativen Demokratie auflösen und mit Verweis auf das Schweizer Vorbild wird erwartet, dass hierdurch selbst die Haushaltskonsolidierung erleichtert wird. Aufgrund erheblicher Outputprobleme direkter Demokratie wird die Diskussion um eine Absenkung der Abstimmungsquoren und eine Ausweitung direktdemokratischer Prozesse jedoch kontrovers geführt.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2016 Kultur und Stadtentwicklung
Mit der Initiative „Baukultur Mecklenburg-Vorpommern“ ist es dem Land Mecklenburg-Vorpommern gelungen, eine Vielzahl von Akteuren unter dem Label der Baukultur zu versammeln und die baukulturellen Aktivitäten im Land nachhaltig zu profilieren. Die Ergebnisse dieser Aktivitäten sind deutlich sichtbar: In den historischen Innenstädten ist es gelungen, das reichhaltige baukulturelle Erbe zu erhalten und durch zeitgemäße Neubauten weiterzuentwickeln. Die historischen Innenstädte leisten einen wichtigen Beitrag zur touristischen Profilierung des Landes, gelten als beliebte Anziehungspunkte und werden von ihren Bewohnern als attraktive Lebensräume wahrgenommen.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2015 Die Innenstadt als Wohnstandort
Die Veranstalter unseres kommunikativen Zusammenseins haben den Referenten ein eher knappes Zeitbudget zugemessen. Daher versuche ich, aus der Not eine Tugend zu machen und trage Ihnen mit beherztem Zugriff einfach einige Thesen vor, die Sie dazu animieren sollen, sich mit ihnen kommunikativ auseinanderzusetzen. Diese sieben Thesen beschäftigen sich mit den Schlagworten „communication matters“, „governance by and as communication“, „Orte oder Plätze von Kommunikation“, „Kommunikationsprozesse sind Interaktionsprozesse“, „communication needs translation“, „Kommunikationsmittler an Schnittstellen“ sowie „Kommunen als Intermediäre“.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2014 Kommunikationslandschaften

Erschienen in Heft 1/2019 Child in the City
Der derzeitige Trend zur Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung hat besonders den Verkehrssektor erfasst. Mit den neuen Technologien wird sich auch unsere Mobilität nachhaltig verändern und neue Herausforderungen für die Mobilitätsbildung und Verkehrssicherheitsarbeit mit sich bringen. Hier knüpft das Projekt Mobility 360°: Citizens of the Future an, welches sich an Schüler von der Volksschule bis hin zur Oberstufe richtet. Im Rahmen des Projekts wurde ein innovatives Workshopkonzept unter Einsatz von Methoden des Game-Based Learning, Geodesign sowie 360° Technologien entwickelt und erprobt. In den modularen Unterrichtseinheiten setzen sich die Kinder und Jugendlichen mit Mobilität und Verkehrssicherheit auseinander und schlüpfen selbst in die Rolle von Mobilitätsforschern. So sollen unter anderem auch ihre Bedürfnisse bezüglich jetziger und zukünftiger Mobilität sichtbar gemacht werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2005 Stadtregional denken – nachfrageorientiert planen

Erschienen in Heft 1/2007 Soziale Stadt – Bildung und Integration
Bildung spielt eine Schlüsselrolle für die erfolgreiche Integration von Kindern und Jugendlichen in die Gesellschaft. Sie ist Voraussetzung für die Teilhabe am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben. Bildungsprozesse sind deshalb immer auch Integrationsprozesse. In den Kindergärten und Schulen unseres Landes werden einmalige Chancen für erfolgreiche Integrationsprozesse eröffnet oder verspielt.
Beiträge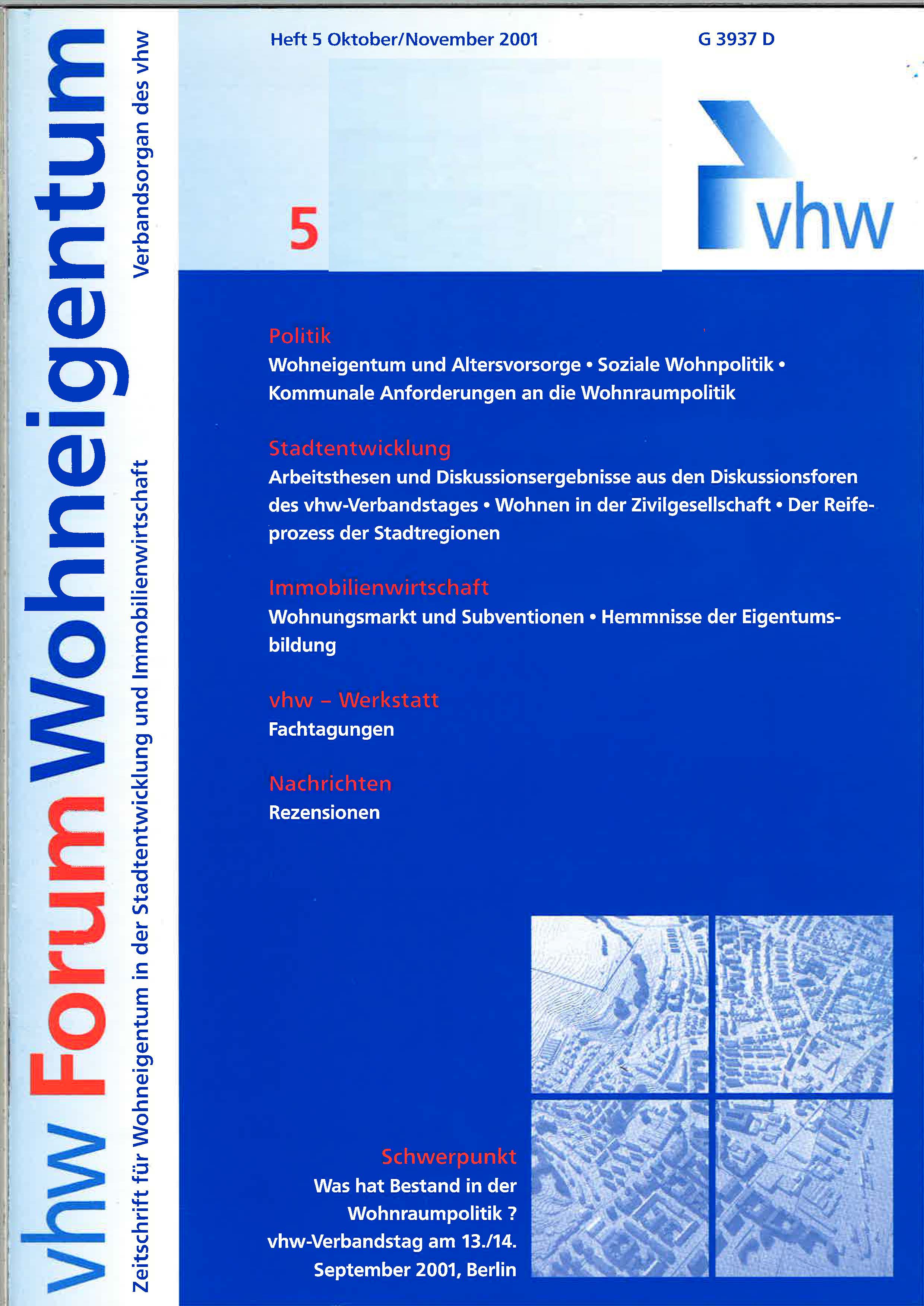

Erschienen in Heft 1/2014 Ländlicher Raum und demografischer Wandel
Leer stehende Häuser verfallen lassen oder junge Familien beim Umbau unterstützen? Die Abwassergebühren erhöhen oder mit den Nachbargemeinden die Entsorgung kostengünstig neu organisieren? Das Dorfgemeinschaftshaus schließen oder gemeinsam renovieren und nutzen? Das sind nur einige der vielen Fragen, die Bürgermeister von ländlichen Gemeinden heute beantworten müssen. Mit ihnen engagieren sich auch viele Bürger, damit ihre Gemeinde lebenswert bleibt. Patentrezepte und Standardlösungen gibt es jedoch nicht, aber viele Studien, Statistiken, Konzepte, Handbücher und erfolgreiche Beispiele, die Argumente, Ideen und Anregungen liefern. Die Servicestelle Demografie hilft dabei, die passenden Informationen schnell zu finden. Miteinander reden, Tipps austauschen und voneinander lernen – auch das organisiert die Servicestelle Demografie mit ihren Praxisforen.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2014 Ländlicher Raum und demografischer Wandel
Der Landkreis Stade ist Teil der Metropolregion Hamburg und erstreckt sich auf einer Fläche von rund 1.270 km² auf niedersächsischer Seite entlang der Unterelbe. Wie in anderen Regionen in Deutschland liegen hier Wachstum und Schrumpfung kleinräumig dicht beieinander. Die deutliche Bevölkerungszunahme der vergangenen Jahrzehnte ist wesentlich den Wanderungsgewinnen geschuldet, die aus der günstigen Lage der Städte und Gemeinden im südlichen Kreisgebiet zu Hamburg resultieren. Andererseits leiden die Gemeinden im nördlichen Kreisgebiet mit den schlechteren Anbindungen an die regionalen Arbeitsmärkte z.T. bereits seit den 1970er Jahren an Bevölkerungsverlust und Abwanderung.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2012 Stadtentwicklung und Sport
Die proletarische Vergangenheit des Fußballsports in Deutschland ist der wohl weitestverbreitete und beliebteste fußballgeschichtliche Kommunikationsinhalt im Zeitalter des professionellen Showsports. In erster Linie kennzeichnet sie die oftmals romantisch verklärende, teilweise auch mystifizierende Darstellungsweise des traditionellen Fußballs in den Medien. Zugleich ist sie fester Bestandteil sowohl des kulturellen Fankapitals der meisten Fußballanhänger als auch des ökonomisch verwertbaren Vereinskapitals vieler Fußballvereine, die ihre proletarische Herkunft marketingstrategisch gezielt zur Identitätsbildung und Stärkung der Fanbindung einsetzen. Und nicht zuletzt prägt sie auch das Selbstverständnis vieler Fangruppen und sogar die Selbstwahrnehmung ganzer Regionen.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2013 Stadtentwicklung anderswo

Erschienen in Heft 6/2023 Kommunale Religionspolitik
Die Frage nach einer Religionspolitik im ländlichen Raum erscheint auf den ersten Blick kontraintuitiv zu sein: Abgesehen davon, dass die lokale Ebene in Deutschland keine formale religionspolitische Zuständigkeit besitzt, dürfte es vor allem in kleineren Kommunen an der nötigen politischen und administrativen Differenzierung für eine dezidierte Religionspolitik fehlen. Was aber noch wichtiger ist: Gerade in ländlich geprägten Gemeinden gilt die Religion, verstanden insbesondere als zivilgesellschaftliche Präsenz der verfassten Kirchen, in der Regel als Teil der Lösung und nicht als Herausforderung für den sozialen Zusammenhalt, wird also nicht zu einem policy issue eigener Art.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2017 Die Digitalisierung des Städtischen
Zum siebten Mal rief der vhw zu den Baurechtstagen Baden-Württemberg. Zwei Tage lang wurde die klug ausgewählte Gastgeberstadt Ulm auf diese Weise zum Zentrum des Baurechts im „Ländle“. In idealer Tagungsatmosphäre im Kongresszentrum Ulm eröffnete der Geschäftsführer des vhw Baden-Württemberg, Rainer Floren, am 20. September 2017 die im Keplersaal des Maritim-Hotels stattfindenden 7. Baurechtstage. Bereits der erste Vortrag des Tages, für den der Freiburger Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht Prof. Dr. Reinhard Sparwasser verantwortlich zeichnete, verdeutlichte, dass die Entscheidung zu kommen, richtig war. Ebenso humorvoll wie kompetent führte Reinhard Sparwasser durch die Novelle des Baugesetzbuchs 2017 und zeigte auf, dass insbesondere § 13b BauGB neben einigen Antworten auch viele offene Fragen bereithält.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2010 Stadtentwicklung und demografischer Wandel
Seit Jahren wird der demografische Wandel heiß diskutiert – "wir werden weniger, älter und bunter" lautet die eingängige Kurzformel. Auch in Wohnungswesen und Immobilienwirtschaft kommen kein Vortrag, kein Geschäftsbericht und keine Argumentation ohne den demografischen Wandel aus. Das Phänomen ist so vielschichtig und gleichzeitig über Grafiken und Bilder gut zu präsentieren, dass es schnell als Ursache oder Ausrede für alles Mögliche zur Hand ist. Doch unabhängig davon bleiben Herausforderungen an die Wohnungswirtschaft bestehen – und gehen weiter, als viele glauben. Wer einfache strategische Antworten sucht, wird enttäuscht.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2010 Bürgerorientierung in der integrierten Stadtentwicklung

Erschienen in Heft 5/2008 Klimaschutz im Städtebau
Klimawandel und Klimaschutz sind seit einiger Zeit allgegenwärtige Themen in der öffentlichen Debatte – kaum eine Tageszeitung oder ein Nachrichtenmagazin ohne Bezug zum Thema. Kein Wunder, ist doch dieses Politikfeld derzeit von einer ungewöhnlichen Dynamik geprägt. Die Verhandlungen über ein Nachfolgekommen für das Kyoto-Protokoll und eine internationale Vereinbarung zur Deckelung bzw. Minderung klimaschädlicher Treibhausgasemissionen, werfen ihre Schatten voraus. Die rege gesetzgeberische Tätigkeit von EU und Bundesregierung ist auch vor diesem Hintergrund zu sehen, setzen sich doch beide Akteure auch auf internationaler Ebene für einen wirksameren Klimaschutz ein. Der Beitrag gibt einen Überblick über den aktuellen Stand und die Entwicklungsperspektiven der Klimaschutzpolitik auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene. Er geht auch darauf ein, wie Kommunen in diesem Politikfeld aktiv werden können – und warum sie das tun sollten.
Beiträge