
Erschienen in Heft 5/2010 Stadtentwicklung und demografischer Wandel
Seit Jahren wird der demografische Wandel heiß diskutiert – "wir werden weniger, älter und bunter" lautet die eingängige Kurzformel. Auch in Wohnungswesen und Immobilienwirtschaft kommen kein Vortrag, kein Geschäftsbericht und keine Argumentation ohne den demografischen Wandel aus. Das Phänomen ist so vielschichtig und gleichzeitig über Grafiken und Bilder gut zu präsentieren, dass es schnell als Ursache oder Ausrede für alles Mögliche zur Hand ist. Doch unabhängig davon bleiben Herausforderungen an die Wohnungswirtschaft bestehen – und gehen weiter, als viele glauben. Wer einfache strategische Antworten sucht, wird enttäuscht.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2009 vhw-Verbandstag 2009 / Leitbilder für die Innenstädte
Unternehmensengagement ist nach Auffassung des vhw notwendiger Bestandteil einer gelingenden Bürgergesellschaft. Alle müssen lernen zur Lösung der Probleme und fürs Gemeinwohl aufeinander zuzugehen und Wege zu finden – um dies zwischen Wohnungswirtschaft, Stadt, Bürgern und der Öffentlichkeit zu erleichtern, betreibt der vhw eine Art Kampagne: Ein Beirat wurde gebildet, eine Interviewstudie in Auftrag gegeben, Indikatoren entwickelt und eine Tagungsreihe ins Leben gerufen ("urbane Landschaften", beginnend am 24. November 2009) für diejenigen, die ihre Mitarbeiter fit machen wollen für eine strategische Ausrichtung des betrieblichen Engagements. Der nachfolgende Artikel beschreibt den Versuch drei Dimensionen auszumachen, in denen sich diese Strategie bewegen muss, um mehr zu sein als nur Sponsoring.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2008 Migranten-Milieus in Deutschland
Segregation und Ghettobildung, diese Begriffe sind beim Thema Stadtentwicklung in aller Munde. Vielfach geht es dabei auch um die Frage der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Wie stellt sich eine Wohnungsbaugenossenschaft in einem Flächenland diesem Problem? Die Wankendorfer Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein eG berichtet über ihre Erfahrungen im nördlichsten Bundesland.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2008 Migranten-Milieus in Deutschland
In den vergangenen Jahren hat sich das Informationsangebot zur Wohnsituation von Migranten in Deutschland und deren Entwicklung insgesamt verbessert. Immerhin hat das Statistische Bundesamt im Zuge der Mikrozensus-Arbeit erstmals auch objektive Rahmendaten zur Wohnsituation von Bewohnern mit Migrationshintergrund vorgelegt - und geht damit über die übliche Unterteilung in "Deutsche" und "Nichtdeutsche" hinaus, wie sie die im vierjährigen Turnus erstellte Mikrozensus-Zusatzerhebung zur Wohnsituation enthält. Zu erwähnen sind in diesem Kontext auch regelmäßige Befragungen einzelner - ethnisch, sozio-demografisch oder wohnräumlich abgegrenzter - Migrantengruppen, wie sie zum Beispiel vom Zentrum für Türkeistudien für das Land NRW durchgeführt werden. Ungeachtet dieser bedingten Fortschritte wird im mit der hier vorgelegten Untersuchung erstmals über eine bundesweit repräsentative Befragung von Migranten nicht nur ein Einblick in die aktuelle objektive Wohnsituation vermittelt, sondern zugleich ein breites Bild über Wohneinstellungen und -wünschen von Bewohnern mit Migrationshintergrund gegeben. In diesem Beitrag werden ausgewählte erste Ergebnisse aus dem umfangreichen Fundus vorgestellt. Im Vordergrund steht dabei eine an den Migranten-Milieus orientierte Betrachtung.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2009 Lernlandschaften in der Stadtentwicklung
Vor einigen Wochen erreichte mich die Anfrage der Redaktion dieses Heftes mit der Bitte, einen Beitrag aus der Sicht des Quartiersmanagements über die anstehenden Forderungen an Wohnungsunternehmen im Rahmen der sogenannten "Verstetigung" des Bund-Länder-EU-Programms "Soziale Stadt" zu schreiben. In einem Gebiet in Berlin-Neukölln, das von der Wohnungsbaugesellschaft STADT UND LAND Wohnbauten mbH dominiert ist, war ich selbst von 2002 bis 2006 Quartiersmanager. Ende 2006 wurde unser erfolgreiches QM-Team nicht weiter beauftragt, unter anderem, weil es sich dem politischen Druck der Auftraggeber nicht beugen und weil es für seinen Träger kein defizitäres Projekt betreiben wollte. Bedeutet diese Anfrage nun, dass sich die Redaktion die Meinung eines Verfassers mit Insider-Kenntnissen gewünscht hat, der aber nicht mehr Bestandteil des Systems ist? Oder bedeutet sie, dass sich kein amtierender Quartiersmanager gefunden hat, um dieses "heiße Eisen" anzufassen?
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2021 Wohnen in Suburbia und darüber hinaus
Wenn über aktuelle Tendenzen der Stadtentwicklung diskutiert wird, geraten die Klein- und Mittelstädte in den suburbanen Räumen häufig in den Windschatten der Metropolen und Großstädte. Auch wenn die Herausforderungen für größere Städte augenscheinlicher sein dürften, so bleiben Klein- und Mittelstädte doch von aktuellen Entwicklungstendenzen nicht gänzlich unberührt. Suburbia hat mehr als nur Ausgleichsfunktion für die in den Großstädten nicht oder nur eingeschränkt zu befriedigenden Bedürfnisse. Ob mit oder ohne die Coronapandemie, kleine und mittlere Städte im Umland wachsender Metropolen stehen vor neuen Herausforderungen.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2021 Wohnen in Suburbia und darüber hinaus
Lange Zeit standen die deutschen Großstädte als Zielgebiete im Mittelpunkt des Binnenwanderungsgeschehens. Das hat dazu geführt, dass die Attraktivitäts- und Ausstattungsunterschiede zwischen Stadt und Land, aber auch zwischen wachsenden und schrumpfenden Regionen größer geworden sind. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt, der im hohen Maß vom Wanderungsverhalten der Nachfrager beeinflusst wird. Veränderungen in der Richtung der Binnenwanderungsströme können daher neue Chancen für die Wohnungswirtschaft, aber auch für den Ausgleich von Stadt und Land bieten.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2012 Nachhaltigkeit und Wohnen
Die energetische Modernisierung von älteren Wohngebäuden ist ein fester und zum Glück auch wenig umstrittener Bestandteil des Drehbuchs für die Energiewende in Deutschland. Die empirischen Fakten zur Bedeutung des Energieverbrauchs in Wohngebäuden sind hinreichend oft dargestellt worden und müssen hier nicht erneut beschrieben werden. Wichtiger sind die umstrittenen Details des Fahrplans, bei denen es um die Geschwindigkeit, die einzusetzenden Förder- und Rechtsinstrumente sowie die angemessene Kostenverteilung geht. Vor der Auseinandersetzung mit den kontroversen Details sind drei Anmerkungen zu den Grundpositionen des Deutschen Mieterbunds (DMB) notwendig.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2017 Die Digitalisierung des Städtischen
Der energetische Umbau von Quartieren und Stadtvierteln ist eine Herausforderung, die alle Akteure miteinbezieht: von den Kommunen über die Energieversorger, die Wohnungswirtschaft bis hin zu den einzelnen Haus- und Wohnungseigentümern. Insbesondere zwei Aspekte spielen eine entscheidende Rolle: 1. Die Gestaltung und Schaffung von lebenswertem und bezahlbarem Wohnraum und die Möglichkeit der Partizipation. Denn Veränderungen funktionieren nur dann, wenn alle relevanten Akteure einbezogen werden, ihren Nutzen erkennen und mitgestalten können. 2. Das Stiften von Identität für Mieter und Bewohner mit der Immobilie, dem Quartier und der Stadt. In diesem Zusammenhang gibt es vor allem ein Innovationsthema für die Stadtentwicklung, welches eine intensive Beteiligung ermöglicht: der Mieterstrom.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2020 Klimaanpassung im Stadtquartier
Wohnungsunternehmen leisten durch die energetische Sanierung von Bestandssiedlungen einen aktiven Beitrag zur Energieeffizienz im Quartier. Als Vermieter und Multiplikatoren können sie ihre Bewohner zu energieeffizienterem Verhalten und zur Reduktion des Endenergieverbrauchs vor allem im Bereich der Heizenergie und des Warmwassers motivieren. Beispiele aus Erfurt und Kassel zeigen verschiedene Vorgehensweisen auf. Resümierend wird reflektiert, welche Rolle Beteiligungs- und Kommunikationskulturen in Quartieren spielen, welchen Beitrag Kooperationen unter anderem mit Energieberatungseinrichtungen spielen und inwiefern mehr Transparenz der haushaltsbezogenen Energieverbräuche zu bewussterem Bewohnerverhalten beitragen kann.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2025 Kommunen zwischen Zukunftsorientierung und Gegenwartsbezug
Im Rahmen der von der Nationalen Stadtentwicklungspolitik geförderten Vernetzungsinitiative „Gemeinsam für das Quartier“ hat der Deutsche Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V. (DV) gemeinsam mit Prof. Reiner Schmidt (Netzwerk Stadt als Campus) ein Empfehlungspapier vorgelegt. Darin wird die kulturelle Quartiersentwicklung aus Perspektive der Wohnungswirtschaft beleuchtet. Aufbauend auf diesen Ergebnissen fand die Tagung „Kulturelle Stadtentwicklung in Wohnquartieren – Beiträge von Wohnungswirtschaft und Stadtmacher:innen“ des vhw und der Vernetzungsinitiative statt. Sie machte die Vielschichtigkeit und Wirksamkeit kultureller Strukturen und Aktivitäten deutlich. Ziel der gemeinsamen Veranstaltung war es, die wohnungswirtschaftliche Sichtweise mit der Perspektive quartiersbezogener, selbstorganisierter Kultur- und Kreativarbeit durch Stadtmachendenakteure zu verbinden und die beiden Ansätze miteinander in Beziehung zu setzen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2008 Klimaschutz im Städtebau
Die Entscheidung, aus einer konzipierten Bauerhaltungsmaßnahme eine umfassende Generalsanierung der gesamten Liegenschaft mit Verbesserung der Wohnungsgrundrisse sowie des baulichen Wärme- und Schallschutzeszu entwickeln stellt sicher, dass alle technischen, ökologischen und wirtschaftlichen Erfordernisse zum Erreichen eines hochwertigen Neubau-Standards gewährleistet sind. Die übergeordneten Ziele minimierter Heizkosten und reduzierter Umweltbelastungen werden erreicht. Die Generalsanierung im unbewohnten Zustand garantiert, dass Insellösungen, welche eine nachhaltige Verbesserung der Wohnqualität einschränken, vermieden werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2008 Klimaschutz im Städtebau
Die meisten Menschen in Deutschland leben heute in modernisierten Wohnungen, in sanierten Altbauquartieren oder Großwohnanlagen der Nachkriegszeit. Schöner und bequemer ist das Leben geworden in unseren Städten und Dörfern seit 1970, mit 43 qm Wohnfläche pro Person (das ist 50 % mehr als 1970) und dem Auto vor der Tür. Unsere hohe Lebensqualität, die großzügige Wohnfläche pro Person, die täglichen Autofahrten zu Arbeit und Freizeit, haben wir mit einer erheblichen Belastung des Klimas "erkauft". 1960 haben wir nur ein Drittel (2.000 Watt oder 17.500 kwh) der Energie pro Person gebraucht wie heute; und langfristig ist dies der anzustrebende Verbrauchswert (er ist der Durchschnittsverbrauchwert der Weltbevölkerung) auf den wir wieder kommen müssen. Das Ziel für den Klimaschutz ist im Kyoto-Protokoll gesetzt: 20 Proezent weniger CO2-Emission bis 2020, von 2005 an gerechnet. Das ist nur mit einer drastischen Reduktion unseres Energieverbrauchs zu erreichen. Dies ist die Vorrausetzung dafür, dass höhere Lebensqualität auch für die 4/5 der Menschheit erreicht werden kann, für die sie heute, auch wegen der Klimakatastrophen, nicht gegeben ist.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2024 Transformation des Wohnens
Immobilienfirmen und Projektentwickler sollten spätestens in der derzeitigen Situation ihre Firma resilienter machen. Inwiefern sie Krisenmanagementtools dabei unterstützen und wie diese erarbeitet werden können, darum geht es in dem vorliegenden Beitrag.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2024 Transformation des Wohnens
Wenn die Kinder ausziehen, bleiben leere Kinderzimmer, manchmal leere Einliegerwohnungen. Diese Räume nutzbar zu machen, würde den Neubau erheblich entlasten. Das Potenzial beziffert Daniel Fuhrhop auf 100.000 Wohnungen jährlich – ein Drittel des Neubauvolumens. Das brächte einen Gewinn für Eigentümer, für Wohnungssuchende und für die Umwelt: der Wohnungsneubau eines Jahres belastet das Klima mit bis zu 74 Millionen Tonnen CO2.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2025 Kommunales Gebäudemanagement

Erschienen in Heft 4/2025 Kommunales Gebäudemanagement
Angesichts der angespannten Wohnungsmärkte in vielen deutschen Städten und Regionen steht die Wohnungsbaupolitik bereits seit mehreren Jahren vor großen Herausforderungen. Steigende Bau- und Bodenkosten, der Fachkräftemangel und lang andauernde Genehmigungsverfahren erschweren die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Vor diesem Hintergrund rückt das serielle, modulare und systemische Bauen (SMSB) zunehmend in den Fokus. Diese Bauweisen versprechen durch industrielle Vorfertigung, hochstandardisierte Prozesse und den durchgängigen Einsatz digitaler Planungsmethoden nicht nur eine Beschleunigung für das Bauen, sondern auch eine gleichbleibende Qualität und höhere Kostensicherheit.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2013 Soziale Stadt und Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklung
Partizipation in benachteiligten Quartieren war von Anfang an ein fester Bestandteil des Programms Soziale Stadt und hat sich seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Insbesondere bei einem wachsenden Armutsrisiko besteht für Quartiere mit einem hohen Anteil an einkommensschwachen Haushalten die Gefahr, dass sie weiter sozial segregieren. Die massiven Kürzungen im Programm Soziale Stadt, die das BMVBS in den letzten Jahren vorgenommen hat, verstärken dieses Risiko. Durch Partizipation können Bewohner jedoch an der Verbesserung ihres Lebensumfeldes mitwirken. Der Beitrag zeigt die Bedeutung von Partizipation auf und benennt Herausforderungen für die soziale Stadt(teil)entwicklung. Dabei wird insbesondere auch auf das veränderte Selbstverständnis der (kommunalen) Wohnungswirtschaft eingegangen.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2012 Stadtentwicklung und Sport

Erschienen in Heft 6/2012 Stadtentwicklung und Sport
Spätestens seit der pauschalen Brandmarkung neuer Investoren (nicht nur) im Wohnungsmarkt als "Heuschrecken" durch den ehemaligen SPD-Vorsitzenden Müntefering wurde die Privatisierung von öffentlichen Wohnungsgesellschaften und deren Wohnungsbeständen ein brisantes Thema in Deutschland. Nach einer zunächst eher plakativen politischen Debatte liegen inzwischen erste Forschungsergebnisse zu den Auswirkungen und Konsequenzen dieser Käufe vor. Zu den relevanten Aspekten der Fachdebatte gehört u.a. die Frage nach den Strategien der neuen Investoren und den stadtentwicklungsbezogenen Auswirkungen der Verkäufe von kommunalen Wohnungsunternehmen. Dieser Fragestellung wird in diesem Beitrag nachgegangen.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2005 Bürgerorientierte Kommunikation / Teilhabe an Stadtentwicklung und Wohnungspolitik

Erschienen in Heft 4/2005 Stadtregional denken – nachfrageorientiert planen
Die Anbieter von Beratungsleistungen haben auf den steigenden Informationsbedarf der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft mit einer breiten Palette von Analysen, quantitativen Prognosen und individuellem Consulting unlängst reagiert. Die verwendeten Methoden sind vielfältig, die Rechenmodelle mitunter komplex und der Fundus von marktrelevanten Daten ist nur schwer zu überschauen. Für die Unternehmen stellt sich die Frage: Welche Informationen können als verlässliche und belastbare Basis für anstehende Entscheidungen dienen? So unterschiedlich die verschiedenen Modelle, Methoden und Datenquellen auch sind, ein doppeltes Defizit ist den meisten von ihnen gemeinsam: Die qualitative Nachfrage – also die Frage, warum wer wo wohnt – wird nur rudimentär behandelt. Gleichzeitig bleibt der entscheidende, nämlich der kleinräumliche Marktzusammenhang wegen der fehlenden Feinkörnigkeit der Daten unberücksichtigt. Die vermeintliche Eindeutigkeit soziodemographischer Zielgruppen-Konstrukte, wie z.B. "junge Familien mittleren Einkommens", verdeckt oft das Wesentliche: Hinter den Kunden und ihren räumlichen und qualitativen Wohnentscheidungen steht weitaus mehr als Lebensphase, Haushaltsstruktur und Einkommen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2005 Stadtregional denken – nachfrageorientiert planen
Die Anwendungsbereiche des vhw-Projektes "Nachfrageorientierte Wohnungspolitik" für die Stadtentwicklung der Landeshauptstadt Hannover sind vielfältig. Dies hat sich im Laufe der Zusammenarbeit im Arbeitskreis der Modellstädte immer wieder gezeigt. Der Beitrag skizziert die bisherigen Erfahrungen der Modellstadt Hannover mit dem vhw-Ansatz.
Beiträge
Erschienen in
Die Nutzung feinkörniger Mikrodaten, durch die bis auf die Ebene einzelner Wohngebäude und Straßenzüge Informationen zur Milieuzugehörigkeit oder zur Kaufkraft der Haushalte bereitgestellt werden, eröffnet völlig neue Perspektiven für anwendungsorientierte Analysen der Wohnungsnachfrage. Durch ihre Verknüpfung mit kleinräumlichen Kommunaldaten sowie unternehmerischen Bestandsdaten können das Wohnungsmarktgeschehen zusammenhängend abgebildet und markt- bzw. bedarfsgerechte Handlungsoptionen für die beteiligten Akteure abgeleitet werden. Dieser substantielle Informationsmehrwert für Stadtentwicklung, Wohnungswirtschaft und die Wohnkonsumenten wurde auf dem Leipziger Verbandstag vorgestellt. Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse eines Anwendungsbeispiels wiedergegeben.
Beiträge
Erschienen in
Welche Schwerpunkte setzen Investoren bei Wohnungsinvestments in Zeiten schrumpfender Märkte? Wie berücksichtigen Wohnungsunternehmen die zunehmend relevanter werdenden Wohnwünsche der Bürger und wie sieht ihr Beitrag für eine aktive Stadtentwicklungspolitik in Kooperation mit den Kommunen aus? Am Beispiel von Privatisierungs- und Neubauprojekten der Deutsche Annington Immobilien GmbH geht der Beitrag diesen Fragen nach. Dieser Beitrag basiert auf dem gleichnamigen Vortrag von Herrn Dr. Riebel anlässlich des vhw-Verbandstags am 23. September 2004 in Leipzig.
Beiträge
Erschienen in
Dr. Dominique C. Freise und Dr. Rudi Ulbrich haben im letzten Forum Wohneigentum unter der Überschrift "Leerstände im Osten sind deutlich niedriger als bisher angenommen" einen methodenkritischen Beitrag zur Reliabilität der statistischen Berechnungsmethoden des strukturellen Wohnungsleerstands in den neuen Ländern veröffentlicht. Sie versuchen nachzuweisen, dass Mängel des Mikrozensus, vor allem aber unterschiedliche Hochrechnungsfaktoren, zu – ihrer Meinung nach – überhöhten Leerstandszahlen führen. Die Wissenschaftler des Instituts Wohnen und Umwelt (IWU) gehen von weniger als 800.000 leer stehenden Wohnungen in Ostdeutschland aus. In diesem Zusammenhang stellen sie die Berechtigung des Stadtumbau-Programms Ost in Frage. Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen, der u. a. rund 1.300 kommunale und genossenschaftliche Wohnungsunternehmen in Ostdeutschland repräsentiert, weist auf seine - im Rahmen einer jährlichen Vollerhebung ermittelten - äußerst validen Leerstandszahlen hin und begründet, dass der Stadtumbau Ost ohne staatliche Förderung von den ostdeutschen Wohnungsunternehmen allein nicht zu leisten ist. Die Kritik der beiden Autoren wird als nicht stichhaltig bezeichnet, weil sie sich letztlich auch gegen ihre eigenen methodischen Ansätze richtet. Ihre politischen Schlussfolgerungen werden als unangemessen zurückgewiesen.
Beiträge
Erschienen in
Auch die Stadtentwicklungsplanung der deutschen Hauptstadt hat sich mit veränderten Rahmenbedingungen auseinander zu setzen. Die maßgeblichen Faktoren sind: Stagnierende Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung bei einem Überangebot an Flächen und Gebäuden (Wohnen, Gewerbe, Infrastruktur); Finanzknappheit der öffentlichen Hand mit der Folge geringerer direkter Eingriffsmöglichkeiten; Notwendigkeit eines Mentalitätswechsels bei den Akteuren; Schließlich die notwendige Änderung von Prioritäten bei Stadtplanung und -management. Im Beitrag werden Grundlagen zur Bevölkerungsentwicklung, zur Sozialen Stadtentwicklung und zur Flächenentwicklung sowie die Folgerungen, die sich daraus für die Berliner Stadtentwicklungspolitik ableiten, dargestellt.
Beiträge
Erschienen in
Einzelne Wohnungsverkäufe sorgen immer mal wieder für negative Schlagzeilen. Verunsicherte Mieter gehen an die Öffentlichkeit, um ihrer Angst vor Verdrängung aus der Wohnung, dem Verlust gewachsener Nachbarschaften und Mietpreissteigerungen Ausdruck zu verleihen. Die politischen Vertreter vor Ort werden um Beratung und weitergehende Unterstützung gebeten. Über positive Erfahrungen mit Verkaufsfällen hingegen wird – mit eher geringem Öffentlichkeitseffekt - überwiegend in Fachkreisen diskutiert. Schnell entsteht deshalb der Eindruck, Konflikte zwischen Mietern und Wohnungsunternehmen seien unvermeidbar und symptomatisch für Wohnungsverkäufe insgesamt. Der Artikel liefert einen Überblick zur Wohneigentumsentwicklung in NRW, diskutiert die vorherrschenden Verkaufsverfahren und stellt ein modellhaftes qualitätsorientiertes Verfahren vor, das Kompromisse im Spannungsfeld der Privatisierungsakteure "Unternehmen, Mieter, Kommune" ermöglicht.
Beiträge
Erschienen in
Durch ökonomische, gesellschaftliche und demographische Umbrüche werden Wohnungsunternehmen vor immer neue Herausforderungen gestellt. Die Wünsche der Kunden bezogen auf die Wohnung, das nähere Wohnumfeld und die gesamte Quartiers- bzw. Stadtteilsituation bekommen immer stärkeres Gewicht, da entspannte Wohnungsmärkte breiten Bevölkerungsschichten neue Möglichkeiten bei der Stadtteil- und Wohnungswahl erlauben. Wohnungsunternehmen können über ein Engagement im eigenen Bestand hinaus einen elementaren Beitrag zur Gestaltung des Stadtteillebens leisten. In der integrierten Stadt(teil)erneuerung sind sie schon lange wichtige Akteure. Um den Dialog über wohnungswirtschaftliche und städtebauliche Ansätze zu forcieren und ihre Zusammenführung zu unterstützen, wurde vom Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein-Westfalen (ILS NRW) in Zusammenarbeit mit der Landesentwicklungsgesellschaft Arbeitsmarkt und Strukturentwicklung (LEG-AS) die Fachgesprächsreihe "Wohnungsunternehmen als Akteure in der integrierten Stadt(teil)entwicklung" initiiert.
Beiträge
Erschienen in
Die Bevölkerungsverluste in den ostdeutschen Städten werden nicht nur eine vorübergehende Erscheinung sein, sondern in den meisten Städten einen lang anhaltenden Trend der Einwohnerentwicklung kennzeichnen. Manche Kommunen gehen mit den Auswirkungen der Bevölkerungsschrumpfung ganz offen und aktiv um, andere wiederum tun sich noch schwer, eigene Strategien zur Problembewältigung zu finden und hoffen nun auf ein Wunder durch mögliche Zuwanderungsgewinne durch die EU-Osterweiterung. Im Folgenden werden anhand der Städte Dresden und Bautzen die zu erwartenden Wohnungsmarktentwicklungen in den sächsischen Kommunen vorgestellt und anschließend vor dem Hintergrund einer möglichen höheren Zuwanderung von Bürgern aus den EU-Beitrittsländern kritisch diskutiert.
Beiträge
Erschienen in
Das Programm "Stadtumbau Ost" verfolgt das Ziel, die Attraktivität ostdeutscher Kommunen als urbanen Lebens- und Wohnraum und als Wirtschaftsstandort zu stärken. Dabei kommt der Aufwertung der urbanen Wohnungsquartiere, der Modernisierung städtischer Altbaugebiete und den Problemen des Leerstandes und dem damit einhergehenden Rückbau besondere Relevanz zu. Die Stadt Görlitz, die einst für 180.000 Bürger geplant wurde und heute nur noch über ca. 59.000 Einwohner verfügt, steht stadtpolitisch vor dem Dilemma einer sehr heterogenen Leerstandsentwicklung einerseits – insbesondere in der Innenstadt, die im Vergleich zur größten Plattenbausiedlung Königshufen das doppelte Leerstandsvolumen aufweist – und der Notwendigkeit, die einzigartige denkmalgeschützte Altstadt und die gründerzeitliche Bebauung der Innenstadt zu erhalten, andererseits.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2007 Migration – Integration – Bürgergesellschaft
Mit dem Ziel, einen lebensstildifferenzierten Einblick in die Situation von Migranten in Deutschland zu erhalten, hat sich der vhw an der Studie Migranten-Milieus des Heidelberger Politik- und Marktforschungsinstituts Sinus Sociovision beteiligt. Dies setzt die bisherige Arbeit des vhw mit dem Milieuansatz fort und knüpft an die Ergebnisse des Projekts "Nachfrageorientierte Wohnungspolitik" an. Die Studie Migranten-Milieus verfolgt das Ziel, zunächst grundsätzliche Einblicke in die Lebenswelt der Migranten in Deutschland zu bieten. Darüber hinaus stehen die wohnungsmarktspezifischen Präferenzen von Migranten im Fokus. Im Ergebnis kommt die Studie zu dem wichtigen Befund, dass Herkunfts- und Aufnahmekultur von Migranten in einem dialektischen Verhältnis stehen. Es ist nicht die ethnische Herkunft allein, die ihre Milieuzugehörigkeit bestimmt. Das gilt insbesondere für diejenigen, die bereits in zweiter und dritter Generation in Deutschland leben. Beschrieben werden insgesamt acht Milieus, die einen strukturierten Einblick in Wertebilder, Lebensstile, Alltagsästhetiken, Integrationsniveaus und Wohnpräferenzen von Migranten in Deutschland bieten.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2007 Den demografischen Wandel gestalten!
Gender Mainstreaming in der Stadtplanung setzt auf gleichberechtigte Teilhabe Aller bei der (Weiter-)Ent-wicklung menschlicher Siedlungen. Es bindet die Anforderungen an die Stadt zusammen. Seine Prinzipien können genutzt werden, den Anforderungen des demografischen Wandels gerecht zu werden. Z. B. ist "Die Stadt der kurzen Wege" – einer der zentralen Gedanken feministischer Planungskonzepte – Stadt für Alle und entspricht in besonderem Maße dem demografischen Wandel. Weitere Elemente, die immer wieder mit den Begriffen "frauengerechter" oder "geschlechtergerechter Planung" in den Fokus rücken, sind Fragen der Aufenthalts- und Nutzungsqualitäten, der Barrierefreiheit und der Sicherheit: auch sie Grundlage für eine städtebauliche Entwicklung, die dem demografischenWandel Rechnung tragen kann. Nutzbar sind die Kriterien aus dem Blickwinkel der Geschlechtergerechtigkeit für Stadt, Stadtteil, Quartier, Wohnumfeld und die Wohnung selbst.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2007 Den demografischen Wandel gestalten!
Das Thema ist eigentlich in der wohnungswirtschaftlichen Fachdiskussion multiperspektivisch so ausgeleuchtet worden, dass neue Erkenntnisse kaum zu vermelden sind. Wenn jedoch die Essener Westdeutsche Allgemeine Zeitung im März 2007 titelte, "Revier wird Modellfall für Ältere – Städte beteiligen sich an internationalem Projekt altenfreundliche Stadt", dann ist die Relevanz einer der häufig diskutierten Aspekte durchaus zu erkennen. An dieser Stelle kann und soll daher in erster Linie versucht werden, das Beziehungsgeflecht zwischen demografischem Wandel und dem Handeln von Wohnungsunternehmen pointiert aus der Sicht eines Wohnungsunternehmens zu entwirren. Welche konkreten Erkenntnisse des demografischen Wandels sind für bestandshaltende Wohnungsunternehmen, so muss die Frage lauten, für dessen langfristig wirkende Investitionsentscheidungen relevant?
Beiträge
Erschienen in
Die PPP-Task Force beim Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) hat ihre Arbeit aufgenommen. Seit 1. Juli dieses Jahres gibt es beim Bund einen organisierten Beistand für interessierte PPP-Projektträger. Fünf haupt- und zwei nebenamtliche Kräfte werden ab sofort Bauplanern, Kämmerern und weiteren Projektbeteiligten der öffentlichen Hand bei der Gestaltung von Partnerschaften mit privaten Investoren zur Seite stehen. Sie bieten den Kommunen und öffentlichen Einrichtungen Unterstützung an, die bei der Durchführung von öffentlichen Investitionsvorhaben auf privates Kapital und Know-how zurückgreifen möchten.
Beiträge
Erschienen in
Mit dem Ende des quantitativen Wohnungsmangels hat sich auch die kommunale Wohnungspolitik verändert. Die neue Rolle im Spannungsfeld von Stadtentwicklung, Stadtumbau und Wohnraumversorgung ist jedoch noch unscharf. So wurde die mit dem Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)eingeführte Idee der kommunalen Wohnraumversorgungskonzepte in der Praxis bislang wenig aufgegriffen. Jedoch ist absehbar, dass kommunale Handlungskonzepte zum Wohnen - sicher mit unterschiedlichen Schwerpunkten in West und Ost - immer wichtiger werden. Aufbauend u. a. auf Erfahrungen aus dem Städtenetzwerk IK KomWoB 1 möchte der Beitrag Ursachen für die geringe Verbreitung solcher Konzepte benennen, Anforderungen darstellen und Möglichkeiten zu deren Förderung skizzieren.
Beiträge
Erschienen in
"Wohnungen zum Kauf - besonders für Ausländer geeignet" - solche Angebote sind seit einiger Zeit in Annoncen der Wohnungswirtschaft zu lesen. Es ist zu begrüßen, wenn diese ihre Altbestände in den Städten verstärkt den Migranten anbietet. Angesichts der Schrumpfungsgefahr könnte sie damit einen Beitrag zur Stabilisierung der Innenstädte leisten. Allerdings sollten Wohnung und Wohnumfeld dem speziellen Bedarf angepasst werden. Dafür ist vor allem eine Verbesserung der interkulturellen Kompetenz der Wohnungswirtschaft vonnöten und eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Bedarfen der "neuen" Klientel. Eine qualitative Aufwertung von Wohnraum und Wohnumfeld wird unumgänglich sein, vor allem wenn es um Eigentum geht. Dann sind Beteiligung und ein interkulturell geschultes Management gefragt.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2018 Gesundheit in der Stadt
Ein Dach über dem Kopf zu haben, ist ein Grundbedürfnis. In der Schweiz wird dem insofern Sorge getragen, als es ein zentraler Aspekt des Grundrechts auf Existenzsicherung (Art. 12 BV) ist und die Sozialziele (Art. 41 ff. BV) die Kantone und Gemeinden dazu verpflichten, Wohnungssuchende in ihrer Suche zu unterstützen. Alle Haushalte sollen eine angemessene Wohnung zu tragbaren Bedingungen finden können – so der Leitgedanke. Inwiefern dieses Ziel erreicht wird, war die Eingangsfrage, die wir uns im Rahmen der Studie „Wohnversorgung in der Schweiz“ gestellt haben. Dieser Beitrag stellt das Analysemodell dieser Studie vor, diskutiert die Ergebnisse der Untersuchung und stellt den Zusammenhang zu gesundheitlichen Fragestellungen her.
Beiträge
Erschienen in
Die PPP-Task Force beim Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) hat ihre Arbeit aufgenommen. Seit 1. Juli dieses Jahres gibt es beim Bund einen organisierten Beistand für interessierte PPP-Projektträger. Fünf haupt- und zwei nebenamtliche Kräfte werden ab sofort Bauplanern, Kämmerern und weiteren Projektbeteiligten der öffentlichen Hand bei der Gestaltung von Partnerschaften mit privaten Investoren zur Seite stehen. Sie bieten den Kommunen und öffentlichen Einrichtungen Unterstützung an, die bei der Durchführung von öffentlichen Investitionsvorhaben auf privates Kapital und Know-how zurückgreifen möchten.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2011 Soziale Kohäsion in den Städten
Der Begriff "social cohesion" steht gegenwärtig nicht nur auf den politischen Agenden der unterschiedlichen administrativen Ebenen hoch im Kurs, sondern er bildet auch in der sozialwissenschaftlichen Debatte einen aktuellen Fokus des Denkens. Unter den Begriffen "Sozialer Zusammenhalt" resp. "Gesellschaftliche Integration" wird nach einem weiten Verständnis zwar sehr Ähnliches verstanden, doch zeigen sich im Detail nicht nur zwischen politisch-administrativer Praxis und sozialwissenschaftlicher Reflexion bedeutsame Unterschiede, sondern auch innerhalb der jeweiligen "Welten".
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2008 Segregation und sozialer Raum
Migranten stellen für den Wohnungsmarkt eine immer bedeutsamer werdende Zielgruppe dar. Differenzierte Erkenntnisse über ihre Orientierungen bei der Wahl des Wohnstandorts sowie deren Sichtweisen auf ethnisch segregiertes Wohnen liegen bisher jedoch kaum vor. Angesichts der inzwischen 15,1 Mio. Personen mit Migrationshintergrund im Jahr 2006 und der fortschreitenden Internationalisierung der Gesellschaft im Zuge des demografischen Wandels gilt es, ein tieferes Verständnis von ihren Wohnorientierungen zu erlangen. Dies möchte der vorliegende Beitrag leisten.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2010 Integration und Stadtentwicklung
Mit "Pro Wohnen – internationales Wohnen" ist ein Projektvorhaben zur Verbesserung der Wohn- und Versorgungssituation insbesondere für ältere Migranten in "ihrem" vertrauten Wohnquartier realisiert worden. Vor Jahren kamen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte aus der Türkei, aus Italien, Griechenland und Osteuropa nach Deutschland, sie arbeiteten hier und leben nun in der dritten, vierten Generation hier. In der Vergangenheit boten ihnen traditionelle Familienstrukturen für das Leben im Alter ausreichend Unterstützung. Aber die Familienstrukturen der zweiten und dritten Generation verändern und vervielfältigen sich; die Anzahl der Großfamilien unter einem Dach wird geringer.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2007 Bürgergesellschaft und Nationale Stadtentwicklungspolitik
Der Anspruch ist hoch, den die Mitgliedsländer der Europäischen Union in der "Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt" formuliert und im Mai 2007 auf dem Ministertreffen in Leipzig beschlossen haben. Nämlich, Stadtentwicklungspolitik als integrierten Ansatz unter Mitwirkung aller Ressorts zu gestalten. Auch im gesellschaftlichen Bewusstsein Deutschlands sollte es Konsens werden, dass Stadtentwicklungspolitik aktive Investitionspolitik ist und kein Subventionstatbestand. Die aus europäischer Sicht überholte sektorale Aufsplitterung und Trennung von zusammengehörenden Aufgaben (investive vs. nichtinvestive Maßnahmen, Wirtschaftsförderung vs. Städtebauförderung vs. Förderungen im sozialen Bereich etc.) muss überwunden werden. Es verwundert, dass die Städtebauförderung immer noch im Subventionsbericht der Bundesregierung auftaucht - wo es doch längst Allgemeingut ist, dass die öffentlichen Fördermittel ein Vielfaches an privatem Kapital in Stadterneuerungsgebieten generieren. Zu dem integrativen Verständnis von Stadtentwicklungspolitik als aktiver Wirtschafts- und Sozialpolitik gehört eine neue Qualität des Zusammenwirkens von Kommunen und Wirtschaft. Der Impuls für eine nachhaltige Entwicklung der deutschen Städte kann nicht allein von der öffentlichen Hand ausgehen. Das wird von den Vertretern der Wirtschaft immer klarer erkannt und politisch artikuliert.
Beiträge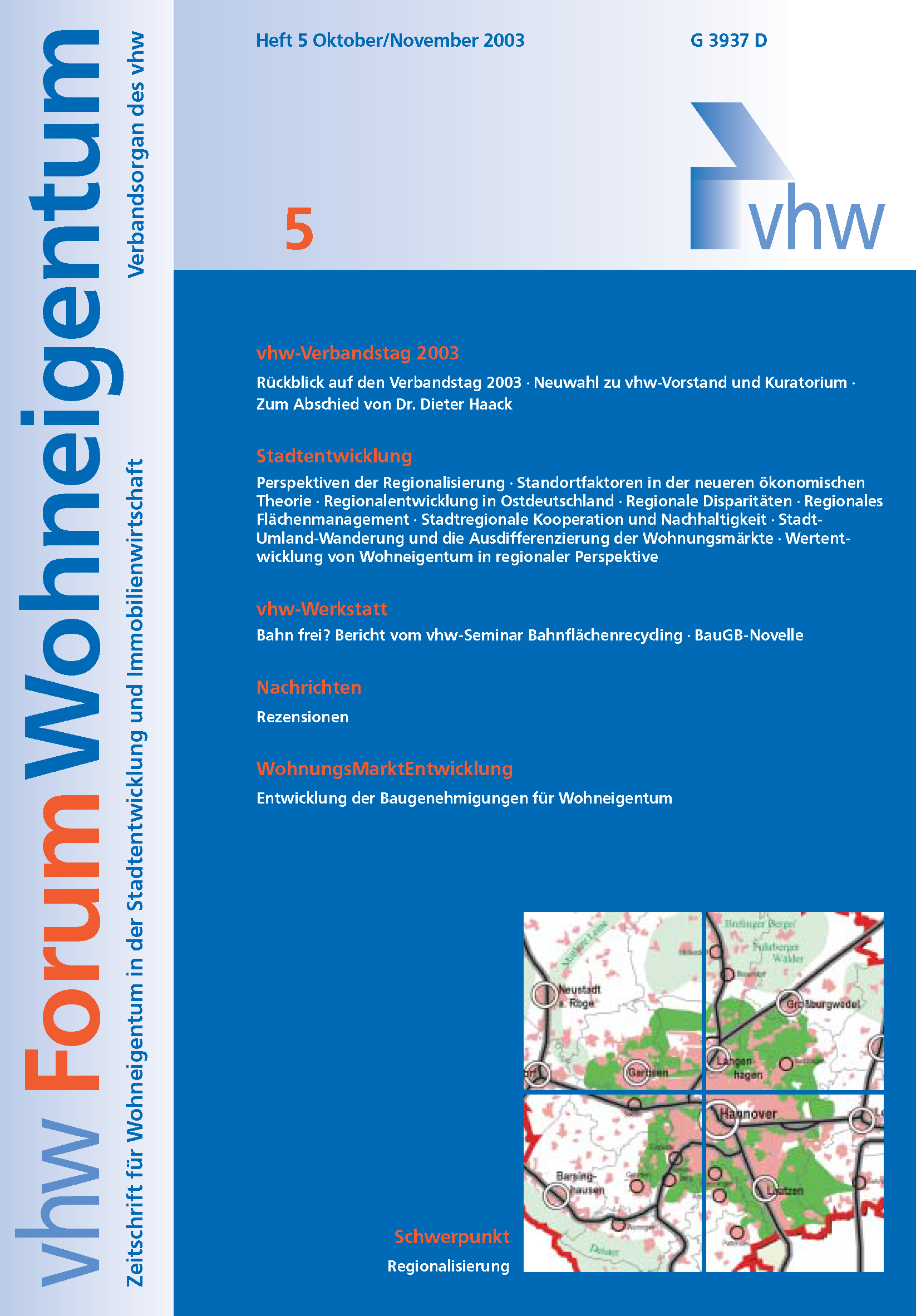
Erschienen in
Mit dem Ende des Wohnungsbaubooms der frühen 1990er Jahre sind die Wohnungsmärkte nicht nur in einen konjunkturellen Abschwung sondern auch in eine neue strukturelle Phase getreten. Unter den Bedingungen des demographischen Wandels bildet sich vielerorts ein Nachfragermarkt heraus. In diesem Markt wird die durch Wirtschaftsentwicklung und Suburbanisierung angestoßene räumliche Dynamik zu einer wichtigen Triebkraft der Entwicklung der Wohnungsmärkte und zum Motor der Neubautätigkeit werden.
Beiträge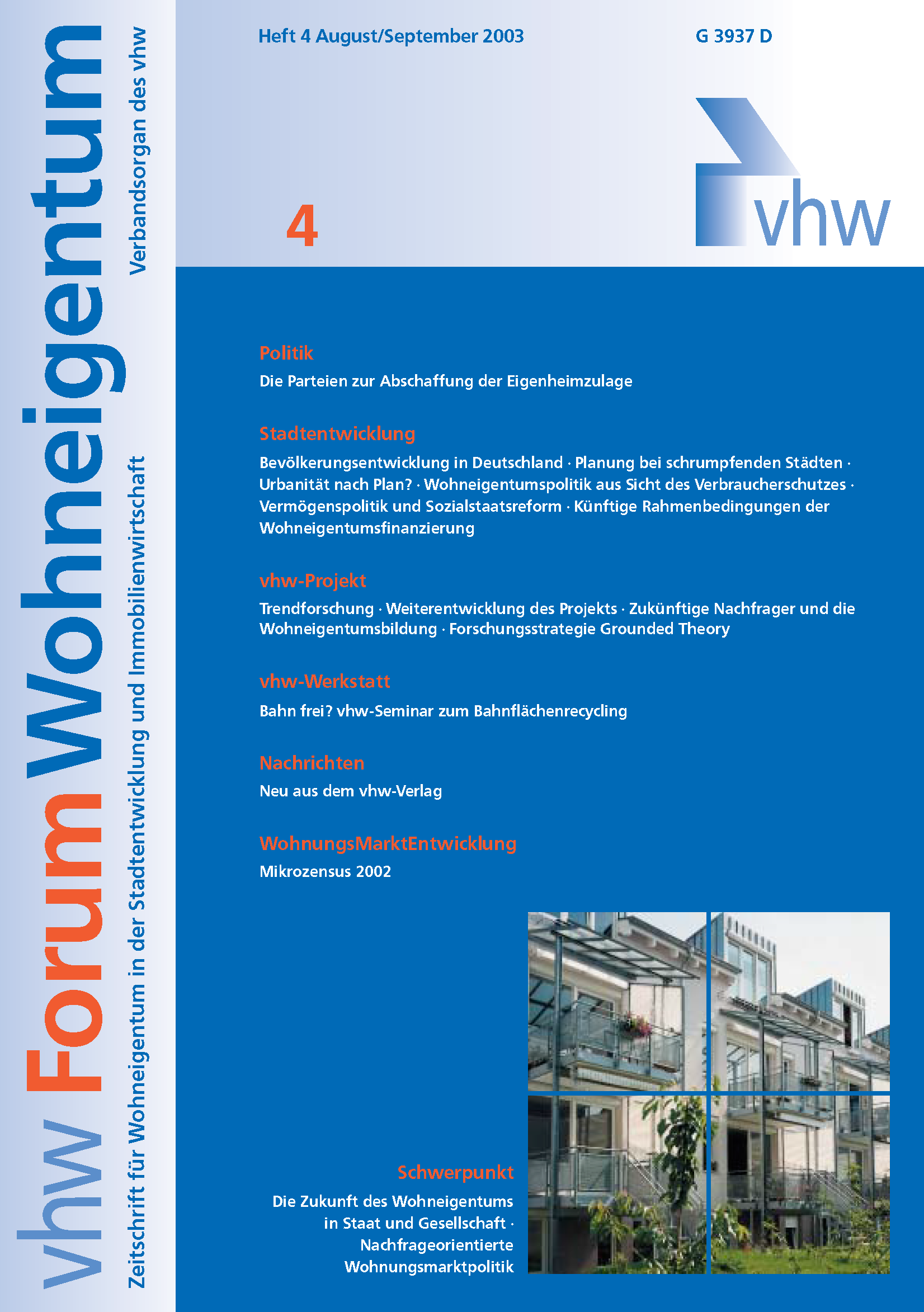
Erschienen in
Deutschlands Bevölkerung altert. Und sie wird im 21. Jahrhundert wahrscheinlich auch schrumpfen. In Teilen Deutschlands hat dieser Rückgang der Einwohnerzahl schon begonnen. Andere Regionen wachsen noch. Dies bewirkt einen regional sehr ungleichen Bedarf an zusätzlichem Wohnraum. Insgesamt ist in den kommenden Jahren mit weniger Nachfrage nach Eigenheimen und Wohnungen für Jungfamilien und mit einer steigenden Nachfrage im Segment des alten- und pflegegerechten Wohnraums zu rechnen. Zugleich wird sich das Interesse an Haus- und Wohnungseigentum als Anlageform vergrößern.
Beiträge
Erschienen in
Niemals in den letzten hundert Jahren wurde qualitativ so schlecht gebaut wie in der Zeit von 1950 bis Mitte der 60er. Die Wohnbebauung aus dieser Zeit weist eine minderwertige Bausubstanz und – aus heutiger Sicht – gravierende städtebauliche Mängel auf. Die Vermietung gestaltet sich zunehmend schwierig, Segregationsprozesse, hohe Fluktuationen und Unternutzung sind die Folge. Gefragt sind neue Strategien.
Beiträge
In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen für viele Wohnungsunternehmen verändert. Die regionale Nachfrage hat sich in qualitativer und quantitativer Hinsicht deutlich ausdifferenziert. Die meisten Märkte haben sich von einem Anbieter- in einen Nachfragermarkt gewandelt. Diese Nachfragesituation wird begleitet von merklich zurückhaltendem Engagement der Kapitalseite. Zudem sind mit oder ohne Gesellschafterwechsel auch die Gesellschafter der ohnungsunternehmen anspruchsvoller und vorsichtiger geworden. Die betriebswirtschaftlichen Herausforderungen an die Unternehmen sind gestiegen. Mittels Portfoliomanagement reagieren viele Wohnungsunternehmen auf die veränderte Situation.
Beiträge
Erschienen in
Demographische Mühlen mahlen langsam. Der demographische Wandel, von dem allenthalben die Rede ist, der hier und da mehr oder weniger sichtbar ist, er hat Ursachen, die teils weit in der Vergangenheit liegen. Die Abnahme der Bevölkerungszahl, die Alterung der Bevölkerung, die Internationalisierung durch hohe internationale Zuwanderung sind Prozesse, die zwar neu ins Bewusstsein der Öffentlichkeit getreten sind, die jedoch – vielfach als schleichender Prozess – bereits vor Jahrzehnten begannen.
Beiträge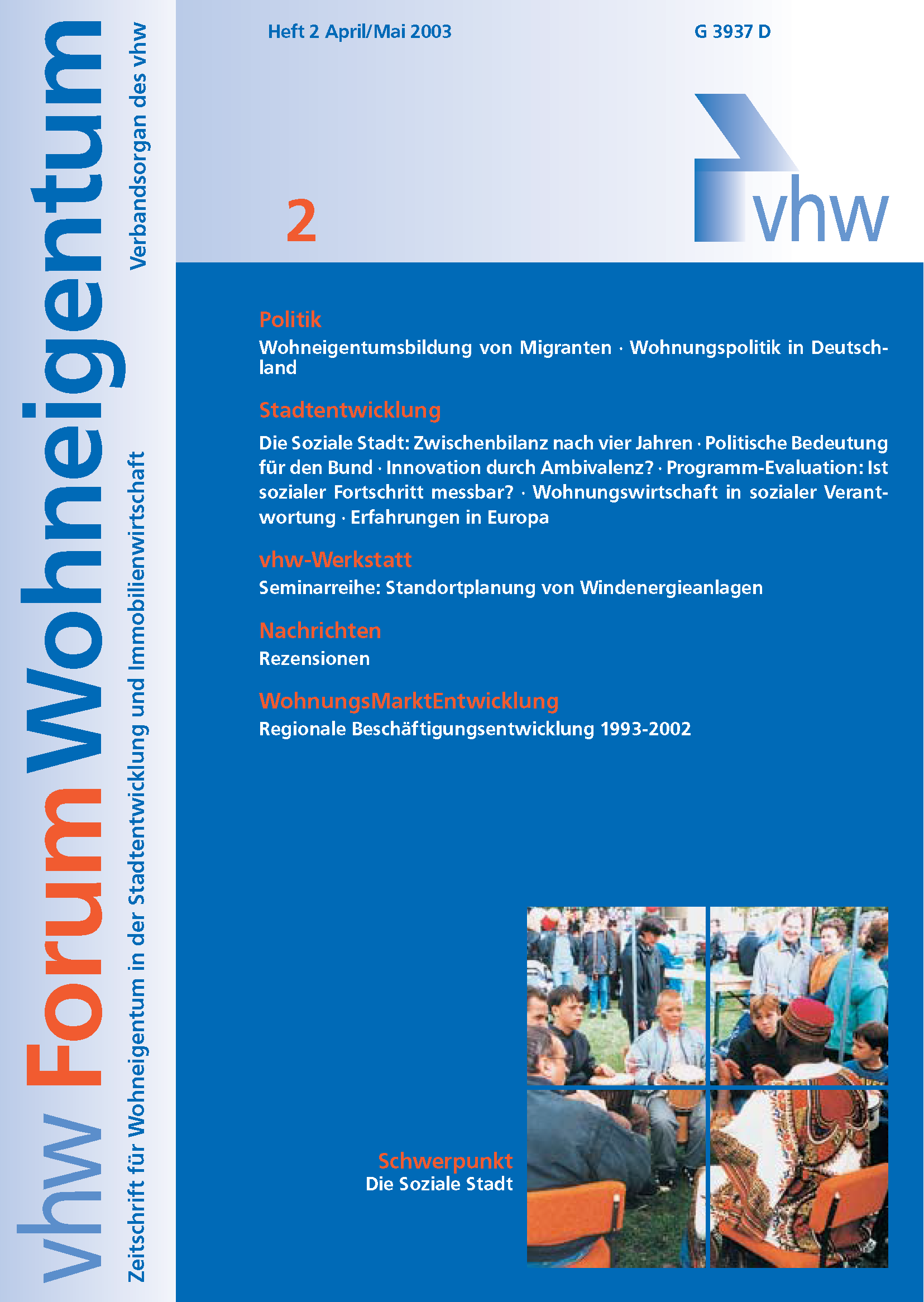
Erschienen in
Wohnungsunternehmen müssen sich ihrer sozialen Verantwortung stellen – auch aus wirtschaftlichem Eigeninteresse. Die sozial nachhaltige Bewirtschaftung von Wohneinheiten verbessert die Marktchancen eines Wohnungsunternehmens. Die Glückauf Wohnungsbaugesellschaft in Lünen behauptet sich seit über zehn Jahren mit ihrem übergreifenden, bewohnerorientierten Wohnraum-Konzept in einem schwierigen Marktumfeld – und wurde Preisträger im Wettbewerb "Soziale Stadt 2000".
Beiträge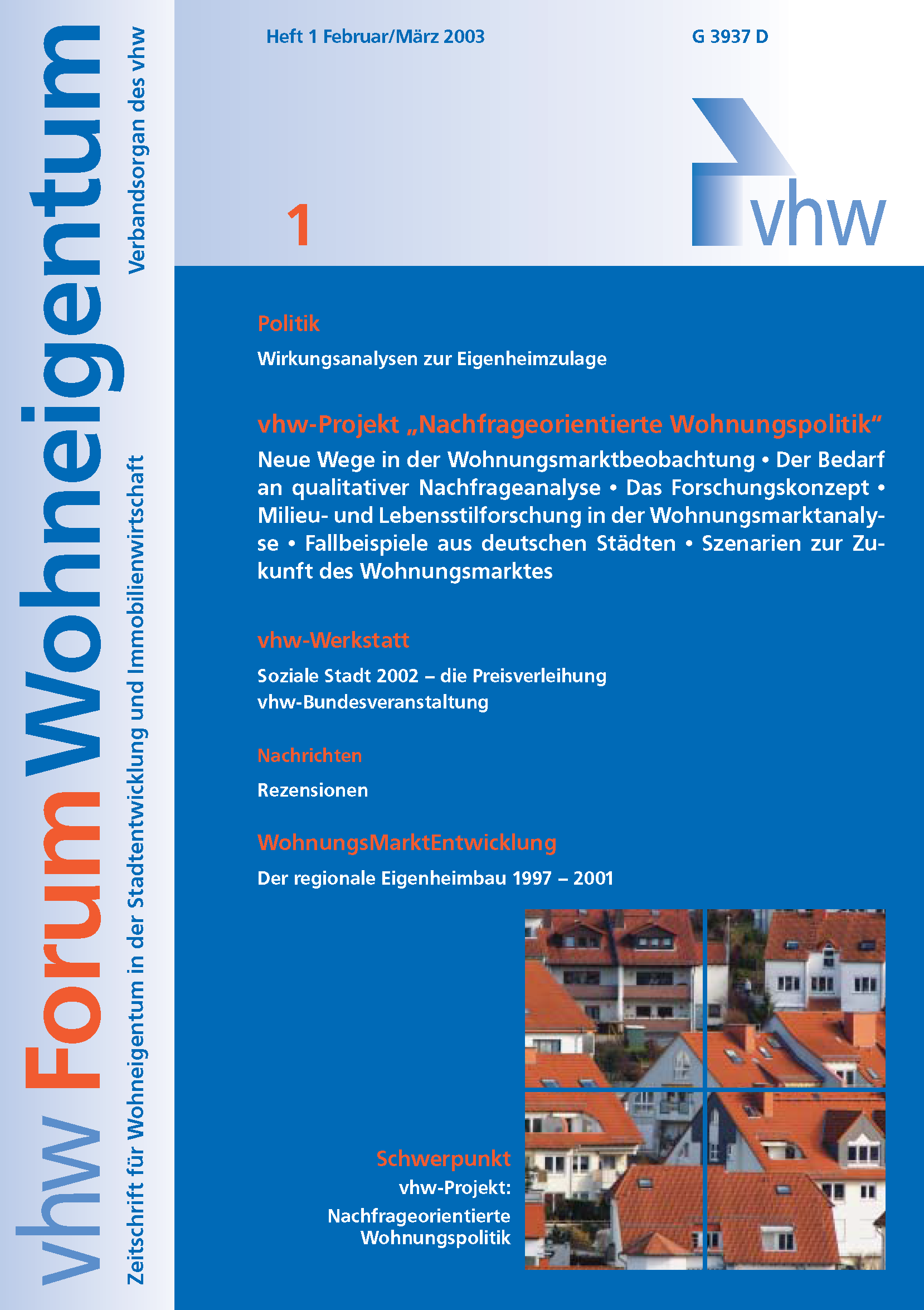
Erschienen in
Der Artikel beschreibt drei Szenarien zur Zukunft des deutschen Wohnungsmarktes, die als strategischer und analytischer Hintergrund im Rahmen des Projektes "Konsumentensouveränität im Wohnungsmarkt" erarbeitet wurden. Die Szenarien wurzeln in der Gegenwart. Sie versuchen, die Fülle der Phänomene und der Beobachtungen im Markt einerseits zu erfassen, andererseits in ihrer Komplexität soweit zu reduzieren, dass die großen, unterschiedlichen und z.T. widerstreitenden Strömungen der Gegenwart in ihren Auswirkungen für die Zukunft erkennbar werden. Die Szenarien sollen so mögliche Zukünfte und damit auch Veränderungspotenziale des Wohnungsmarktes aufdecken. Damit wird eine Grundlage geschaffen, mit der die Strategieentwicklung und Entscheidungsfindung der Akteure im Wohnungsmarkt unterstützt werden kann.
Beiträge