
Erschienen in Heft 4/2015 Einfamilienhäuser der fünfziger bis siebziger Jahre

Erschienen in Heft 3/2011 Stadtentwicklung in Klein- und Mittelstädten
Die rund 20.000 Einwohner große Gemeinde Hiddenhausen in Ostwestfalen-Lippe (Kreis Herford) fördert die Nutzung des Altbaubestandes durch junge Familien, um so den absehbaren Folgen des demografi schen Wandels, insbesondere dem vermehrten Aufkommen von Altimmobilien auf dem Wohnungsmarkt sowie dem Freiflächenverbrauch und dem Verfall der Immobilienwerte sowie dem "Leerlaufen" der Infrastruktur entgegenzuwirken. Die Gemeinde hat in der Vergangenheit, wie vermutlich alle anderen Kommunen auch, neue Anwohner vor allem durch Neubaugebiete geworben bzw. junge Familien an den Ort gebunden. Dies wird in Zukunft kein Königsweg mehr sein. Alle Prognosen weisen auch für Hiddenhausen auf eine schrumpfende und alternde Bevölkerung hin.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2009 Nachhaltigkeit im Wohnungs- und Städtebau

Erschienen in Heft 5/2009 vhw-Verbandstag 2009 / Leitbilder für die Innenstädte

Erschienen in Heft 4/2025 Kommunales Gebäudemanagement
Das kommunale Gebäudemanagement steht deutschlandweit vor zahlreichen Herausforderungen. Kommunen verschiedenster Größenordnung müssen ihre vielfältigen Gebäudeportfolios effizient, nachhaltig und rechtssicher bewirtschaften. Dabei spielen Vernetzung, Wissenstransfer und gemeinsames Lernen eine zentrale Rolle. Der Verband kommunaler Immobilien- und Gebäudewirtschaften e. V. (VKIG) bietet mit seinem etablierten Netzwerk ein herausragendes Beispiel für erfolgreiches Networking im kommunalen Gebäudemanagement.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2025 Infrastrukturen in ländlichen Räumen
Bedingt durch strenge Vorgaben aus dem europäischen Vergaberecht vergeben Kommunen die Planungsleistungen für größere (Hoch-)Bauaufgaben in der Regel über europaweite Ausschreibungsverfahren. Schwer fällt es bei solchen Verfahren oft, Bewertungskriterien zu formulieren, die über Referenzen, Größe des Büros, Umsatz sowie Qualifikationen der Mitarbeiter hinausgehen. Als Lösung für dieses Problem werden diese europaweiten Ausschreibungsverfahren häufig mit konkurrierenden Verfahren oder mit Verhandlungsverfahren kombiniert, sodass letztendlich nicht nur die eingereichten Referenzen und die Standards der Büros als Bewertungskriterien, sondern auch Herangehensweise und eingereichte Lösungen als Bewertungsgrundlage dienen. Auch Planungswettbewerbe, die mit einem Auftragsversprechen verbunden sind, haben sich als gängige und praktikable Lösungen bewährt. Neben der gestalterischen Lösung für ein Problem wird zugleich das Planungsbüro ermittelt, das das Projekt realisieren soll. Insgesamt stehen den öffentlichen Auftraggebern verschiedene Wege offen, die sich bewährt haben.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2025 Korruptionsprävention in Kommunen
Der Abbau vergaberechtlicher Regelungen unterhalb der EU-Schwellenwerte soll Beschaffungsprozesse für die Kommunen schneller und effizienter gestalten. Diese Ziele werden nicht erreicht werden. Stattdessen drohen Mehrausgaben ohne nennenswerte Beschleunigung der Beschaffungsprozesse. Zudem steigen die Korruptionsgefahren. Wie Kommunen hier sinnvoll agieren können, wird in diesem Beitrag erläutert.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2006 Partizipation in der Stadtentwicklung; Trendforschung

Erschienen in Heft 1/2025 Urbane Räume im digitalen Wandel
Als Rainer Floren – Fortbildungsreferent des vhw und früherer Geschäftsführer für Baden-Württemberg – am 22. September 2023 in Böblingen die 13. Baurechtstage Baden-Württemberg beschloss und für den September 2024 nach Karlsruhe einlud, konnte er noch nicht wissen, dass die Gesetzgeber in Bund und Land passgenau zu den 14. Baurechtstagen mit gewichtigen Novellen zum Baugesetzbuch und zur Landesbauordnung aufwarten würden. Dergleichen zeichnete sich ab Sommer 2024 ab, und als Rainer Floren am 24. September 2024 im GenoHotel Karlsruhe (ehemals Akademiehotel) die 14. Baurechtstage eröffnete, zählte er 131 angemeldete Personen als Teilnehmende. Damit war erneut eine Rekordzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern erreicht worden. Diejenigen, die die von Floren begründeten und schnell in Baden-Württemberg etablierten Baurechtstage schon kannten, als sie noch vergleichsweise klein waren, pflegen, alljährlich wiederzukommen, und immer weitere kommen in jedem Jahr neu hinzu. Die 14. Baurechtstage können immerhin darauf verweisen, dass 69 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zuvor bereits ein- oder mehrmals auf den baden-württembergischen Baurechtstagen waren und diese sich immer mehr zu einer Art „baurechtlichen Familientreffen“ entwickeln. Dieser Umstand verdeutlicht, wie etabliert dieses von Floren begründete zweitägige Format mittlerweile ist.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2019 Digitale Verwaltung
Die digitale Revolution ist in Wirkungskette und Ausmaß ähnlich wie die industrielle Revolution. Sie wird als tiefgreifende und dauerhafte Umgestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, Arbeitsbedingungen und Lebensumstände durch Digitaltechniken, Computer und Internet bezeichnet. Welche Auswirkungen dieser Umgestaltungsprozess auf die Verwaltungen Deutschlands hat, erleben alle Angestellten des öffentlichen Dienstes und Beamte hautnah. Wie gelingt es nun, Gestalter und nicht nur „Reaktionist“ des Umgestaltungsprozesses zu sein?
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht
Das Erbbaurecht ausschließlich als ein Instrument „zur Behebung der größten Wohnungsnot“ anzusehen, greift zu kurz. Natürlich muss das Erbbaurecht heute modern gedacht werden, es ist allerdings auch voraussetzungsvoll. Eine Gelingensbedingung für das Erbbaurecht ist die Abkehr von der Idee des Volleigentums am Boden. Das Instrument ist vielmehr auf die Grundstücksverfügung des Erbbaurechtsausgebers angewiesen. Welche Rolle spielt hierbei die (bislang recht obskure) Sozialpflichtigkeit des Eigentums aus Art. 14 Abs. 2 GG? Welche Fortentwicklungsmöglichkeiten bestehen?
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht
Das Erbbaurecht besteht in Deutschland seit Jahrhunderten. Das Erbbaurechtsgesetz (ErbbauRG) hat es im Jahre 1919 praktikabel geformt und die Beleihungsfähigkeit hergestellt. Seitdem wurde es immer dann erfolgreich angewandt, wenn Wohnungen knapp waren oder festgelegte Nutzungen etabliert werden sollten. Heute steht vor allem die Frage nach bezahlbarem Wohnraum, die klar unterstützt werden kann. Mit dem Erbbaurecht sind Mythen verbunden, die einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise nicht standhalten. Das Erbbaurecht platziert sich zwischen Mieten und Kaufen und bildet einen eigenen Markt mit eigenen Regeln. Im Folgenden werden wirtschaftliche Kriterien aufgezeigt, die die praktischen Erfahrungen seit dem Erlass des Erbbaurechtsgesetzes einbeziehen.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2022 Stadtentwicklung und Hochschulen jenseits der Metropolen
In der Gemeinwesenarbeit ist der Theorie-Praxis-Transfer zwischen Hochschulen und Praxisorten zentral. Besonders für spezifische Bedarfe in ländlichen Räumen haben sich in den letzten Jahren hochschulische Weiterbildungsangebote zur Kompetenzerweiterung von Fachkräften etabliert. Im Rahmen des Community Networking wird so beispielsweise die gemeinwesenorientierte Jugendarbeit in Ostfriesland unterstützt.
Beiträge
Erschienen in

Erschienen in
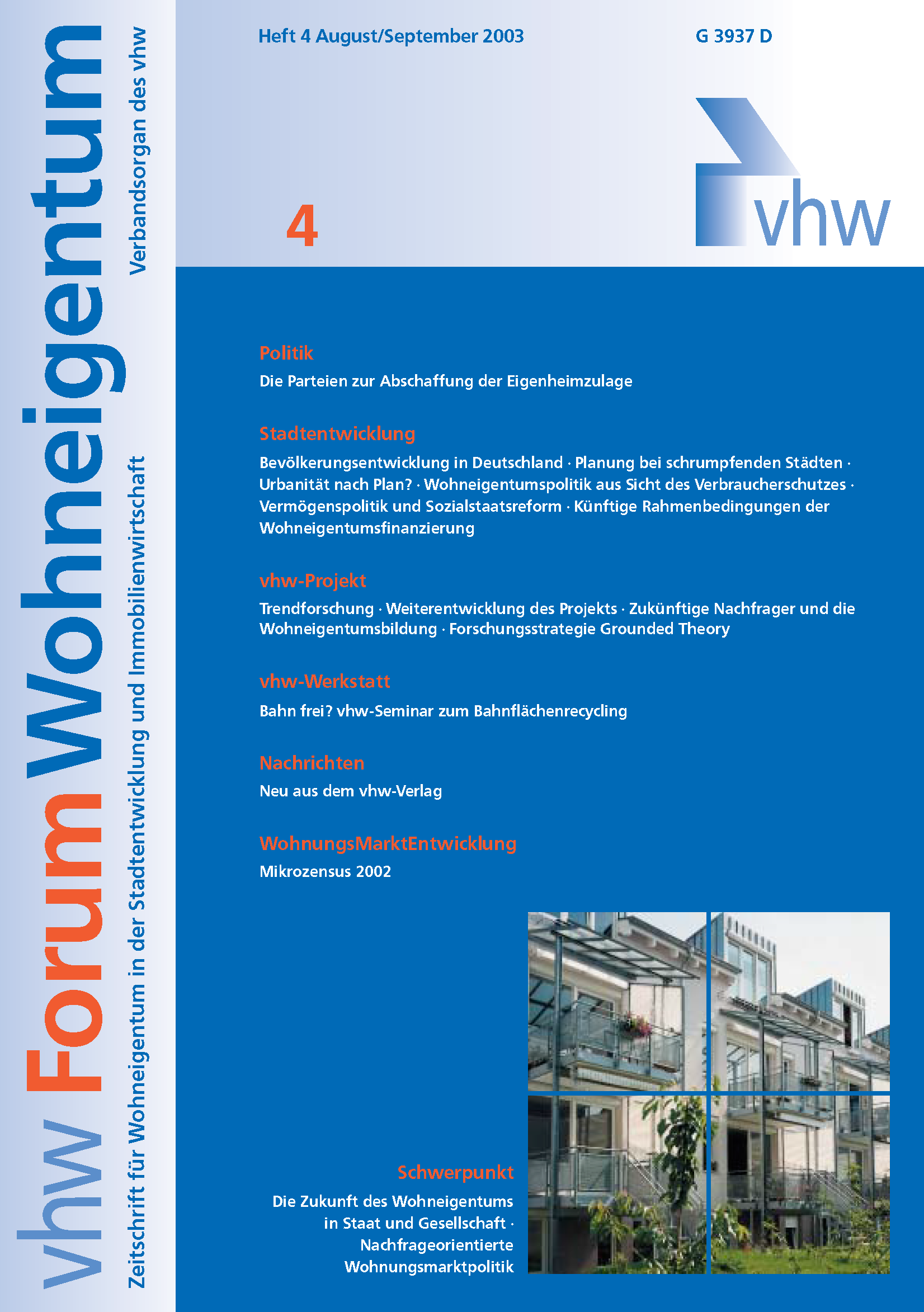
Erschienen in


Erschienen in

Erschienen in Heft 5/2021 Digitalisierung als Treiber der Stadtentwicklung
Der Beteiligung von Gemeinderäten an der Entwicklung kommunaler Digitalisierungsstrategien wird im Rahmen von Förderprogrammen und der Begleitforschung bundesweit bislang nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Dabei sind die kommunalpolitische Auseinandersetzung mit digitalen Themen und die daran anknüpfenden Vorschläge zur Gestaltung des digitalen Wandels vor Ort unerlässlich. Dieser Beitrag wertet die Erfahrungen baden-württembergischer Pilotkommunen im Hinblick auf die Rolle von Gemeinderätinnen und Gemeinderäten aus und gibt Impulse zur Weiterentwicklung der Förderpolitik.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2016 Renaissance der kommunalen Wohnungswirtschaft

Erschienen in Heft 5/2014 Kommunikationslandschaften
Der Befund erschüttert. Selbst nach zwanzig Jahren können die Bürger mit Nanotechnologie wenig anfangen. Das stellte sich bei dem EuroScience Open Forum (ESOF) in Kopenhagen heraus. Als Konsequenz daraus entstand die „Copenhagen Declaration“. Sie fordert die Europäische Kommission auf, für die Einrichtung von Datenknotenpunkten zu sorgen mit aktueller Nano-Info. Der Hilferuf richtet sich auch an die Forschungskommunikation in Deutschland. Ein Nachtrag und zugleich Aufheller zu den umstrittenen WÖM-Empfehlungen der Akademien – und Weckruf: Aufwachen aus dem Dornröschenschlaf!
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2014 Kommunikationslandschaften
Lebendige Dörfer sind kommunikative Dörfer. Dorfgemeinschaften und Nachbarschaften funktionieren (noch) und organisieren Sorge füreinander – dies im Zusammenspiel von Nachbarschaft, Ehrenamt und öffentlicher Verantwortung. Kommunikation findet hierbei nicht im luftleeren Raum statt, sie verortet sich räumlich. In diesem Artikel soll daher der Blick auf die Kommunikationslandschaften in ländlichen Räumen geworfen und dargelegt werden, welche Anforderungen an die Weiterentwicklung von Kommunikationsgebäuden und Kommunikationsplätzen im Dorf bestehen. Ebenfalls beleuchtet wird, wie eine Kommunikationslandschaft mit Blick auf das Jahr 2030 aussehen sollte und welche Schritte dorthin in Dörfern unternommen werden können.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2018 Meinungsbildung vor Ort – Chancen für Stadtentwicklung und lokale Demokratie
Anfang des Jahres 2018 kündigte Facebook an, den Algorithmus des sozialen Netzwerks so zu verändern, dass künftig lokale Nachrichten einen höheren Stellenwert einnehmen und den Nutzern häufiger und weiter oben in ihren News Feeds angezeigt würden, zunächst in den USA, bald aber auch in anderen Ländern (Oremus 2018): "We identify local publishers as those whose links are clicked on by readers in a tight geographic area. If a story is from a publisher in your area, and you either follow the publisher’s Page or your friend shares a story from that outlet, it might show up higher in News Feed."
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2019 Stadtentwicklung und Klimawandel

Erschienen in Heft 4/2005 Stadtregional denken – nachfrageorientiert planen

Erschienen in Heft 2/2006 Neue Investoren auf dem Wohnungsmarkt und Folgen für die Stadtentwicklung

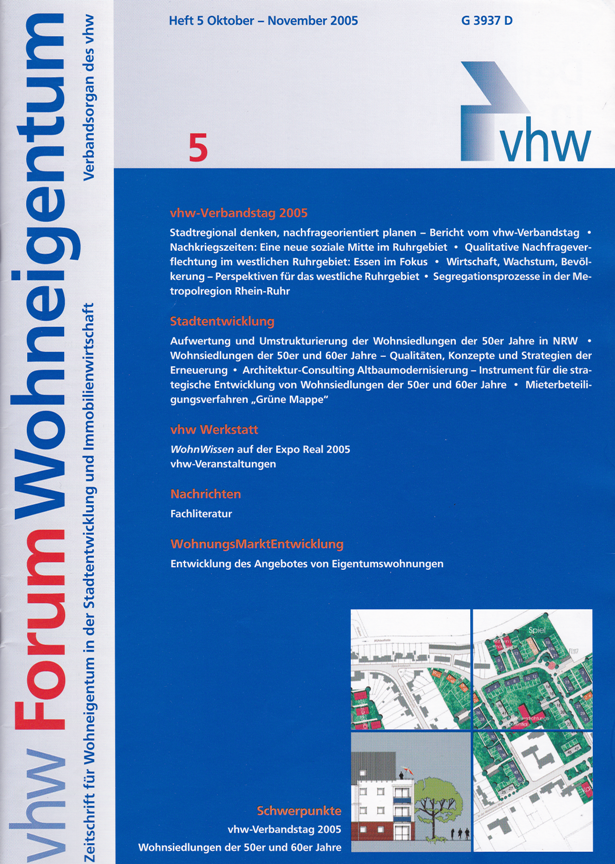
Erschienen in Heft 5/2005 vhw Verbandstag 2005, Siedlungen der 50er und 60er Jahre

Erschienen in Heft 6/2006 Neue Investoren auf dem Wohnungsmarkt – Transformation der Angebotslandschaft

Erschienen in Heft 1/2013 Soziale Stadt und Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklung
Das diesjährige Vergaberechtsforum, das die Geschäftsstellen Nordrhein-Westfalen und Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland des vhw erstmals gemeinsam am 13. und 14. Dezember 2012 im Wissenschaftszentrum Bonn ausgerichtet haben, hat erneut gezeigt, dass das Vergaberecht von immer währender Dynamik geprägt ist. Die Teilnehmer haben sich durch die Vorträge von insgesamt elf Referenten über die aktuellen Neuerungen im Vergaberecht und die aktuelle Rechtsprechung informieren können. Nach Begrüßung und bewährter Einleitung der Veranstaltung durch Uwe Tutschapsky, Regionalgeschäftsführer vhw Südwest, ist der Eröffnungsvortrag zu den "Aktuellen Entwicklungen des Vergaberechts in Deutschland und Europa" von MinDir Dr. Rüdiger Kratzenberg/BMVBS bestritten worden.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2013 Perspektiven für eine gesellschaftliche Anerkennungskultur
Unsere Städte sind zunehmend durch demografischen (graue Gesellschaft, multikulturelle Gesellschaft), sozialen (Individualisierung, Mangel sozialen Kapitals) und ökonomischen Wandel (ökonomische Ungleichheit, Prekarisierung, Armut) geprägt. Die Ungleichheit in städtischen Gesellschaften wächst und macht ein Diversity-Management im Spannungsfeld zwischen kultureller Angleichung oder Förderung von Vielfalt notwendig. Hier setzen Projekte der sozialen Innovation an. Politik und insbesondere lokale Politik ist mit sinkender Wahlbeteiligung und Protest konfrontiert. Auf die Legitimationskrise reagieren Politik und Verwaltung mit neuen politischen Beteiligungschancen und demokratischer Innovation.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2011 Neue Dialogkultur: Wir sprechen uns im Web 2.0
Das Internet ist auf gutem Weg, sich als zentrales Medium der Bürgerbeteiligung zu etablieren. 97 Prozent der Entscheider in öffentlichen Verwaltungen möchten Bürger stärker beteiligen. Mehr als drei Viertel setzen dabei auf das Internet (FAZ/Mummert 2011). Gleichzeitig bleibt jedoch die Skepsis groß, nämlich dass letztlich nur die "üblichen Verdächtigen" erreicht werden, Belangloses oder Kritik statt guter Vorschläge entsteht oder die Bürger nicht im erhofften Maße teilnehmen. Auch wenn diese Risiken durchaus bestehen, so gibt es inzwischen viele Erfahrungen, wie mit ihnen umzugehen und Beteiligung erfolgreich umzusetzen ist.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2011 Neue Dialogkultur: Wir sprechen uns im Web 2.0
Mit neuen Technologien verbinden sich nicht selten hochfliegende Erwartungen ebenso wie kulturkritische Untergangsszenarien. Das gilt auch für das Internet und vor allem für das Web 2.0. Sehen darin die einen die vorläufig letzte Stufe der Entfremdung des Menschen, so erhoffen sich die anderen einen technologischen Quantensprung für die Beteiligung des Menschen am gesellschaftlichen und politischen Leben. Der Beitrag refl ektiert die Chancen und Probleme des Web 2.0 als sogenanntes Mitmachmedium. Er verweist auf die Kommunikations- und Interaktionspotenziale und skizziert bisherige Erfahrungen in der Nutzung des Web 2.0 in Deutschland und darüber hinaus.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2013 Stadtentwicklung anderswo

Erschienen in Heft 5/2013 Diversität und gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Stadt

Erschienen in Heft 5/2011 Mehr wissen – mehr wagen – mehr Dialog
In dem als "Wiege der Demokratie in Deutschland" bekannten Hambacher Schloss wurde das geistige Fundament der deutschen Demokratiebewegung im 19. Jahrhundert gelegt. Bis heute hat dieser Ort nicht an Anziehungskraft für weltoffene Bürger verloren. Das zeigte sich gerade auch beim diesjährigen Vergaberechtsforum des vhw-Südwest speziell für Teilnehmer aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, die die Gelegenheit nutzten, Impulse zu zentralen Fragestellungen des Vergaberechts und seinen praktischen Auswirkungen bei der öffentlichen Hand durch hochkompetente Referenten zu erhalten und mit ihnen zu diskutieren. Nachfolgend werden die Kernaussagen durch die Referenten zusammengefasst und wiedergegeben.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2020 Klimaanpassung im Stadtquartier
Wohnungsunternehmen sollten ihre Verkehrssicherungsplicht in Zeiten von Wetterextremen ernster nehmen als in der Vergangenheit. Insbesondere für Bestandsbauten sollten sie erweiterte Vorkehrungen zum Schutz der Bausubstanz treffen. Vorkehrungen sollten zudem in Sachen Gesundheitsschutz der Mieter getroffen werden. Worauf sollten Wohnungsunternehmen sonst noch achten? Heißere Sommer, mehr Starkregen und heftige Stürme zu fast allen Jahreszeiten beeinträchtigen die Bausubstanz und wirken sich zusehends auch auf die Bewirtschaftung des Gebäudes aus.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2020 Klimaanpassung im Stadtquartier
Auf den ersten Blick lässt sich kaum erahnen, dass es sich bei den beiden 8-geschossigen Häusern in der Berliner Sewanstraße 20/22 um einen preisgekrönten Neubau handelt. Insgesamt 99 Wohnungen befinden sich in den backsteinfarbenen Gebäuden; Hochbeete, Kinderspielplätze und 90 Fahrradstellplätze sind Teil der Grünanlagen – so weit, so normal. Dass es sich hier um einen der wenigen klimaneutralen Neubauten im sozialen Wohnungsbau handelt, zeigt sich erst im Inneren des Gebäudes. Denn mittels energetisch optimierter Bauweise und innovativer Gebäudetechnik konnte das Quartier klimaneutral im KfW-40-Plus-Standard realisiert werden. Gleichzeitig hat die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE an diesem Standort Wohnraum für alle Schichten der Bevölkerung geschaffen.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2020 Klimaanpassung im Stadtquartier
Die jungen Aktivisten von "Fridays for Future" halten der Gesellschaft in bemerkenswerter Weise den Spiegel vor. Auch wenn sie sich vielleicht nicht immer bewusstmachen, was beim Klimaschutz schon alles angestoßen wird und wie viele Hemmnisse und Zielkonflikte es in der praktischen Umsetzung gibt – recht haben sie dennoch: Wenn wir so weitermachen, werden wir in den nächsten 30 Jahren nicht annähernd klimaneutral werden. Dies gilt auch für unsere Gebäude, die gut ein Drittel der Treibhausgase verursachen. Im Vergleich zum Jahr 1990 hat sich der Treibhausgasausstoß zwar um etwa 40 % verringert. Allerdings stagnieren seit gut fünf Jahren die energetischen Modernisierungen, und die CO2-Emissionen gehen kaum zurück. Wir müssen die Anstrengungen erheblich erhöhen, wenn wir die Ziele wirklich ernst meinen.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2023 Urbane Transformation als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
Nach dem positiven Feedback der Teilnehmenden an der ersten hybrid ausgerichteten Bundesrichtertagung im Vorjahr und der Erfahrung im Rücken, dass Präsenzveranstaltung und digitale Teilnahme reibungslos ineinandergreifen, fand die 17. Bundesrichtertagung des vhw am 21. November 2022 wieder im Kardinal-Schulte-Haus in Bergisch Gladbach und zugleich live online statt. Das Interesse war sehr groß. Endgültig im Hybridzeitalter angekommen, konnte der vhw über 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort und weitere 165 in der ganzen Republik begrüßen: von Fehmarn und Bergen auf Rügen bis Kempten und Bad Reichenhall und von Aachen und Münster bis Dresden und Forst (Lausitz). Sie alle erhielten einen exklusiven Rechtsprechungsbericht aus erster Hand und konnten sich mit Sprech- bzw. Chatbeiträgen am Veranstaltungsgeschehen beteiligen. Diese Möglichkeit wurde gern genutzt, und der den Chat moderierende vhw-Kollege Philipp Sachsinger war laufend gefordert, die Fragen nach Themenblöcken zu strukturieren, zusammenzufassen und zu referieren.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2023 Wohneigentum als Baustein für die Wohnungspolitik
Die Wohneigentumsbildung steht in den Jahren 2022 und 2023 vor großen Herausforderungen. Das Nachwirken der Coronapandemie und der russische Angriffskrieg haben enorme Auswirkungen auf die Nachfrage nach Wohnraum im Allgemeinen und das Potenzial zum Erwerb von Wohneigentum im Speziellen. Die wirtschaftlichen Herausforderungen für die Immobilienwirtschaft in den noch jungen 2020er Jahren sind eng mit den Herausforderungen verquickt, die private potenzielle Wohneigentümer erfahren, und lassen sich gut anhand der Stimmungslage der Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft skizzieren.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2023 Wohneigentum als Baustein für die Wohnungspolitik

Erschienen in Heft 6/2021 Wohnen in Suburbia und darüber hinaus
Um den Klimaveränderungen zu begegnen, müssen insbesondere unsere Städte resistenter gegen Wetterextreme werden. Das gilt gleichermaßen für Starkregenereignisse wie für Hitzeperioden. Bislang wird nur vereinzelt auf klimaresilientes Bauen Wert gelegt, und Städte leiden wegen ihrer dichten Bebauung besonders unter Extremwetterereignissen. In Großstädten wie Köln oder Frankfurt am Main ist beispielsweise an heißen Tagen die Temperatur um vier bis fünf Grad höher als im ländlichen Umland, weil sich Beton und Asphalt aufheizen und die Hitze speichern. Und weil in Städten viele Flächen versiegelt sind durch Gebäude, Straßen, Parkplätze etc. kommt bei Starkregen die Kanalisation schnell an ihre Grenzen. Um Städte klimaresistenter zu machen, sollte man den Fokus deshalb nicht auf einzelne Gebäude legen, sondern Maßnahmen auf Quartiersebene ergreifen. So lassen sich bessere Ergebnisse erzielen und Kosten sparen. Was es dabei zu bedenken gilt.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2014 Infrastruktur und soziale Kohäsion
"Bürgerbus" – was ist das denn? Obwohl der erste Bürgerbus in Deutschland bereits 1985 eingerichtet wurde und hierzulande mittlerweile etwa 200 bis 250 Projekte existieren, ist diese besondere Mobilitätsform noch längst nicht überall bekannt. Was ist also nun ein Bürgerbus? Es handelt sich um öffentlichen Personennahverkehr, bei dem ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger das Fahrzeug steuern. Das Land Nordrhein-Westfalen definiert den Bürgerbus so: "Als Bürgerbus gilt der mit Kleinbussen betriebene öffentliche Personennahverkehr, soweit der Betrieb von einem zu diesem Zweck gegründeten Verein mit ehrenamtlich tätigen Fahrerinnen und Fahrern durchgeführt wird."
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2023 Urbane Daten in der Praxis

Erschienen in Heft 4/2015 Einfamilienhäuser der fünfziger bis siebziger Jahre

Erschienen in Heft 4/2015 Einfamilienhäuser der fünfziger bis siebziger Jahre

Erschienen in Heft 4/2013 Gentrifizierung: Mehr als ein Markphänomen

Erschienen in Heft 3/2011 Stadtentwicklung in Klein- und Mittelstädten

Erschienen in Heft 2/2012 Städtenetzwerk Lokale Demokratie – Zwischenbilanz