
Erschienen in Heft 6/2022 Kooperationen von Kommunen und Zivilgesellschaft
Im Herbst ist Verbandstag beim vhw, und auch im Jahre 2022 sollte dieser wieder in Präsenz stattfinden. Der Spreespeicher Berlin, gelegen an der Spree direkt an der Oberbaumbrücke zwischen Kreuzberg und Friedrichshain, war diesmal der Tagungsort für diese Veranstaltung sowie für die jährliche Mitgliederversammlung. Rund 200 Gäste aus Politik, Planung, Verwaltung, Wissenschaft und Wohnungswirtschaft sind der Einladung des Verbandes in diese „Location“ gefolgt, um sich über städtebauliche Dichte und Verdichtung im Spannungsfeld zwischen Marktmechanismen und Klimaschutz auszutauschen. Die Moderation der Veranstaltung übernahm Katharina Heckendorf.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2022 Stadtentwicklung und Hochschulen jenseits der Metropolen
Die Frage, welche Effekte eine dezentrale Verteilung von Hochschulen und Forschungseinrichtungen erzielen kann, beschäftigt Regional-, Forschungs- und Stadtentwicklungspolitik sowie auch die Forschung selbst seit Langem. Der folgende Beitrag erhebt nicht den Anspruch, diese Frage umfänglich zu beantworten. Vielmehr sollen Erfahrungen aus Sicht einer Forschungseinrichtung, die in einem lokalen Kontext eng mit nichtwissenschaftlichen Institutionen kooperiert und einen transformativen Anspruch erhebt, in Form von Thesen dargelegt werden. Darauf aufbauend werden zwei urbane Experimente in Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis am heutigen Hochschul- und Forschungsstandort Görlitz beispielhaft vorgestellt.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2019 Vertrauen in der Stadtgesellschaft
Unser Verständnis von Stadtentwicklungsprozessen – und der Rolle, die Bürgerbeteiligung dabei spielt – bedarf ständigen „Neu-Denkens“. Aber selten gab es so viele Anlässe, diese Aufforderung ernst zu nehmen wie in diesen Tagen. Dabei nimmt das kommunikative Umfeld, in dem Aufgaben der Stadtentwicklung bearbeitet werden, eine besondere Rolle ein. Denn der hier zu beobachtende Wandel bleibt nicht ohne Einfluss auf Substanz und Gestaltung der Verständigung in Stadtentwicklungsprozessen. Bei alledem spielt das Thema „Vertrauen“ eine wesentliche Rolle. Dies soll mit einigen Schlaglichtern erläutert werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2007 Bürgergesellschaft und Nationale Stadtentwicklungspolitik
Die Praxis der Bürgerbeteiligung und -orientierung ist kein einfaches Geschäft. Auch wenn alle Beteiligten sich ernsthaft darum bemühen, ist die alltägliche Praxis bürgerschaftlicher Teilhabe mit vielfältigen Schwierigkeiten behaftet. Will man Bürgerorientierung weiter entwickeln und stärken, dann ist eine offene Auseinandersetzung mit diesen Schwierigkeiten vonnöten. Eben das war das Ziel einer Veranstaltung, zu der sich am 16. November 2007 in den Räumlichkeiten des Deutschen Architekturzentrums in Berlin Experten aus Theorie und Praxis zu einer vhw-Arbeitstagung trafen. Unter dem Titel "Wenn alle das Beste wollen... und Bürgerorientierung dennoch zum Problem wird" sollte ein Schritt auf dem Weg zur Klärung der Möglichkeiten und Voraussetzungen wirkungsvoller Teilhabe an Stadtentwicklung und Wohnungspolitik gemacht werden. Ziel des vhw ist es, im Rahmen eines Arbeitsschwerpunktes den Schlüsselbegriff "Partizipation" für die Verbandsarbeit weiter zu operationalisieren und praktische Konsequenzen für die Arbeit in Wohnungsunternehmen und Kommunen zu ziehen.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2019 Digitale Verwaltung
Sie ist als Schlagwort in aller Munde. Für die einen gilt sie als Heilsbringer in einer modernen Gesellschaft, andere begegnen ihr mit Skepsis und Bedenken. Ist sie Fluch oder Segen? Oder vielleicht beides? Sicher ist nur eines: Sie wird nicht mehr weggehen. Sie ist ein Megatrend, der bereits jetzt alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens durchflutet, nachhaltig beeinflusst und verändert. Ludwigsburg leistet bereits heute Pionierarbeit bei der Erforschung und Implementierung digitaler Lösungen in allen Bereichen der Stadtentwicklung. Die beschleunigte Entwicklung städtischer Lebensräume und die Bewältigung besonderer Herausforderungen sind zentrale Aufgaben für die Kommune der Zukunft.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2018 Tourismus und Stadtentwicklung
…braucht man Platz, an dem man ruht. Das trifft zumindest auf Reisen zu, die länger als nur einen Tag andauern. Die Gründe für eine solche Reise können sowohl geschäftlich als auch zu Bildungs- oder Erholungszwecken sein. Dafür befinden sich an den Reisezielen entsprechende Einrichtungen, die die täglichen Bedarfe der Reisenden decken. Hierzu zählen insbesondere Unterkünfte wie Hotels, Pensionen, Ferienhäuser und -wohnungen, Jugendherbergen oder Campingplätze. Die Qualität und Ausstattung variiert je nach Zielgruppe und Lage. Die Sinus-Milieus als Gesellschaftsmodell sollen an dieser Stelle für den Schwerpunkt des Urlaubstourismus in Deutschland sowie für die Urlaubsregionen Berlin und Mecklenburg-Vorpommern Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzeigen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2018 Meinungsbildung vor Ort – Chancen für Stadtentwicklung und lokale Demokratie
Die Menschen in unserem Land leben in einer Informationsgesellschaft. Wir sind geprägt durch mediale Vielfalt, durch Informationen aus allen Bereichen des Lebens und steigende Möglichkeiten, diese Informationen abzurufen. Doch steigt mit der Möglichkeit der Informationsbeschaffung auch die Informiertheit der Menschen? Neben etablierten Medien entstehen regelmäßig neue Kommunikationskanäle, ob nun als erweitertes Angebot der Print-, Radio- oder Fernsehmedien oder als eigenständiges Format im Internet. Die Vielzahl der Angebote setzt den Nutzer unter Druck, das passende Medium für die eigenen Ansprüche zu wählen. Dabei spielen die Lebenswelten, in der sich die Mediennutzer befinden, eine wichtige Rolle, denn oftmals sind die Nutzer gleichzeitig auch Multiplikatoren.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2018 Meinungsbildung vor Ort – Chancen für Stadtentwicklung und lokale Demokratie
Anfang des Jahres 2018 kündigte Facebook an, den Algorithmus des sozialen Netzwerks so zu verändern, dass künftig lokale Nachrichten einen höheren Stellenwert einnehmen und den Nutzern häufiger und weiter oben in ihren News Feeds angezeigt würden, zunächst in den USA, bald aber auch in anderen Ländern (Oremus 2018): "We identify local publishers as those whose links are clicked on by readers in a tight geographic area. If a story is from a publisher in your area, and you either follow the publisher’s Page or your friend shares a story from that outlet, it might show up higher in News Feed."
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2006 vhw Verbandstag 2006 "Mittendrin statt nur dabei – Bürger entwickeln Stadt"
Der vhw hat das neue Gesellschaftsverständnis von der Bürgergesellschaft im aktivierenden und ermöglichenden Staat zu einer Leitlinie seiner Verbandspolitik gemacht. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass auf die Bürger insbesondere im Bereich der Stadtentwicklung und der Wohnungspolitik erweiterte Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten zukommen. Im Jahr 2005 wurde deshalb das Projekt "Bürgerorientierte Kommunikation" gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung der RWTH Aachen unter Leitung von Professor Dr. Klaus Selle ins Leben gerufen. Eine Reflexion der ersten Schritte nach knapp einjähriger Arbeit.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2011 Städtenetzwerk Lokale Demokratie
An der WERK-STADT "Integration und Bildung – Wie macht Stadtgesellschaft Schule?", die im Rahmen des ersten Kongresses zum Städtenetzwerk in der Kalkscheune stattfand, beteiligten sich rund 80 Teilnehmer aus Politik und Verwaltung, Wohnungswirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Moderiert wurde die WERK-STADT von Jürgen Kaube, Journalist bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Referenten der WERK-STADT waren Prof. Dr. Thomas Olk von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Prof. Dr. Roland Roth von der Hochschule Magdeburg-Stendal und Sebastian Beck, wissenschaftlicher Referent beim vhw e.V., Berlin.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2011 Städtenetzwerk Lokale Demokratie
Die Werk-Stadt "Integration und Wohnen – unterwegs zur geteilten Stadt" im Rahmen des ersten Kongresses zum Städtenetzwerk fand mit rund 130 Teilnehmern aus Politik und Verwaltung, Wohnungswirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft statt. Moderiert wurde die Werk-Stadt von Elke Frauns vom büro frauns kommunikation, planung, marketing aus Münster. Referenten der Werk-Stadt waren die Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid, Beate Wilding, Bernd Hallenberg, Bereichsleiter Forschung beim vhw, Prof. Jens Dangschat von der Technischen Universität Wien und Hendrik Jellema, Vorstand der GEWOBAG Wohnungsbaugesellschaft Berlin.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2021 50 Jahre Städtebauförderung
Die aktuelle Anspannung auf großstädtischen Wohnungsmärkten stellt nicht nur private Haushalte vor Probleme, sondern wird zunehmend auch für Unternehmen auf der Suche nach Fachpersonal zu einer Herausforderung. Der Faktor Wohnen wird hierbei zunehmend zu einem relevanten Entscheidungsfaktor für oder gegen einen Arbeitsplatz, womit Angebote zur Versorgung der eigenen Belegschaft mit Wohnraum zu einem Wettbewerbsvorteil, insbesondere auf angespannten Arbeitsmärkten, werden. Wurde die unternehmerische Wohnraumversorgung im 19. und 20. Jahrhundert in der wissenschaftlichen Literatur ausführlich diskutiert, fehlt es an einer vertieften Debatte dazu im 21. Jahrhundert, welche in diesem Beitrag thematisiert wird.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2010 Stadtumbau – zweite Halbzeit
Der demografische Wandel schreitet voran. Immer weitere Landstriche in Deutschland, Dörfer wie Städte, sind von der Schrumpfung betroffen. In diesen Regionen nehmen Leerstände und der Verfall von Immobilien zu, die öffentlichen Leistungen werden eingeschränkt. Fehlende Nachfrage und Unterauslastung führen zu einer suboptimalen Nutzung von Kapital, die Immobilienpreise fallen weit unter die Substanzwerte. Mit der individuellen Verärgerung der Hauseigentümer über den Wertverlust ihres Eigenheims nimmt zugleich die Motivation ab, sich vor Ort zu engagieren, in der Folge leiden die Attraktivitäten von Ort und Eigentum noch mehr. Was ließe sich dagegen tun?
Beiträge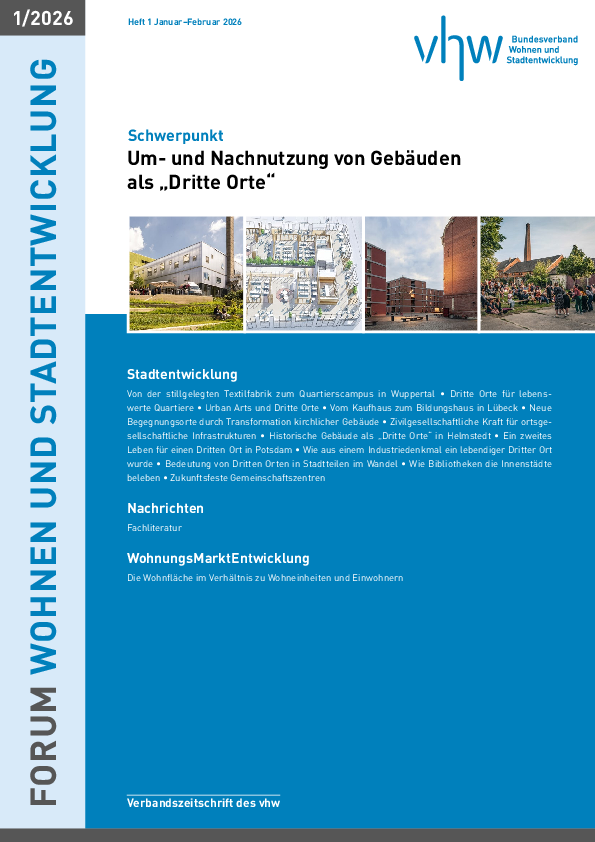
Städte können ihren Leerstand als Chance betrachten, steckt in ihnen doch das Potenzial, Bildungs- und Kultureinrichtungen zu fördern und durch diese Innenstädte wieder zu einem Ort zu machen, an dem Menschen sich gerne aufhalten. Gerade öffentliche Bibliotheken tragen wesentlich zur funktionalen Vielfalt und sozialen Qualität von Stadtzentren bei: als die meistfrequentierten Kultureinrichtungen, konsumfreie Aufenthaltsorte und generationsübergreifende Angebote. Damit Bibliotheken ihr Potenzial entfalten können, benötigen sie Unterstützung, z. B. durch neue Standorte und Gebäude. Hierfür bieten sich viele der innenstädtischen leer stehenden Typologien an, die viel Raum für innovative Raumkonzepte bieten.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2011 Städtenetzwerk Lokale Demokratie
Auf der kommunalen Ebene ist in den letzten Jahren deutlich geworden, dass erfolgreiches politisches Handeln zunehmend davon abhängt, ob und wie die Bürger am politischen Entscheidungsprozess beteiligt werden. Die deliberative Demokratietheorie schlägt hierfür ein Verfahren vor, das die Akzeptanz politischer Reformen steigern kann, ohne partikularistische Interessen einzelner aktiver Bürgergruppen zu bedienen. Doch obwohl empirische Studien vielversprechende Ergebnisse präsentieren, wird das „deliberative polling“ in der politischen Praxis in Deutschland bislang nur selten eingesetzt.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2024 Transformation des Wohnens
Immobilienfirmen und Projektentwickler sollten spätestens in der derzeitigen Situation ihre Firma resilienter machen. Inwiefern sie Krisenmanagementtools dabei unterstützen und wie diese erarbeitet werden können, darum geht es in dem vorliegenden Beitrag.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2024 Zukunft der Innenstädte in Deutschland
Es läuft schleppend mit dem Wohnungsbau, denn die prognostizierte Zahl an Fertigstellungen wurde im vergangenen Jahr nicht erreicht. Anstatt 400.000 Einheiten wurden 295.300 errichtet, und in diesem Jahr könnten es noch weniger sein. Die Gründe sind hinlänglich bekannt, aber es gäbe Ansatzpunkte, die Fertigstellungszahlen mittelfristig zu steigern. Bauvorschriften könnten vereinfacht und für alle Bundesländer vereinheitlicht werden. BIM und serielles Bauen tragen ebenfalls zu einer Beschleunigung am Bau bei. Manchmal lohnt auch ein Blick in Nachbarländer, wie die Niederlande. Was darüber hinaus zu tun ist.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2025 Infrastrukturen in ländlichen Räumen
Die Energiewende in den verschiedenen Sektoren (Strom-, Wärme- und Verkehrssektor) zeigt sich in ländlichen Räumen mit spezifischen Charakteristika. Diese unterscheiden sich erheblich von anderen Raumkategorien, wie stärker verdichteten stadt-regionalen Gebieten. Den ländlichen Räumen werden aufgrund bestehender Standortvorteile, wie großen Freiflächenpotenzialen, positive Entwicklungschancen durch die Energiewende zugeschrieben. Aber was steckt wirklich dahinter? Wo stehen wir mit der Energiewende auf dem Land? Wie sehen heute die tatsächlichen Potenziale für den ländlichen Raum und das Gelingen der Energiewende aus? Und welche Konflikte treten dabei vielleicht zutage?
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2024 Urbane Resilienz
Mit Blick auf akute Krisen und langfristige Herausforderungen, wie den Klimawandel und das Ziel der Nachhaltigkeit von Kommunen, muss Kommunikation und Stadtentwicklung stärker als bisher zusammengedacht werden. Öffentliche Kommunikation auf lokaler Ebene ist jedoch komplexer und anspruchsvoller geworden, die Kommunikationskanäle differenzieren sich aus. Deshalb sollten Politik und Verwaltung der Frage nachgehen, wie die lokale Öffentlichkeit in ihrer Kommune funktioniert. Diese Bestandsaufnahme bildet die Grundlage für die Entwicklung geeigneter Kommunikationsstrukturen und -politiken, die die Resilienz von Stadtgesellschaften steigern können. Der „Digitale Monitor lokale Öffentlichkeit“ des vhw kann Städte und Gemeinden hierbei unterstützen.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2010 Öffentlicher Raum: Infrastruktur für die Stadtgesellschaft
Unter dem Begriff "öffentlicher Raum" werden heute unterschiedliche Konzepte, in der Praxis zudem unterschiedlich weite Formen des Öffnens von Orten für die Vielfalt der Nutzenden verstanden. Der Rahmen erstreckt sich vom öffentlichen Raum als Bewegungs- und Aufenthaltsort über die programmatische Forderung nach Möglichkeiten der Begegnung bis hin zu der Ansicht, dass "öffentlicher Raum […] Brennpunkt öffentlichen Lebens [ist] - ein Ort der Begegnung und Konfrontation unterschiedlicher Schichten, Generationen und Kulturen." (Asadi et al. 1998, 3) Der hier vorliegende Beitrag geht der Frage nach, welche Integrationsherausforderungen in öffentlichen Räumen gegeben sind und wie dessen Integrationspotenziale in der Planungspraxis methodisch analysiert werden können.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2014 Lokale Bildungslandschaften
Mit dem anhaltenden Strukturwandel zerfallen die Städte zusehends in Teilstädte: Migrationshintergrund, Religion und ethnische Herkunft, die Verteilungswirkungen von Wohnungsmarkt und -politik, die Verfestigung von Armut und Arbeitslosigkeit und die Herausbildung einer ‚new urban underclass’ prägen zunehmend die räumliche Struktur der Stadt und das Bild einzelner Quartiere. Bei der Entstehung benachteiligender Quartiere spielen nicht zuletzt die Schulen eine wichtige Rolle: Wie wir seit PISA wissen, sind in Deutschland Bildungserwerb und Schulerfolg – und damit auch die weiteren Lebenschancen – stärker als anderswo an die soziale Herkunft gekoppelt. Und soziale Herkunft bedeutet eben nicht nur die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schicht oder Ethnie, sondern auch die Herkunft aus einem bestimmten Wohnviertel.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2015 Die Innenstadt als Wohnstandort
Städte waren stets die Laboratorien der gesellschaftlichen Entwicklung. Städte waren stets die Orte, an denen sich jene Dynamik entfaltete, die für Gesellschaften typisch werden sollte – und dies ist wahrlich kein Phänomen der Moderne, was man etwa daran sehen kann, dass wir die Entwicklung wenigstens westlicher Gesellschaften an Städten festmachen: an Athen als der Polis, die als erste Demokratie eine städtische Form des Interessenausgleichs erfunden hat; Rom als Zentrum der ersten Weltmacht, später dann als Zentrum des christlichen Europas; später dann die europäischen Zentren als Basen jeweiliger Nationalstaaten und heute schließlich die großen städtischen Agglomerationen der Welt.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2017 Sozialorientierung in der Wohnungspolitik
Welches Bild sozialer Kohäsion erhalten die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt aus den lokalen Medien? Unterscheidet sich dieses Bild nach Stadt und Medium? Diese Fragen standen im Zentrum eines Forschungsprojektes von vhw und Kommunikationswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern der Universität Zürich. Zu diesem Zweck wurden lokale Printmedien in Kiel, Saarbrücken und Essen inhaltsanalytisch auf insgesamt neun Kohäsionsdimensionen untersucht. Zentrales Ergebnis der Studie ist, dass sich trotz unterschiedlicher Voraussetzungen in den Städten das medial erzeugte Bild sozialer Kohäsion kaum unterscheidet, während sich deutliche Unterschiede zwischen lokalen Zeitungen, Anzeigenblättern und dem Lokalteil der Bild-Zeitung aufzeigten. Individuelle Medienrepertoires sind entsprechend zentral für das medial vermittelte Bild gesellschaftlichen Zusammenhalts für die Bürgerinnen und Bürger.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2022 Auswirkungen des Klimawandels und die Anforderungen an das kommunale Krisenmanagement
Seit fast zwei Jahren wird die Welt durch die Covid-19-Pandemie in Atem gehalten – eine Krise, die weitreichende Auswirkungen auf alle Lebensbereiche hat und deshalb auch viele Fragen aufwirft, die einen direkten Bezug zur Gestaltung unseres Lebensumfeldes sowie der Stadt- und Raumentwicklung haben. Deutlich ist nach zwei Jahren Stadtentwicklung in der Pandemie, dass diese nicht völlig neue Phänomene hervorbringt, sondern viele bereits existierende Trends besonders zuspitzt oder beschleunigt. Primär zu nennen sind u.a. die digitale Transformation, aber auch die sozio-ökonomische Polarisierung oder der Fachkräftemangel in öffentlichen Verwaltungen und Einrichtungen. Zudem resultieren die Auswirkungen der Pandemie in vielen Fragen in einer besonderen Polarisierung unterschiedlicher Sichtweisen, etwa wenn es in der Diskussion von pandemiesicheren Fortbewegungsmöglichkeiten um die Abwägung zwischen Auto und öffentlichem Nahverkehr geht.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2016 E-Commerce und Stadtentwicklung
Der Einzelhandel erlebt mit der Digitalisierung einen Strukturwandel, der diesen Wirtschaftszweig vermutlich tiefgreifender und nachhaltiger verändern wird als die Einführung der Selbstbedienung vor einem halben Jahrhundert. Das verändert auch die Innenstädte; einige dürften von der Veränderung profitieren, während andere stärker unter Druck geraten. Die digitalen Technologien beeinflussen die Wertschöpfungsprozesse in der Wirtschaft und das Verhalten der Kunden. Diese Veränderungen spielen sich in einem stagnierenden Wirtschaftszweig ab, der preisbereinigt seit zwei Jahrzehnten ein Nullwachstum verzeichnet.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2013 Stadtentwicklung anderswo
237.000 Unternehmen, über eine Million Erwerbstätige und mehr als 131 Milliarden Euro Jahresumsatz allein in Deutschland belegen die ökonomische Bedeutung der Kreativwirtschaft deutlich. Sie gilt als Ausdruck städtischer Offenheit und Innovation und setzt wichtige Impulse für eine urbane Erneuerung. "Creative Cities" hat sich zur Aufgabe gemacht, die Potenziale der Branche zu identifizieren und gezielt für die Stadt- und Wirtschaftsentwicklung in den fünf teilnehmenden Städten zu nutzen.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2024 Wasser als knappe Ressource
Es galt als eine Errungenschaft, als James Hobrecht um 1870 die großen Radialsysteme der Mischwasserkanalisation entwickelte. Städte wurden aus der Logik der Entwässerung geplant. Schmutz- und Regenwasser wurden gemeinsam als Mischwasser auf die Rieselfelder an die Ränder der Stadt transportiert, um sie nicht nur zu „entsorgen“, sondern diese für die Bewässerung und Düngung landwirtschaftlicher Flächen mit einer hohen Produktivität einzusetzen. Eine frühe Kreislaufwirtschaft, die das Mischwasser als Ressource einsetzte. Heute startet langsam wieder die Diskussion, ob das Klarwasser der Kläranlagen für die Bewässerung von Landwirtschaft, Landschaft und das urbane Grün genutzt werden soll.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2016 Fluchtort Kommune
Wie in vielen deutschen Städten erfordert auch in Essen die aktuelle und zukünftige Flüchtlingssituation die zügige Umsetzung verschiedener Ansätze zur Integration von geflüchteten Menschen. Flüchtlinge, die Asyl erhalten und in Essen leben und arbeiten werden, sollen sich in ihrer neuen Wahlheimat schnell zuhause fühlen. Zahlreiche Akteure aus Verwaltung, Wohnungsbaugesellschaften, gemeinnützigen Organisationen, Freiwilligenagenturen und Verbänden unterstützen das Ankommen der neuen Mitbewohner. Eine tragende Rolle spielt darüber hinaus das Engagement ehrenamtlich tätiger Mitbürger. Die Ehrenamt Agentur Essen e.V. reflektiert ihre Erfahrungen mit Ehrenamtlichen, Flüchtlingen, weiteren Freiwilligenagenturen, der bagfa (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen) und FOCO e. V. (Forum für Community Organizing) zur Bedeutung des Engagements in der Flüchtlingshilfe.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2014 Wohnen in der Stadt – Wohnungspolitik vor neuen Herausforderungen
Alles drängt in die großen Städte. Doch dort geben die Einheimischen den Platz nicht her. Wer Ende Mai aus dem Urlaub nach Berlin zurückkehrte, traf gleich an der Autobahnabfahrt Tempelhof auf viele fröhliche Menschen. Sie kamen von dem großen freien Feld, das die Stadtregierung nach der Stilllegung des innerstädtischen Flughafens einfach sich selbst überließ, und sie bevölkerten genau jene offene Flanke, die der Senat eigentlich durch Mietwohnungen und eine neue Stadtbibliothek schließen wollte. Vermutlich hatten die meisten dieser Menschen irgendwann im Laufe des Tages ein Wahllokal aufgesucht und für den Erhalt dieser Brache gestimmt.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2005 Stadtregional denken – nachfrageorientiert planen
Die Anbieter von Beratungsleistungen haben auf den steigenden Informationsbedarf der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft mit einer breiten Palette von Analysen, quantitativen Prognosen und individuellem Consulting unlängst reagiert. Die verwendeten Methoden sind vielfältig, die Rechenmodelle mitunter komplex und der Fundus von marktrelevanten Daten ist nur schwer zu überschauen. Für die Unternehmen stellt sich die Frage: Welche Informationen können als verlässliche und belastbare Basis für anstehende Entscheidungen dienen? So unterschiedlich die verschiedenen Modelle, Methoden und Datenquellen auch sind, ein doppeltes Defizit ist den meisten von ihnen gemeinsam: Die qualitative Nachfrage – also die Frage, warum wer wo wohnt – wird nur rudimentär behandelt. Gleichzeitig bleibt der entscheidende, nämlich der kleinräumliche Marktzusammenhang wegen der fehlenden Feinkörnigkeit der Daten unberücksichtigt. Die vermeintliche Eindeutigkeit soziodemographischer Zielgruppen-Konstrukte, wie z.B. "junge Familien mittleren Einkommens", verdeckt oft das Wesentliche: Hinter den Kunden und ihren räumlichen und qualitativen Wohnentscheidungen steht weitaus mehr als Lebensphase, Haushaltsstruktur und Einkommen.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2011 Stadtentwicklung in Klein- und Mittelstädten
Spätestens seit der breiten Rezeption, die das 2002 erschienene Buch von Richard Florida (The Rise of the Creative Class) erfahren hat, ist die Bedeutung von Wissenschaft und Kreativität für die Stadtentwicklung in vielen Kommunen erkannt worden. Städte und Regionen konkurrieren in zunehmend globalem Maßstab um Hochqualifizierte, um die Ansiedlung von Hochschulen, Forschungseinrichtungen und um innovative Unternehmen. Deshalb versuchen sich viele Kommunen mittlerweile als Wissenschaftsstandort zu profilieren. Die Autorin geht der Frage nach, was eine Wissenschaftsstadt von einem Wissenschaftsstandort unterscheidet und welche unterschiedlichen kommunalen Strategien sich in diesem Feld unterscheidenlassen.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2012 Städtenetzwerk Lokale Demokratie – Zwischenbilanz
Im Rahmen des Städtenetzwerks haben der vhw und die Kommunen ein Konzept entwickelt, das eine innovative und vielversprechende Form der Bürgerbeteiligung ermöglicht. Nun steht in den kommenden Wochen und Monaten der "Praxistest" bevor. Damit geprüft werden kann, ob das Städtenetzwerk die selbst gesteckten Ziele der stärkeren Integration der Bürgerinnen und Bürger und der Legitimation politischer Entscheidungsfindung mit dem Dialogverfahren erreichen kann, sollen die ersten Bürgerdialoge umfassend evaluiert werden. Im Folgenden wird ein Überblick darüber gegeben, welche Elemente diese Erfolgsmessung enthält, welche Erkenntnisinteressen sie anleiten und welche Erhebungsmethoden eingesetzt werden sollten.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2009 Stadtgesellschaft neu vermessen! – Wie muss die soziale Stadt gestaltet werden?
Nachdem Ende 2007 (qualitative Vorstudie) und im Jahr 2008 (quantitative Hauptstudie) zwei Migrantenmilieustudien mit ebenso spannenden wie teils auch kritisierbaren Erkenntnissen (vgl. Kunz 2008) aufwarteten, legt der vhw nun seine Ergebnisse vor. Jenseits der Detailfragen, die sowohl Design als auch Ergebnisse dieser vertiefenden Milieustudie sicherlich aufwerfen werden, gilt es, aus integrationspolitischer Sicht einige grundsätzliche Aspekte aufzugreifen und zu kommentieren.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2011 Neue Dialogkultur: Wir sprechen uns im Web 2.0
Seit den siebziger Jahren ist die Beteiligung der Öffentlichkeit an städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen gesetzlich vorgeschrieben. Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sollen frühzeitig Stellungnahmen und Anregungen zu Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen abgeben können. Ähnliches gilt inzwischen für die Raumplanung, Umweltverträglichkeitsprüfungen und andere Verfahren. Daneben haben sich Gebietskörperschaften in mehreren internationalen Abkommen zu mehr Bürgerbeteiligung in der Umweltpolitik verpflichtet und werden von Organisationen wie dem Rat der Regionen im Europarat oder der OECD dazu aufgerufen.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2017 Die Digitalisierung des Städtischen

Erschienen in Heft 3/2025 Infrastrukturen in ländlichen Räumen
Die Preise für – voll erschlossenes – Bauland in den Regionen mit angespannten Wohnungsmärkten sind in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren um das Doppelte bis Dreifache gestiegen. Dies führt neben den gestiegenen Herstellungskosten (Baukosten) und Kapitalkosten (Zinsen) für den Wohnungsbau dazu, dass Wohnraum für große Teile der Bevölkerung trotz staatlicher Transferleistungen (Wohngeld, Kosten der Unterkunft) kaum noch bezahlbar ist, weil die Belastung der Haushalte mit Wohnungskosten mancherorts mittlerweile bis zu 50 % des Haushaltsnettoeinkommens erreicht (Mietbelastung in Deutschland, DIW Berlin, Oktober 24). Allein die Grundstücks- und Erschließungskosten, aus denen sich die Baulandpreise (im Zuge der wachsenden Anwendung von Baulandmodellen nach § 11 BauGB) in der Regel zusammensetzen, machen vielerorts ein Viertel bis ein Drittel der Gesamtgestehungskosten für den Wohnungsneubau aus. Warum ist das so?
Beiträge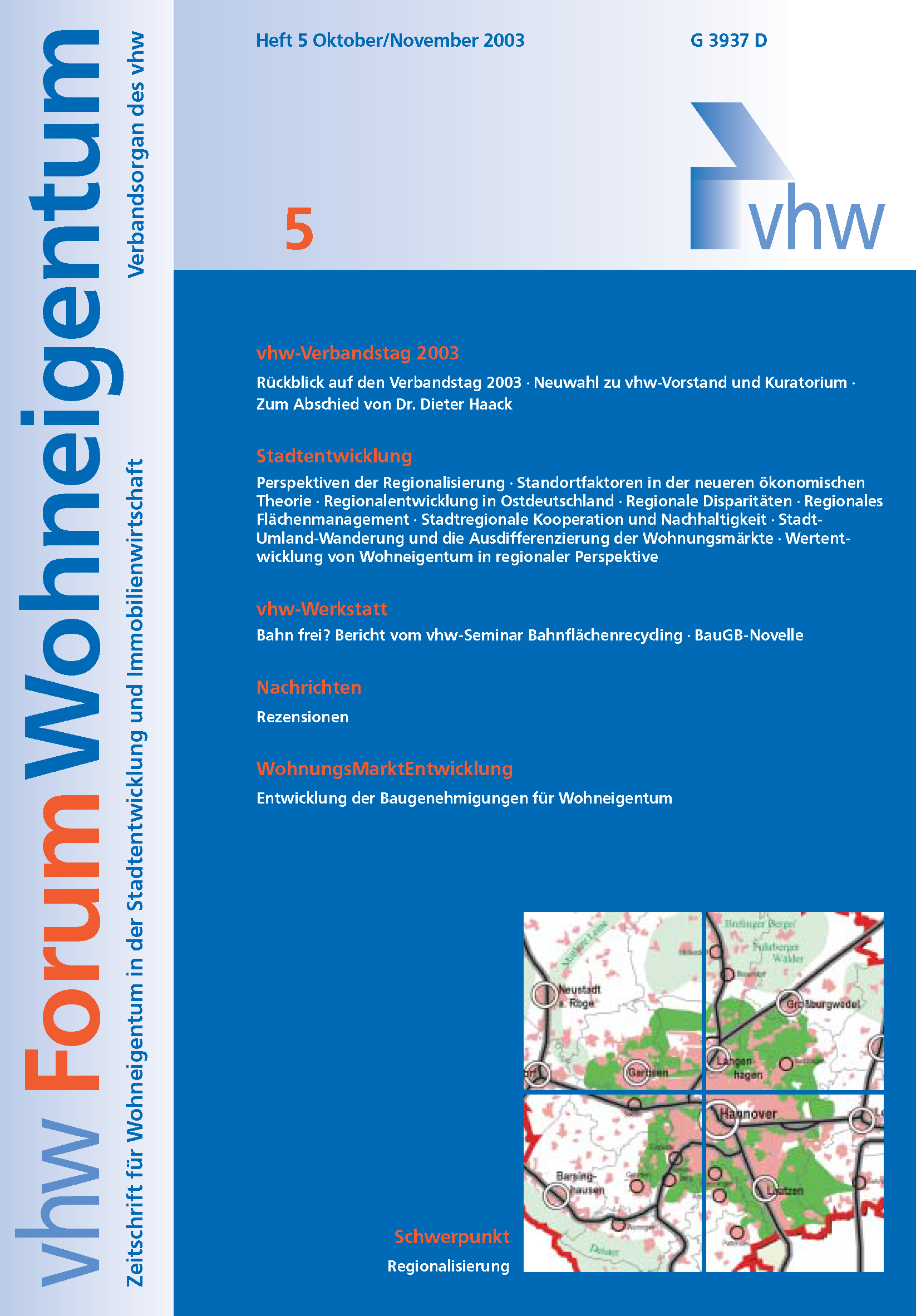

Erschienen in Heft 3/2023 Wohneigentum als Baustein für die Wohnungspolitik
Betrachtet man die Situation der Wohneigentumsbildung hierzulande, ist ein Aspekt von zentraler Bedeutung: Wohneigentumsbildung findet mittlerweile ganz überwiegend im Bestand statt. Dieser Umstand ist für eine adäquate Analyse und Ableitung geeigneter politischer Maßnahmen zur Stärkung der Wohneigentumsbildung unumgänglich. Die Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, mehr Menschen in Deutschland das Wohnen im selbst genutzten Wohneigentum zu ermöglichen. Dennoch spielt die Rolle des Bestands für die Wohneigentumsbildung in den aktuellen wohnungspolitischen Maßnahmen der Bundesregierung eine eher untergeordnete Rolle. So wird die neue Wohneigentumsförderung, die ab Mitte 2023 starten soll, auf den Neubau mit übergesetzlichen Standards beschränkt sein. Vor diesem Hintergrund betrachten wir in diesem Beitrag die Bedeutung des Bestandserwerbs für die Wohneigentumsbildung und veranschaulichen damit einhergehende Herausforderungen sowie mögliche geeignete Strategien und Bausteine für eine bestandsbezogene Wohneigentumsförderung.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2020 Klimaanpassung im Stadtquartier
In einer Pressemitteilung vom Mai 2020 macht die pantera AG, ein auf die Projektentwicklung von sog. Serviced Apartments spezialisiertes Unternehmen aus Köln, mit der Nachricht auf: "Jeder Zweite würde im Alter in eine kleinere Wohnung ziehen – über 10 Mio. m2 Wohnreserven in den Städten würden auf diese Weise frei." In Zeiten, in denen vor allem in Großstädten und Ballungsräumen ausreichender und bezahlbarer Wohnraum für viele Familien Mangelware ist und die Entwicklung von Neubauvorhaben viel Planungszeit in Anspruch nimmt, wäre es interessant, ob nicht bereits durch eine bessere Verteilung der vorhandenen Wohnflächen ein wirksamer Beitrag zur Befriedigung der Wohnungsnachfrage geleistet werden kann.
Beiträge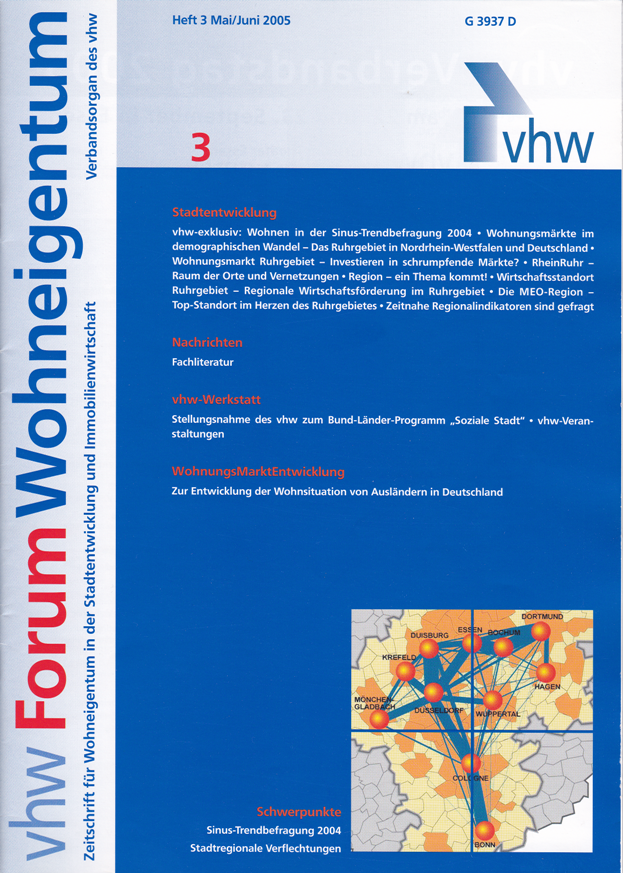
Erschienen in Heft 3/2005 Sinus-Trendforschung 2004; Stadtregionale Verflechtungen
Nach der Premiere in 2003 hat sich der vhw im Herbst 2004 erneut mit wohnungsspezifischen Fragen an der jährlichen Trendbefragung des Heidelberger Institutes Sinus Sociovision beteiligt. Auf der Grundlage der vorliegenden Ergebnisse können nunmehr konturierte Wohnprofile der Sinus-Milieus erstellt werden. Einen wichtigen Teil der Befragung bildeten diesmal Themen, die sich mit der Wahrnehmung und Wirkung von Problementwicklungen im Wohnungsbereich beschäftigten. Aufschlussreiche Erkenntnisse wurden zudem im Themenfeld "potentielle Umzugstreiber" gewonnen. Der Beitrag stellt einige ausgewählte Ergebnisse vor.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2014 Wohnen in der Stadt – Wohnungspolitik vor neuen Herausforderungen

Erschienen in Heft 2/2020 Quartiersentwicklung und Wohnungswirtschaft
Das derzeitige Wohnungsneubauvolumen bleibt – insbesondere in den größeren Städten – weit hinter den aktuellen Bedarfen zurück. Seit Jahren werden immer wieder Statistiken publiziert, die auf den eklatanten Neubaubedarf hinweisen. Nimmt man das Neubauvolumen des Jahres 2018 und setzt es ins Verhältnis zum Bedarf, so schwanken die Quoten – je nach Großstadt – zwischen 46 % (Köln) und 86 % (Düsseldorf und Hamburg). Der Durchschnitt der A-Städte liegt bei 71 %, was bedeutet, dass derzeit nur etwa 71 % des Neubauvolumens erbracht wird, das eigentlich benötigt wird.
Beiträge
Erschienen in
In den letzten Jahren sind verschiedentlich Bemühungen der Wissenschaft um eine Verknüpfung von Lebensstilen und Wohnstandortwahl festzustellen. In dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt "StadtLeben" werden die Zusammenhänge zwischen Lebensstilen und räumlicher Mobilität vertieft empirisch untersucht. Im Folgenden werden methodisches Vorgehen und erste Erkenntnisse des Projektes vorgestellt.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2015 Einfamilienhäuser der fünfziger bis siebziger Jahre
Sind die Einfamilienhausgebiete der 1950er bis 1970er Jahre aus der Zeit gefallen? Sie stecken in einer „Homogenitätsfalle“ (Menzl 2010), atmen den architektonisch-städtebaulichen Geist ihrer jeweiligen Entstehungszeit und dokumentieren die gesellschaftlich favorisierten Wohnvorstellungen dieser Zeit. Zielgruppe des Einfamilienhauses war die Zweigenerationenfamilie aus Eltern und Kindern. Beim Zweifamilienhaus zogen nicht selten die Großeltern mit ein, oder die zweite Wohnung diente als Mietwohnung zur Finanzierung des Hauses. Für das eigene Haus als Statussymbol und Familiensitz mit Vererbungsperspektive wurden hohe finanzielle Belastungen in Kauf genommen. Die emotionale Bindung an das eigene Haus im Sinne von „my home is my castle“ ist bei den Ersteigentümern besonders stark ausgeprägt.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2015 Die Innenstadt als Wohnstandort
Die Diskussionen zum demografischen Wandel haben dazu geführt, dass in den zurückliegenden Jahren Erfordernisse zur Schaffung zusätzlichen Wohnraums teilweise aus den Augen verloren gingen und sich thematisch bzw. fachlich zu stark auf die Fragestellungen und Probleme konzentriert wurde, die mit einer „Schrumpfung“ von Städten und mit einer immer älter werdenden Gesellschaft verbunden sind. Neben Schrumpfung oder Stagnation findet in vielen Stadtregionen aber weiterhin ungebremst ein Bevölkerungswachstum statt. Die neue Raumordnungsprognose 2035 des Bundes (BBSR) zeigt auf, dass sich diese Entwicklung in vielen süddeutschen Städten, aber auch in Hamburg und in diversen weiteren westdeutschen Städten bis 2035 fortsetzen wird. Ein Mangel an Wohnraum, insbesondere an preisgünstigem Wohnraum, wird hier immer offensichtlicher. So auch in der Stadt Friedrichshafen.
Beiträge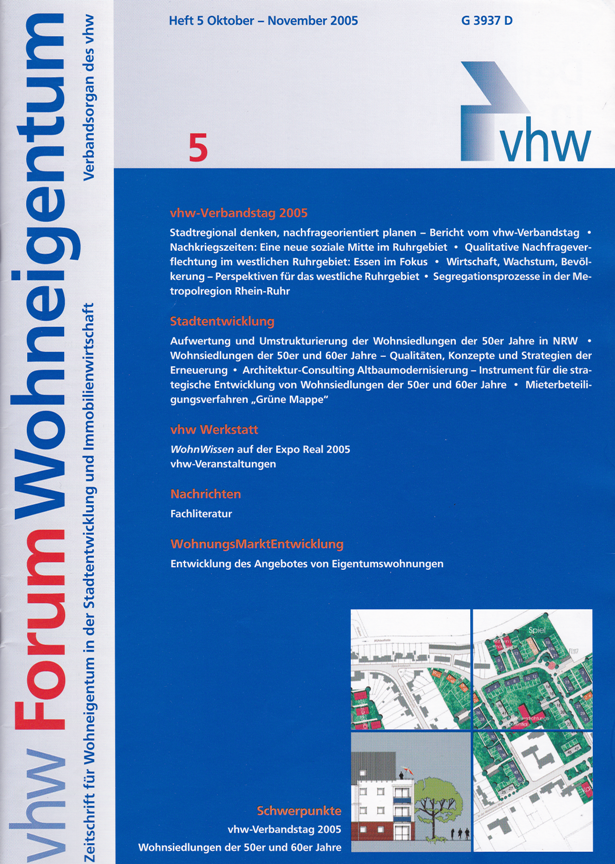
Erschienen in Heft 5/2005 vhw Verbandstag 2005, Siedlungen der 50er und 60er Jahre
Der Artikel beschreibt die in Siedlungen der 50er und 60er Jahre stattfindenden sozialen und gestalterischen Umbrüche sowie damit verbundene Chancen und Konfliktpotenziale. Als Ergebnis langjähriger Forschungserfahrung wurde das Mieterbeteiligungsverfahren "Grüne Mappe" konzipiert. Dieses mehrstufige Verfahren zeichnet sich durch niedrigschwellige Beteiligungsangebote sowie durch eine starke Kommunikationsorientierung aus. Ziel des Verfahrens sind nicht nur die dadurch gewonnenen Gestaltungsvorschläge sondern ebenso die in der Nachbarschaft initiierten kurz- und langfristigen Prozesse.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2021 Verkehrswende: Chancen und Hemmnisse
Die Konzeption von Neubauquartieren beinhaltet neben der Planung von Gebäuden selbstverständlich die Planung von Straßen, Wegen und Plätzen. Eine intelligente Wegeführung und das Ziel einer bequemen Erreichbarkeit aller Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen innerhalb des Quartiers sowie die optimale Anbindung an ein übergeordnetes städtisches und regionales Verkehrsnetz sind essenziell für das Wohlbefinden der Bewohner in zukunftsfähigen Quartieren – dies ist zunächst keine neue Erkenntnis. Wohnstandortbezogene Mobilitätskonzepte gehen allerdings einen Schritt weiter und verknüpfen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), private Verkehrsmittel, wie Zweirad oder Pkw, und Mobilitätsbausteine, wie Carsharing, Lastenradsharing, die Flexibilisierung von Stellplätzen sowie ein zentrales Mobilitätsmanagement. Sie sind immer häufiger tragende Säule einer modernen Siedlungsentwicklung.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2019 Digitale Verwaltung
Das Quartier verliert auch in Zeiten verstärkter Zuwanderung in die Städte nicht an Relevanz. Durch staatlichen Rückzug aus der Stadt- und Quartiersentwicklung werden zukünftig jedoch auch nichtstaatliche Akteure eine zentrale Rolle hinsichtlich lokaler Entwicklungssteuerung einnehmen (müssen). Wohnungseigentümern wird hierbei eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Jedoch ist der wissenschaftliche Kenntnisstand über deren Rolle als Bestandsbewirtschafter hinaus noch recht begrenzt und deren Handeln in einem weiteren Quartierskontext noch wenig systematisch beleuchtet worden. Hier setzt der folgende Beitrag an und leistet einen nötigen Beitrag hinsichtlich einer grundlegenden Diskussion über die verschiedenen Formen wohnungswirtschaftlichen Engagements über den Wohnungsbestand hinaus.
Beiträge
Erschienen in
Im Land Brandenburg standen im Jahr 2002 rund 165.000 Wohnungen leer. Der Leerstandszuwachs seit 1998 ist beträchtlich, insbesondere im Geschosswohnungsbestand der sechziger bis achtziger Jahre sowie im äußeren Entwicklungsraum. Das höchste Leerstandsniveau und die größten Leerstandszuwächse haben die Oberzentren des Landes (außer Potsdam). Bemerkenswert: Auf die Stadtumbaustädte des Landes entfallen 37 Prozent des Leerstandes. Die im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Stadtumbau Ost" zur Verfügung stehenden Mittel erlauben den Abriss von rund 48.000 Wohnungen. Selbst unter der (unrealistischen) Annahme eines nicht weiter steigenden Leerstands könnte der Wohnungsleerstand also mit den vorhandenen Mitteln um weniger als ein Drittel reduziert werden. Insbesondere für die Bewältigung des Leerstandes im ländlichen Raum müssen daher zusätzliche Förderprogramme und Finanzierungshilfen geschaffen werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2005 Stadtregional denken – nachfrageorientiert planen