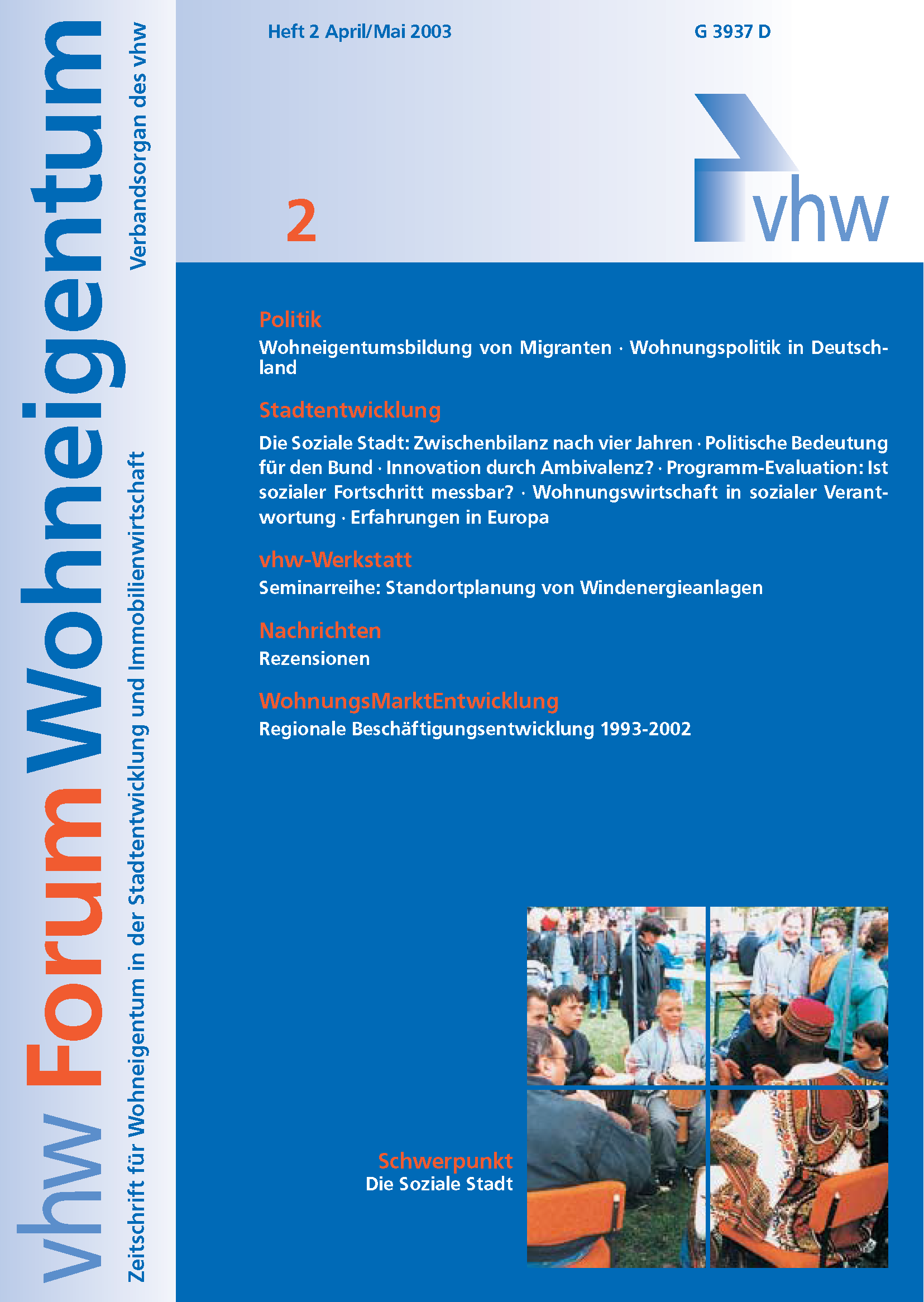
Erschienen in
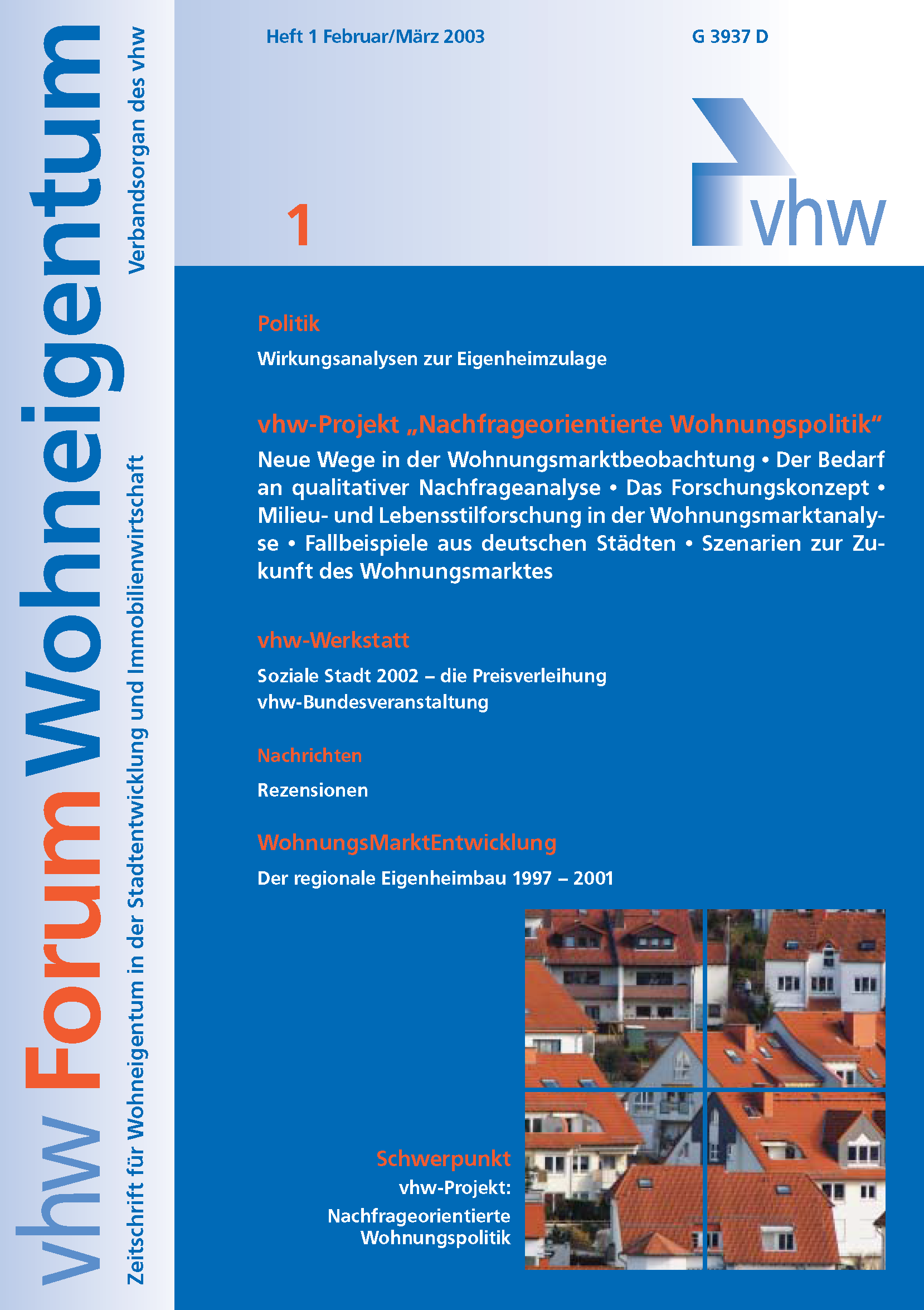
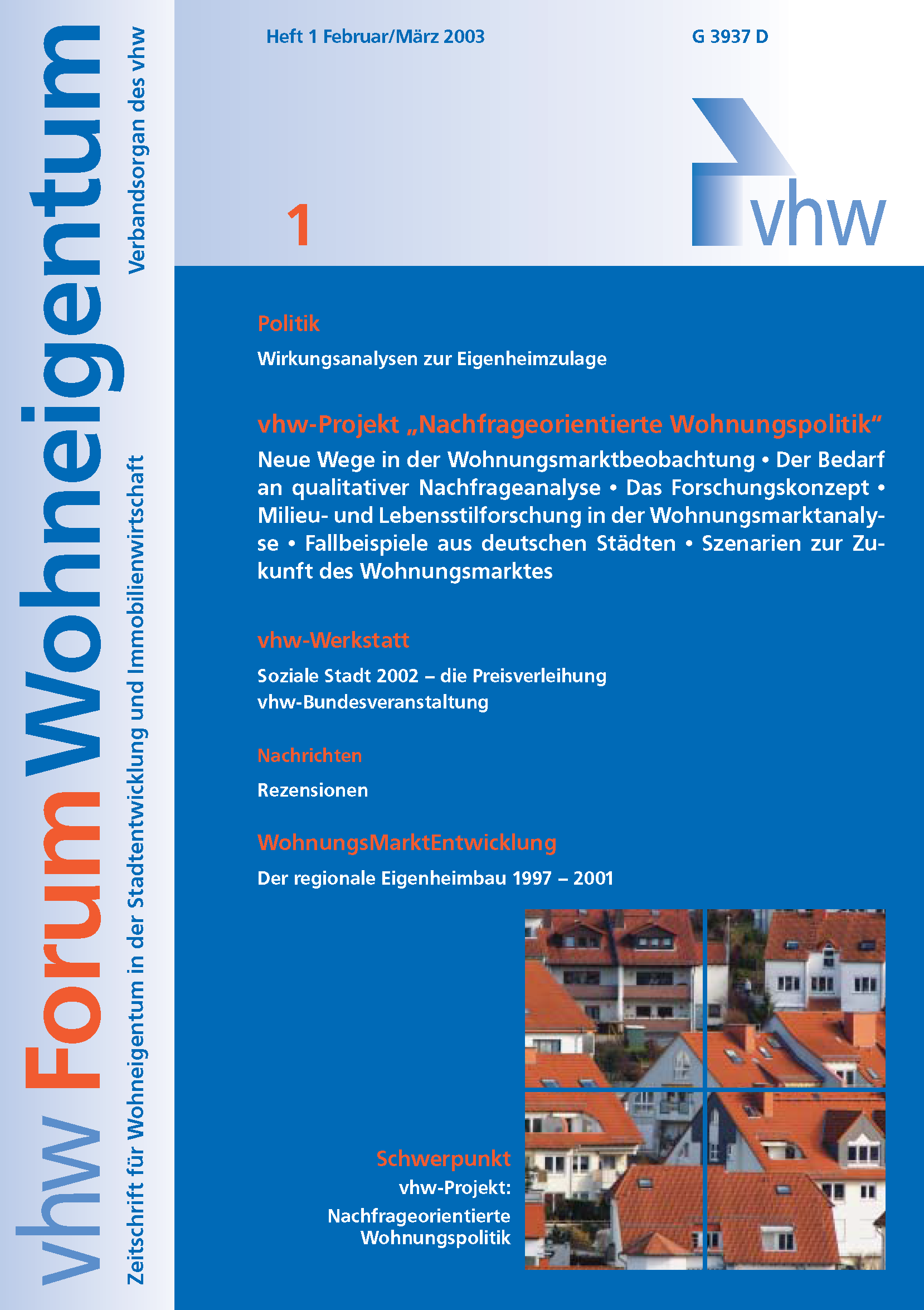
Erschienen in
"Wir freuen uns schon jetzt auf den Preis Soziale Stadt 2004", resümierte Dr. Dieter Haack auf der Preisverleihung im Januar diesen Jahres und nahm dies zugleich zum Anlass, allen Akteuren und teilnehmenden Projekten für ihr erfolgreiches und beeindruckendes Engagement in sozial benachteiligten Stadtteilen zu danken. Die Auslobung fand in diesem Jahr tatkräftige Unterstützung von politischer Seite: Peter Ruhenstroth-Bauer – Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – und Achim Großmann – parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen – kürten die Sieger und machten deutlich, dass die Förderung der "Sozialen Stadt" auch weiterhin ein wesentliches Anliegen der Bundesregierung sein wird. Dies wurde von den Initiatoren des Preises ausdrücklich begrüßt, da die sozialen Spannungen in den Wohnquartieren vielerorts zunähmen und zugleich die finanziellen Handlungsspielräume von Kommunen, Wohnungsunternehmen und Wohlfahrtsverbänden dramatisch schrumpften. Bericht zum Wettbewerb.
Beiträge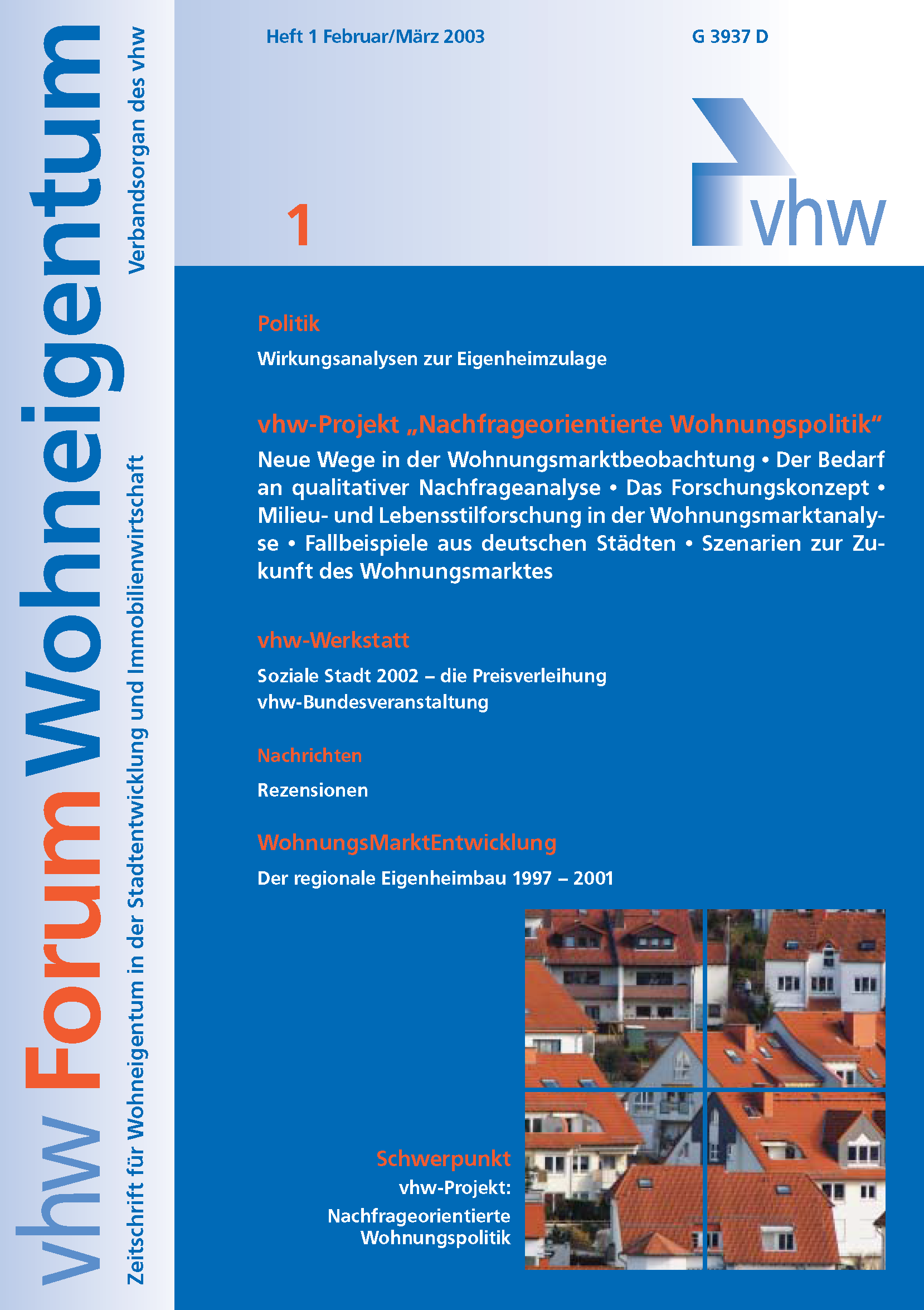
Erschienen in
Der Artikel beschreibt drei Szenarien zur Zukunft des deutschen Wohnungsmarktes, die als strategischer und analytischer Hintergrund im Rahmen des Projektes "Konsumentensouveränität im Wohnungsmarkt" erarbeitet wurden. Die Szenarien wurzeln in der Gegenwart. Sie versuchen, die Fülle der Phänomene und der Beobachtungen im Markt einerseits zu erfassen, andererseits in ihrer Komplexität soweit zu reduzieren, dass die großen, unterschiedlichen und z.T. widerstreitenden Strömungen der Gegenwart in ihren Auswirkungen für die Zukunft erkennbar werden. Die Szenarien sollen so mögliche Zukünfte und damit auch Veränderungspotenziale des Wohnungsmarktes aufdecken. Damit wird eine Grundlage geschaffen, mit der die Strategieentwicklung und Entscheidungsfindung der Akteure im Wohnungsmarkt unterstützt werden kann.
Beiträge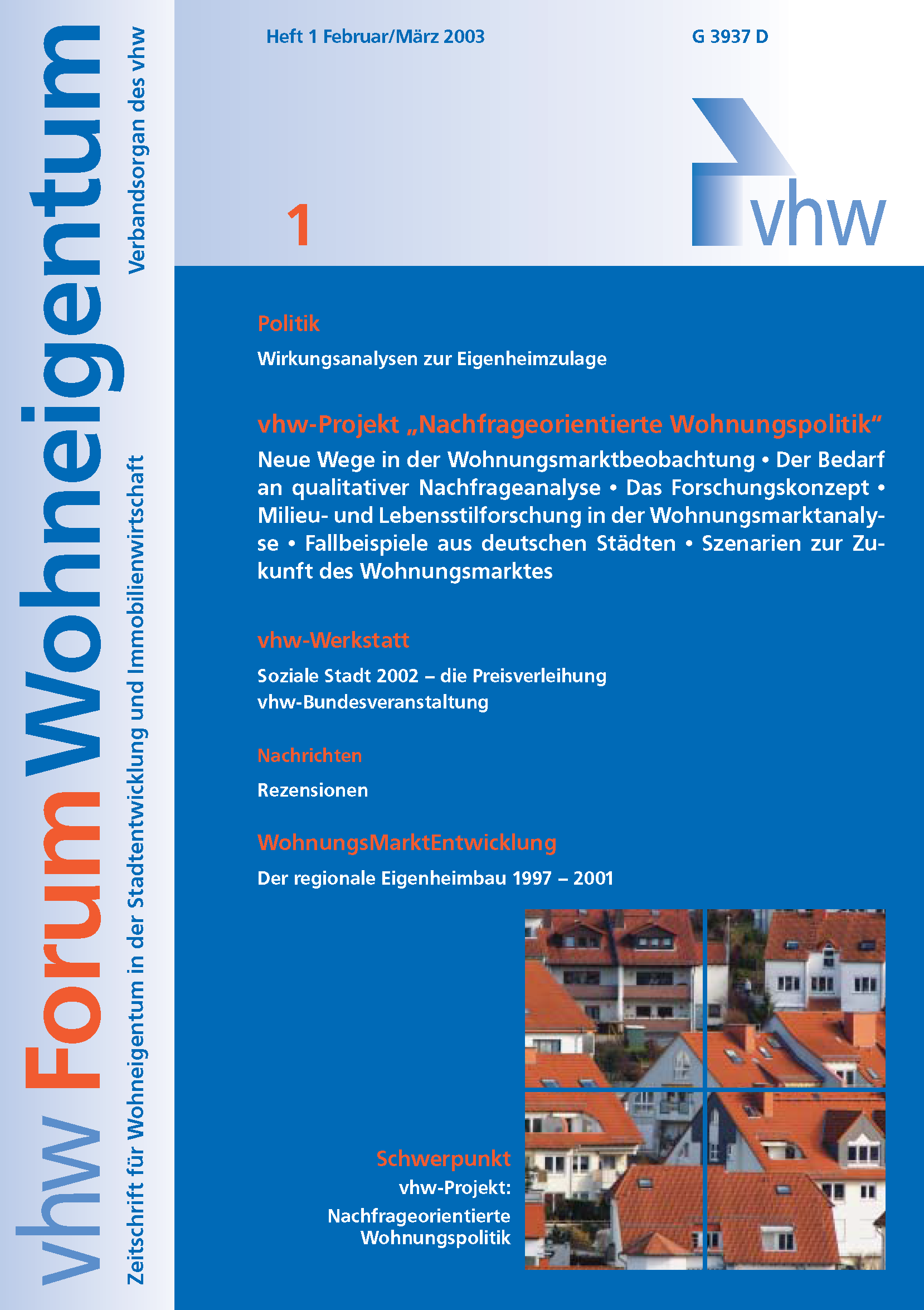
Erschienen in
Die Sinus-Milieus haben sich im Laufe von zwei Jahrzehnten sozialwissenschaftlicher Forschung im Bereich des strategischen Marketings fest etabliert. Auf eine inzwischen mehr als zehnjährige Entwicklung kann auch das Mikromarketing in Deutschland zurückblicken. Ähnlich wie die Sinus-Milieus werden die Methoden des Mikromarketings von Unternehmen aus sehr unterschiedlichen Branchen genutzt, immer mit der Intention, kleinräumige Informationen zu nutzen, um damit das Wissen über die eigenen Kunden zu erhöhen. Die Verknüpfung der beiden Ansätze im Einsatz für den Wohnungsmarkt ermöglicht es, milieuspezifische Erkenntnisse, wie zum Beispiel Zukunftsszenarien, über den Wohnungsmarkt in den Raum zu übertragen. Wie diese Übertragung ermöglicht wird und auf welchen räumlichen Ebenen dies geschieht, wird in diesem Beitrag erläutert.
Beiträge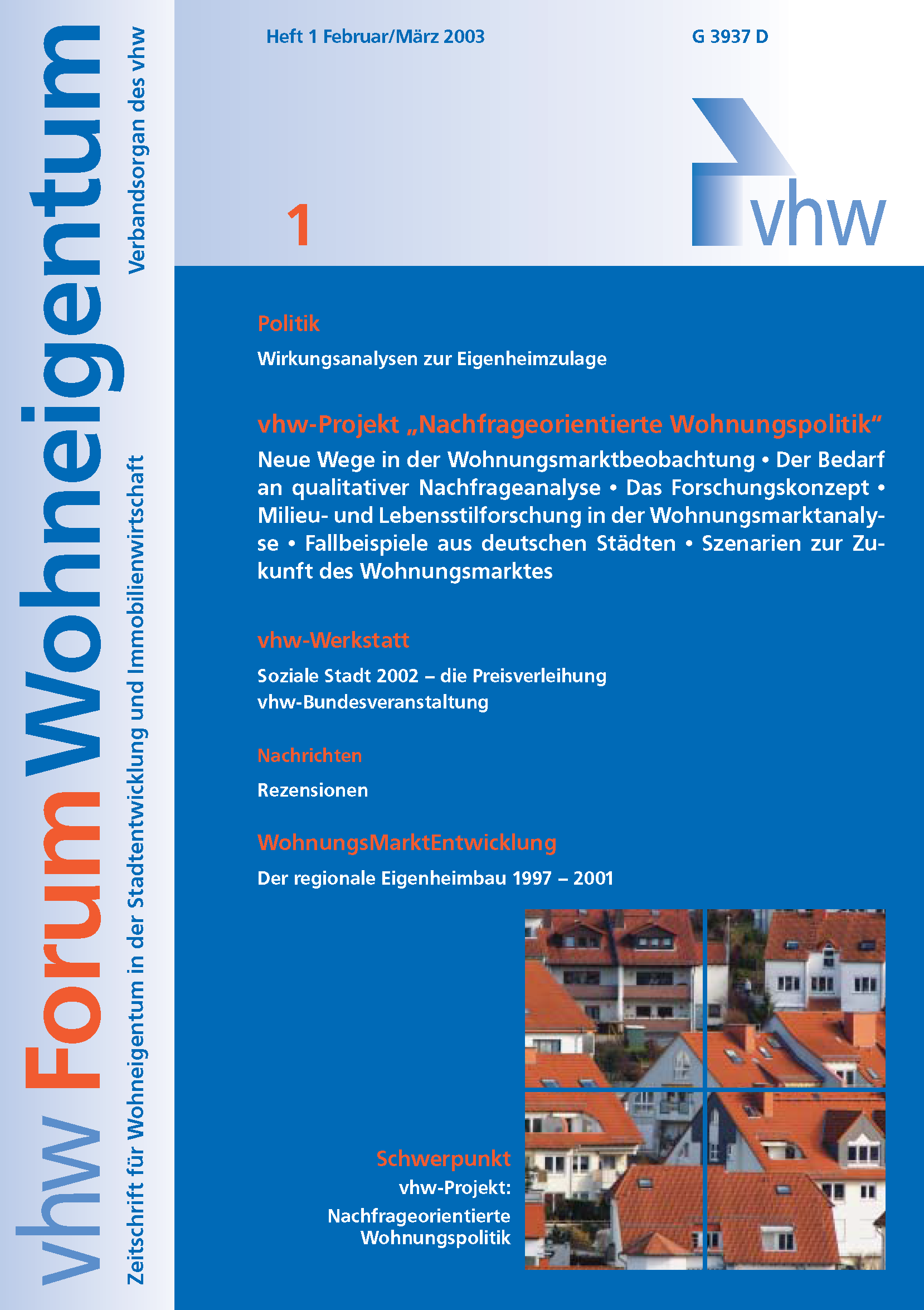
Erschienen in
Im Juli 2002 haben sich der vhw in Berlin, das Fachgebiet Soziologie der Fakultät Raumplanung an der Universität Dortmund und die Firmen Sinus Sociovision (Heidelberg) und microm (Neuss) darauf verständigt, ein ehrgeiziges Projekt zu entwickeln. Hinsichtlich seiner Konzeption unterscheidet sich das Projekt „nachfrageorientierte Wohnungspolitik“ von anderen Projekten vornehmlich in zwei Punkten: der Vernetzung von Lebensstilkonzepten bzw. Milieuansätzen mit den „harten“ Daten der konventionellen Wohnungsmarktbeobachtung undder Kleinräumlichkeit sowohl von Untersuchungsebene als auch von Aktionsebene im Rahmen einer nachfrageorientierten Wohnungspolitik (vgl. den Beitrag von Klaus M. Schmals "Nachfrageorientierte Wohnungspolitik – Forschungskonzept" in diesem Heft, Seite 13ff.). Der Anspruch des Vorhabens verweist auf eine experimentelle Vorgehensweise. Ziele des Projektes werden nicht allein Handlungsempfehlungen für eine nachfrageorientierte Wohnungspolitik, sondern gleichsam die Entwicklung eines neuen Instrumentariums zur Beobachtung von Wohnungsteilmärkten in Städten (Monitoringsystem) sein.
Beiträge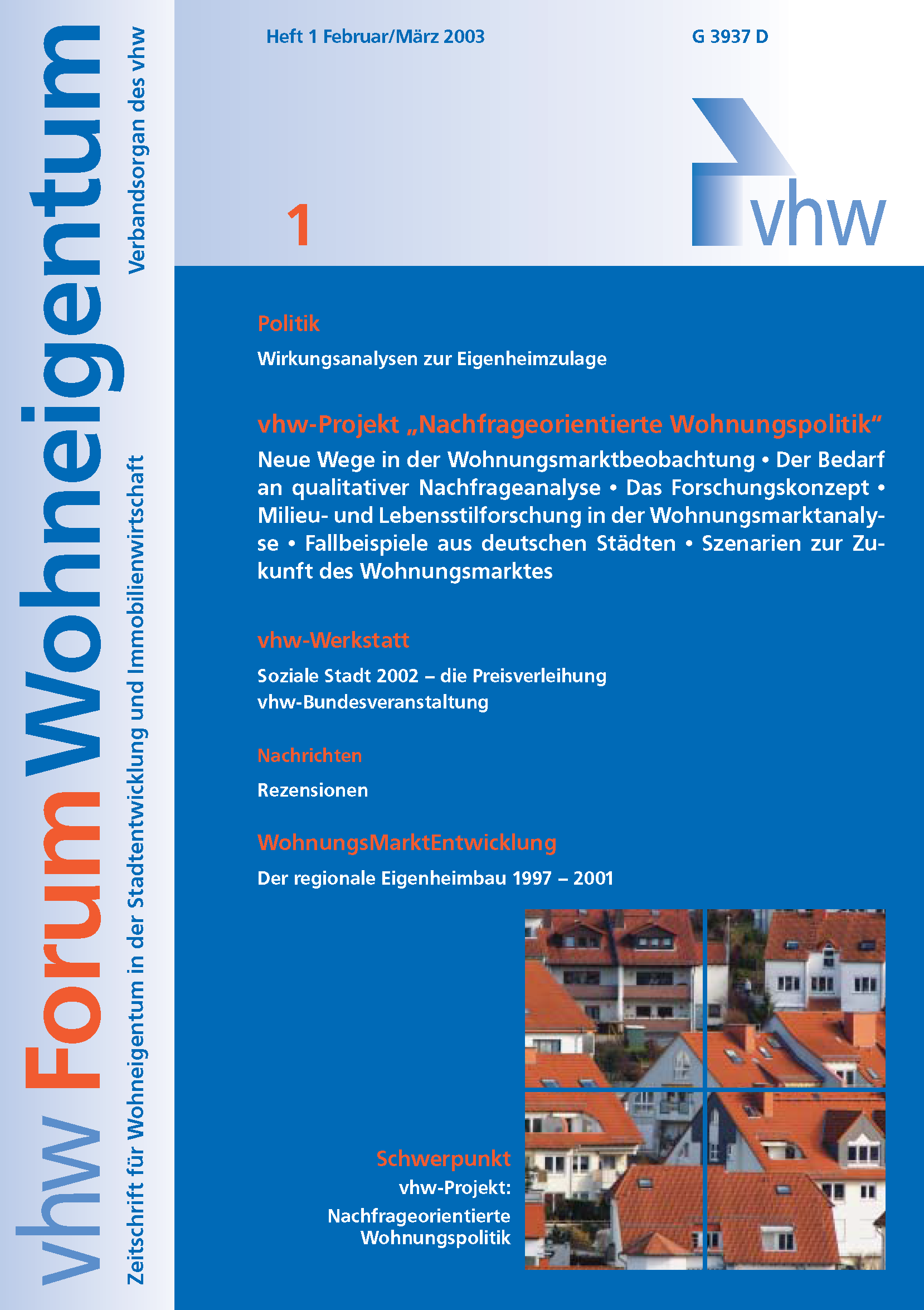
Erschienen in
Im Projekt "Nachfrageorientierte Wohnungspolitik" wird die in den lokalen Raum übertragene Milieulandschaft des Heidelberger SINUS-Institutes mit vorhandenen kommunalstatistischen Daten verknüpft. Angestrebt wird eine flächendeckende Interpretation von nachfragebezogenen Wohnungsmarktzusammenhängen, welche künftig als anwendungsorientierte Entscheidungshilfe für die Akteure dienen soll. Zur Umsetzung und Überprüfung des Ansatzes wurden zunächst vier Städte ausgewählt, die unterschiedliche Wohnungsmarkttypen repräsentieren. Der Beitrag bietet einen knappen Überblick über die Wohnungsmarktlage der "Modellstädte" und deren Perspektiven.
Beiträge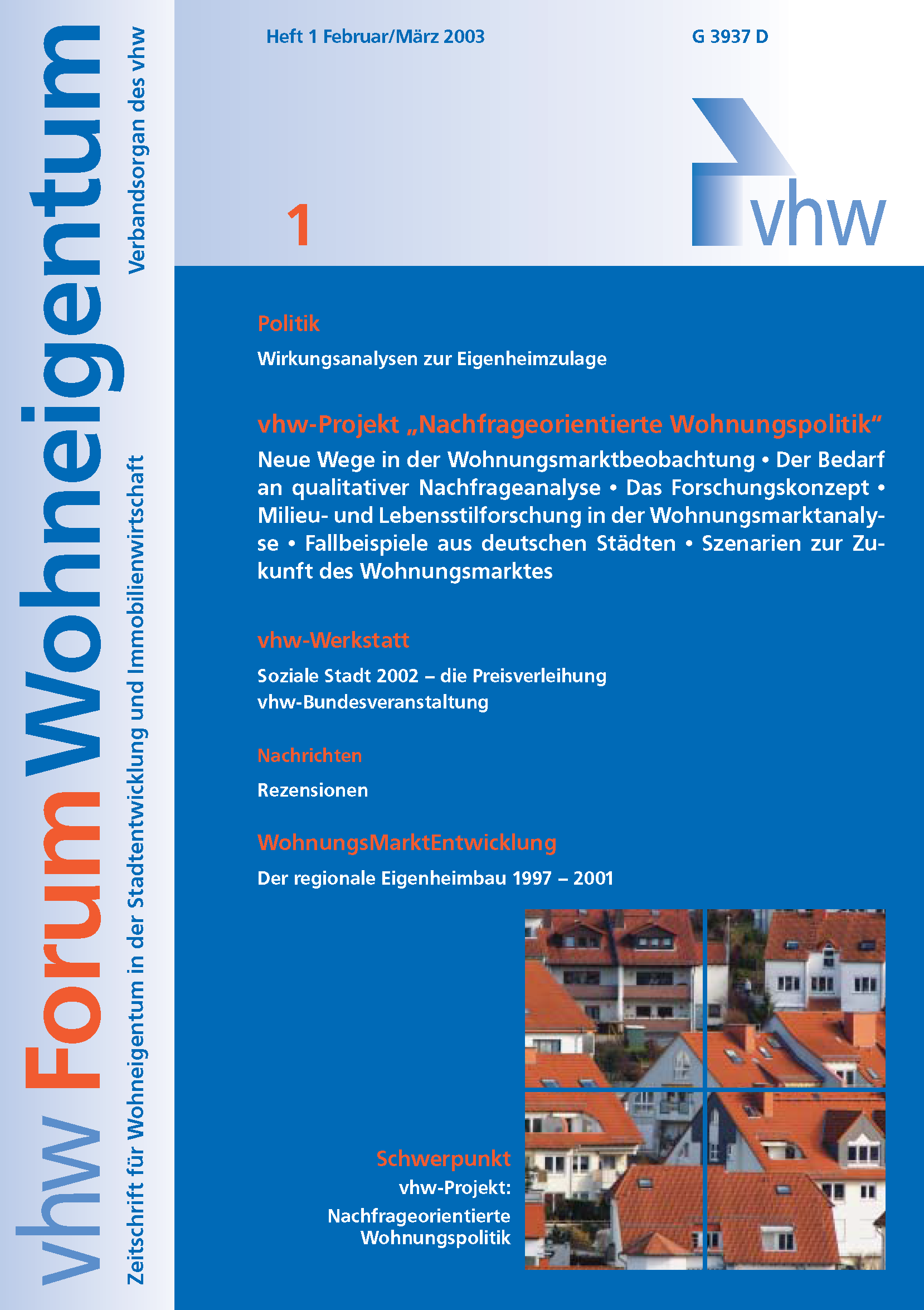
Erfolgreiche Produktplanung und Kommunikation, erfolgreiches Agieren im öffentlichen, wirtschaftlichen und politischen Raum setzt heute umfassende Zuwendung zum Verbraucher oder Bürger voraus. Auch im Wohnungsmarkt muss in Bezugs- und Zielgruppen gedacht werden – dies bedeutet weit mehr als die Klassifikation mittels herkömmlicher soziodemografischer Merkmale. Mit den Sinus-Milieus (Sinus Sociovision Heidelberg), die Menschen mit ähnlichen Wertprioritäten und Lebensstile klassifiziert, steht ein Modell zur Verfügung, das diesem Anspruch gerecht wird, erprobt ist, vielfach angewendet wird, empirisch abgesichert ist, Märkte und Lebensräume überspannt und in viele planungsrelevante Instrumente und Datenzusammenhänge übersetzt wurde.
Beiträge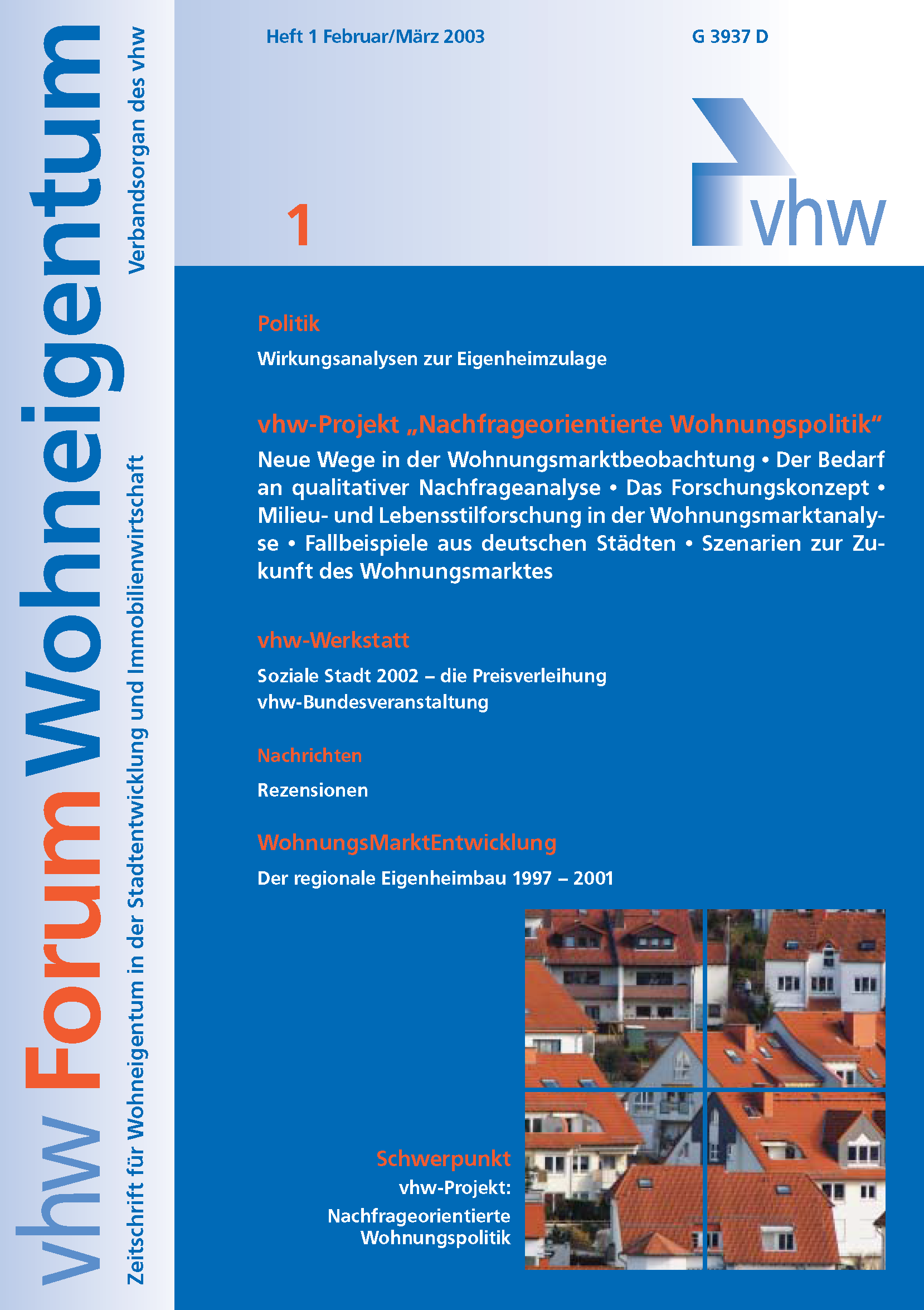
Die Entwicklung der Wohnungspolitik in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg lässt sich chronologisch in acht Phasen darstellen. Charakteristisch ist ein Paradigmenwechsel bzw. ein Wandel der Wohnungspolitik hin zu mehr Marktorientierung – ohne dass dieser immer konsequent vollzogen worden ist. Generell wird heute eine Reflexion über die prinzipielle Rolle des Staates innerhalb der Wohnungspolitik vermisst. Eine Entscheidung zwischen "mehr Markt" und/oder "mehr Staat" fällt da nicht leicht. Sie ist umso schwieriger, da die Wohnungspolitik in Deutschland vielschichtig mit anderen Bereichen der Gesellschaft vernetzt ist. Insbesondere die Vermögenspolitik (Eigenheimbau und Eigenheimerwerb) nimmt einen hohen Stellenwert in diesem Politikfeld ein. Die Eigentumspolitik eröffnet dabei die Chance zu mehr Nachfrageorientierung in der Wohnungspolitik.
Beiträge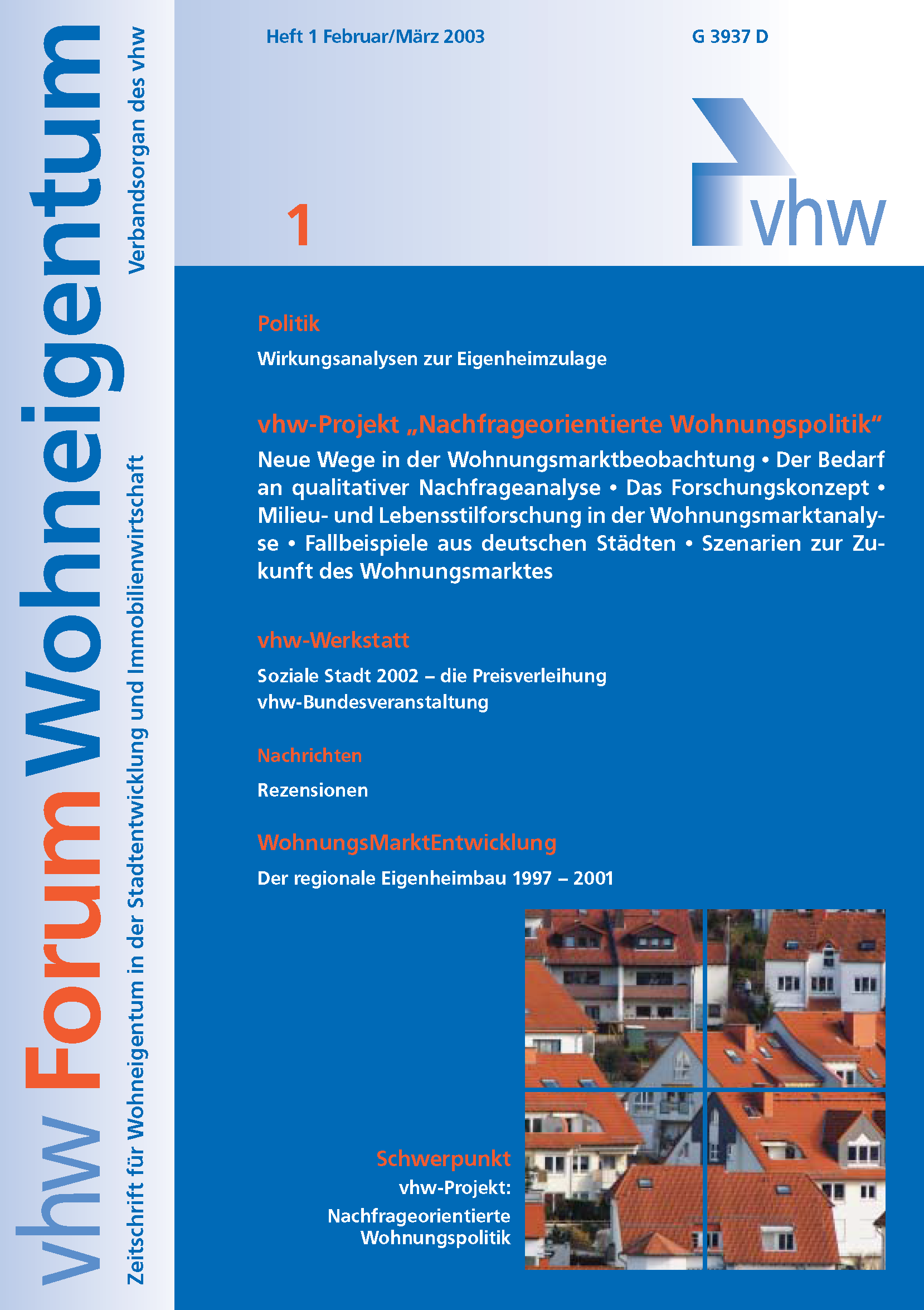
Erschienen in
Die Entwicklung der bundesrepublikanischen Wohnungsmärkte zeichnet sich zurzeit u.a. durch Wohnungsleerstände (vor allem in den ostdeutschen Bundesländern und in altindustrialisierten Lebensräumen), durch angespannte Wohnungsmärkte (u.a. in München) und durch die Forderung nach Baulandausweisungen (insbesondere in den Umlandgemeinden vieler Großstädte) aus. Diese unübersichtliche und widersprüchliche Entwicklung stellt viele Wohnungsbauunternehmen in ökonomischer und unternehmenspolitischer Hinsicht vor große Herausforderungen. Es trifft sie zu diesem Zeitpunkt besonders hart, da viele Wohnungsbauunternehmen nicht nur durch Altschulden belastet sind, sondern auch vor notwendigen Modernisierungsinvestitionen stehen. Viele Wohnungsbauunternehmen sehen sich mit der Frage konfrontiert‚ wie sich ihr Wohnungsbestand nachfrageorientiert und marktorientiert verbessern lässt.Im Zentrum unserer Überlegungen steht ein in vielfacher Hinsicht souveräner werdender Konsument auf den Teilmärkten des Wohnungsmarktes.
Beiträge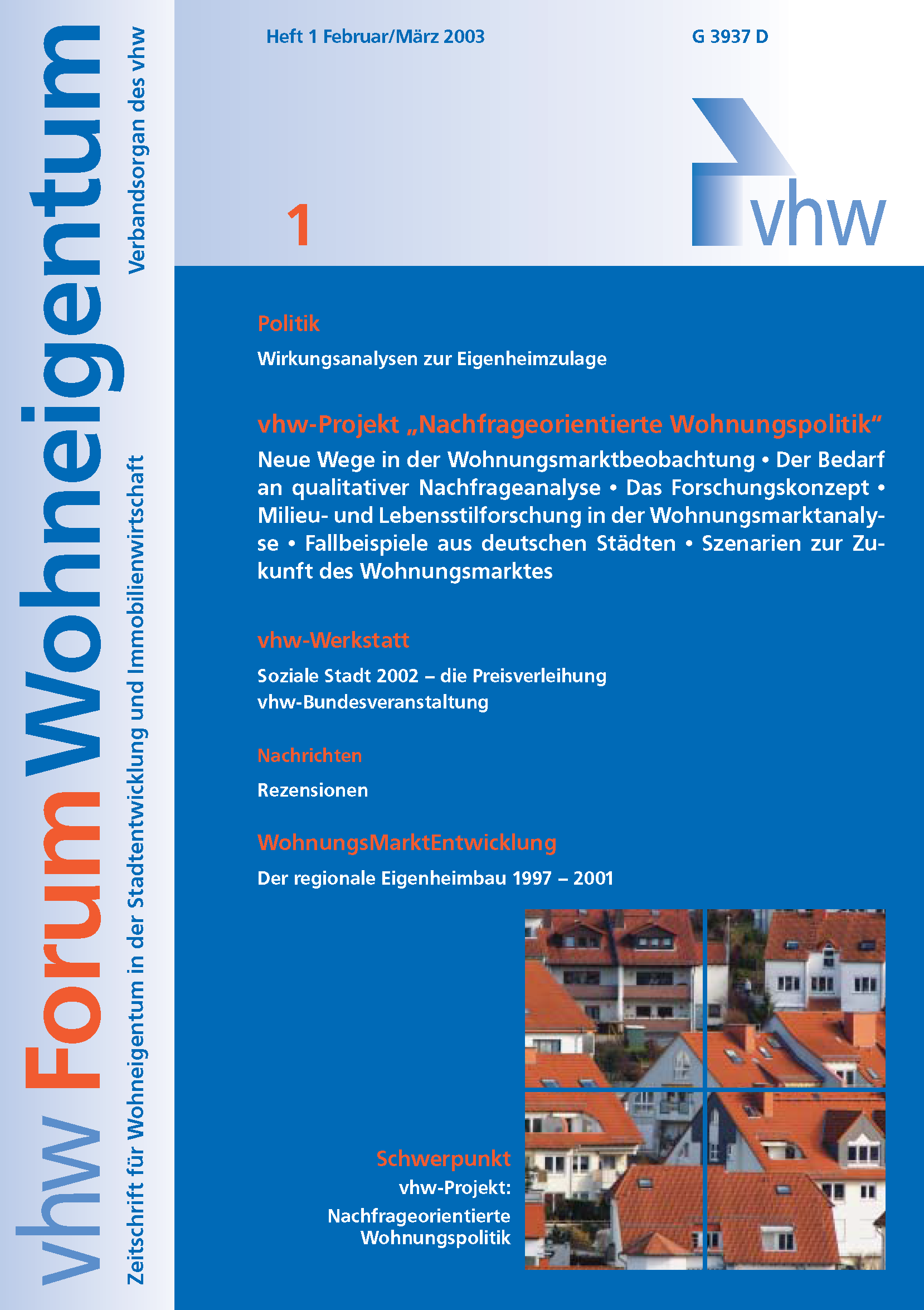
Erschienen in
Der Wandel der Wohnungsmärkte erhöht die Informationsbedarfe der Unternehmen dramatisch. Ursächlich sind hierfür die quantitative Entwicklung an zunehmend heterogener werdenden regionalen Märkten und Änderungen im Nachfrageverhalten. Aber auch der Wandel der Unternehmen von versorgungsorientierten, "administrativen" Organisationen hin zu wertorientierten Portfoliomanagern führt zu einem stetig wachsenden Bedarf an aktuellen und differenzierten Informationen über das Marktgeschehen und seine Entwicklung.
Beiträge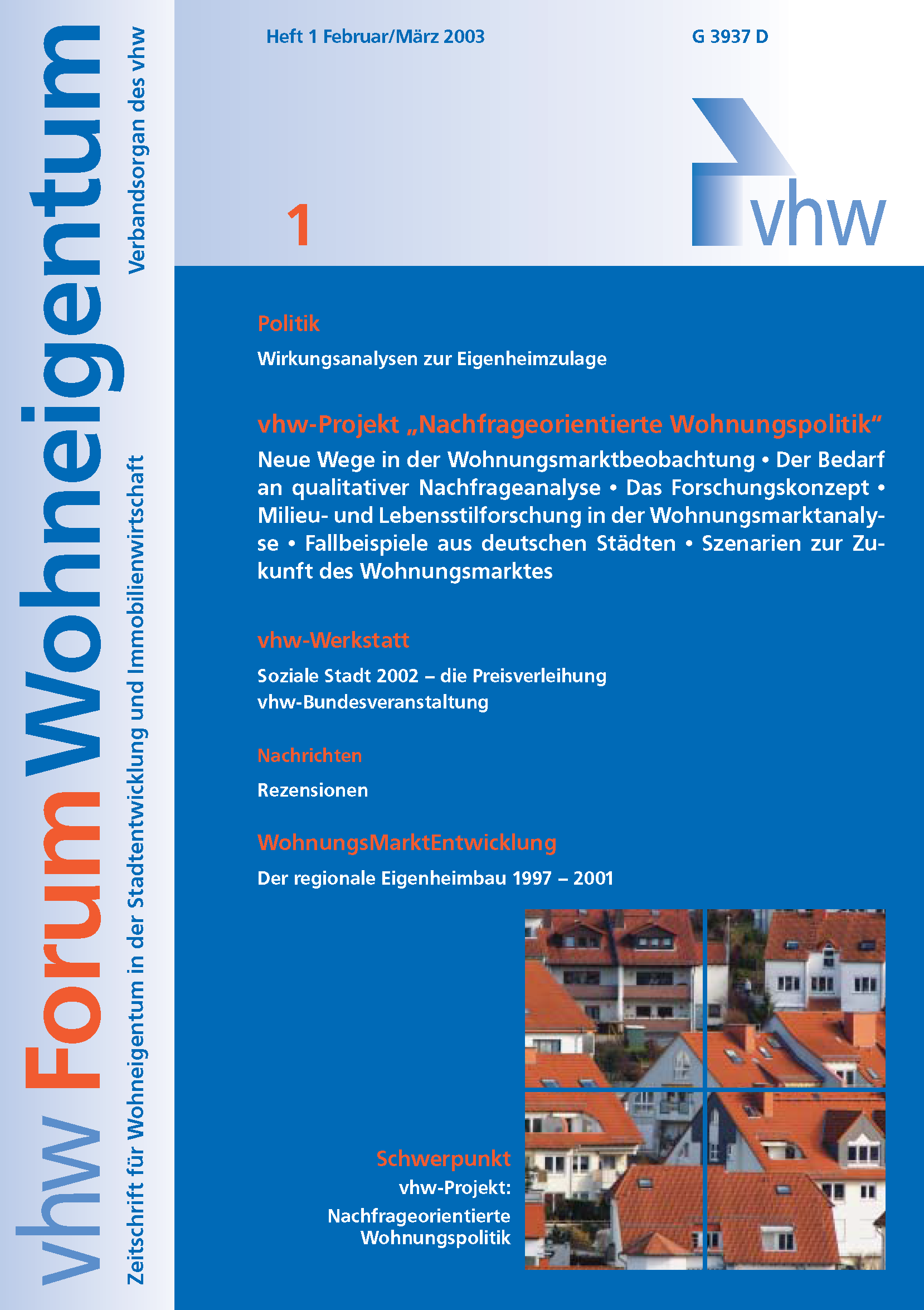
Erschienen in
Kommunale Wohnungspolitik braucht nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen. Die konventionelle Wohnungsmarktanalyse, die sich allein an Zahl und Größe der Haushalte und ihrer Kaufkraft orientiert, reicht heute nicht mehr aus. Die Stadt Essen beteiligt sich daher an dem Projekt "Nachfrageorientierte Wohnungsmarktpolitik".
Beiträge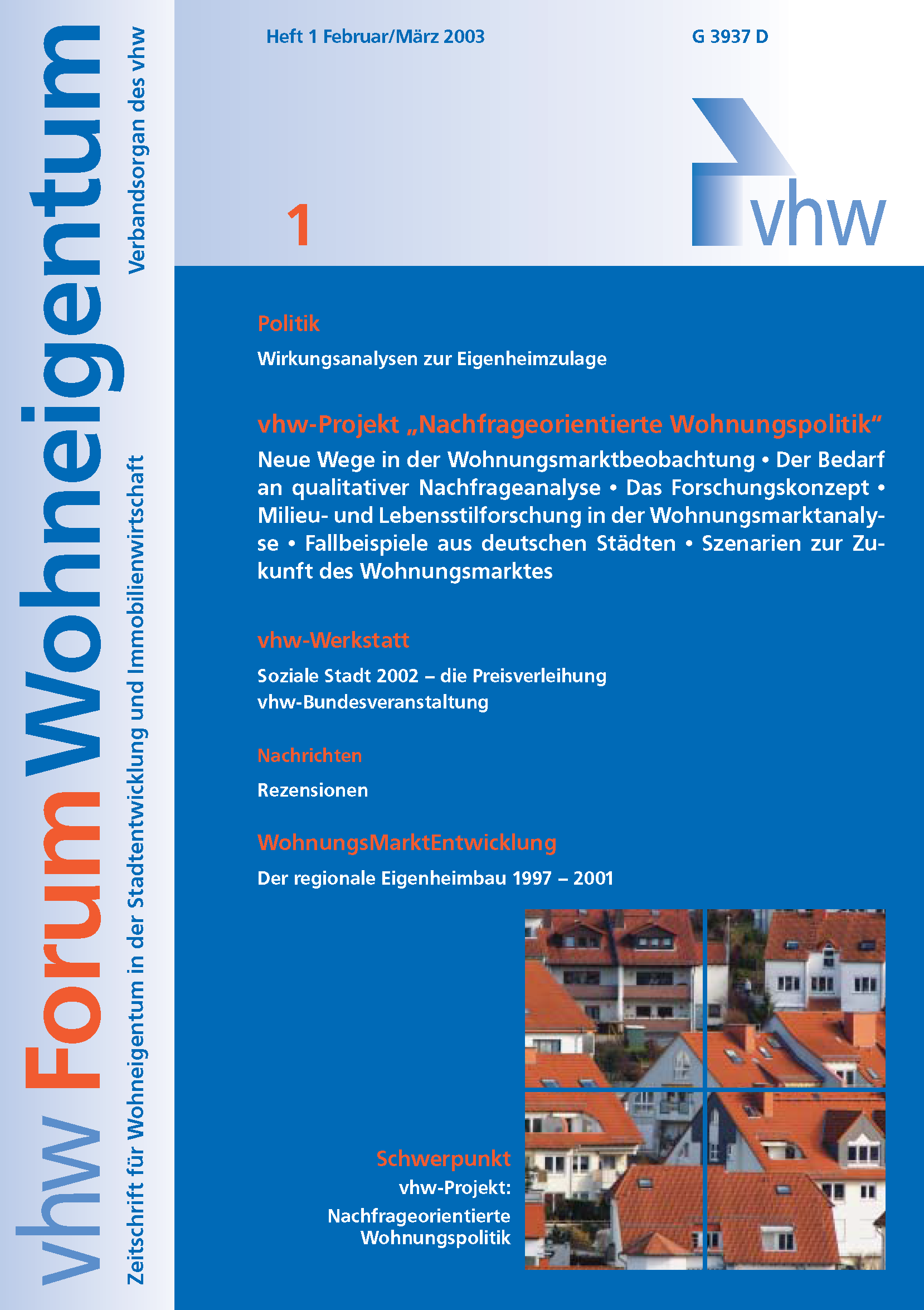
Erschienen in
Das Gesetz der Bundesregierung zur Reform der Eigenheimzulage wurde vom Bundestag bereits verabschiedet (Steuervergünstigungsabbaugesetz). Das Votum der Bundesländer wird im März erwartet. Dies gibt Anlass, die zentralen Aussagen aus den bisher einzigen umfassenden Analysen zur Inanspruchnahme der Eigenheimzulage darzustellen. Beide Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen und Schlussfolgerungen. Unerlässlich für eine politische Interpretation ist daher eine detaillierte Auseinandersetzung mit den empirischen und den methodischen Grundlagen der beiden Untersuchungen. Exemplarisch für die Differenzen werden in dem Beitrag die unterschiedlichen Analysen zur Zielgenauigkeit und der einzelwirtschaftlichen Auswirkungen der Eigenheimzulage aufbereitet und teilweise durch neue Berechnungen ergänzt.
Beiträge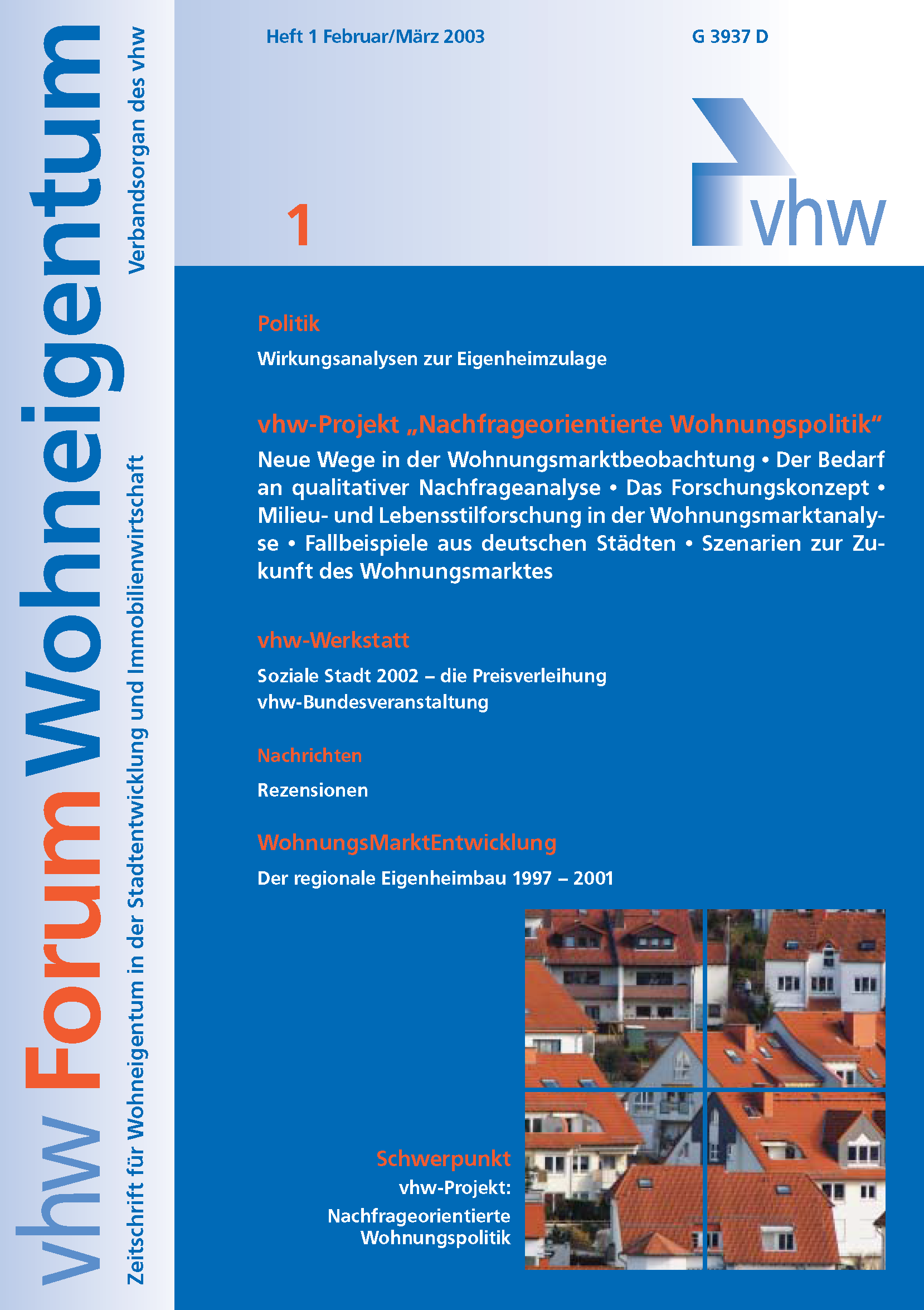
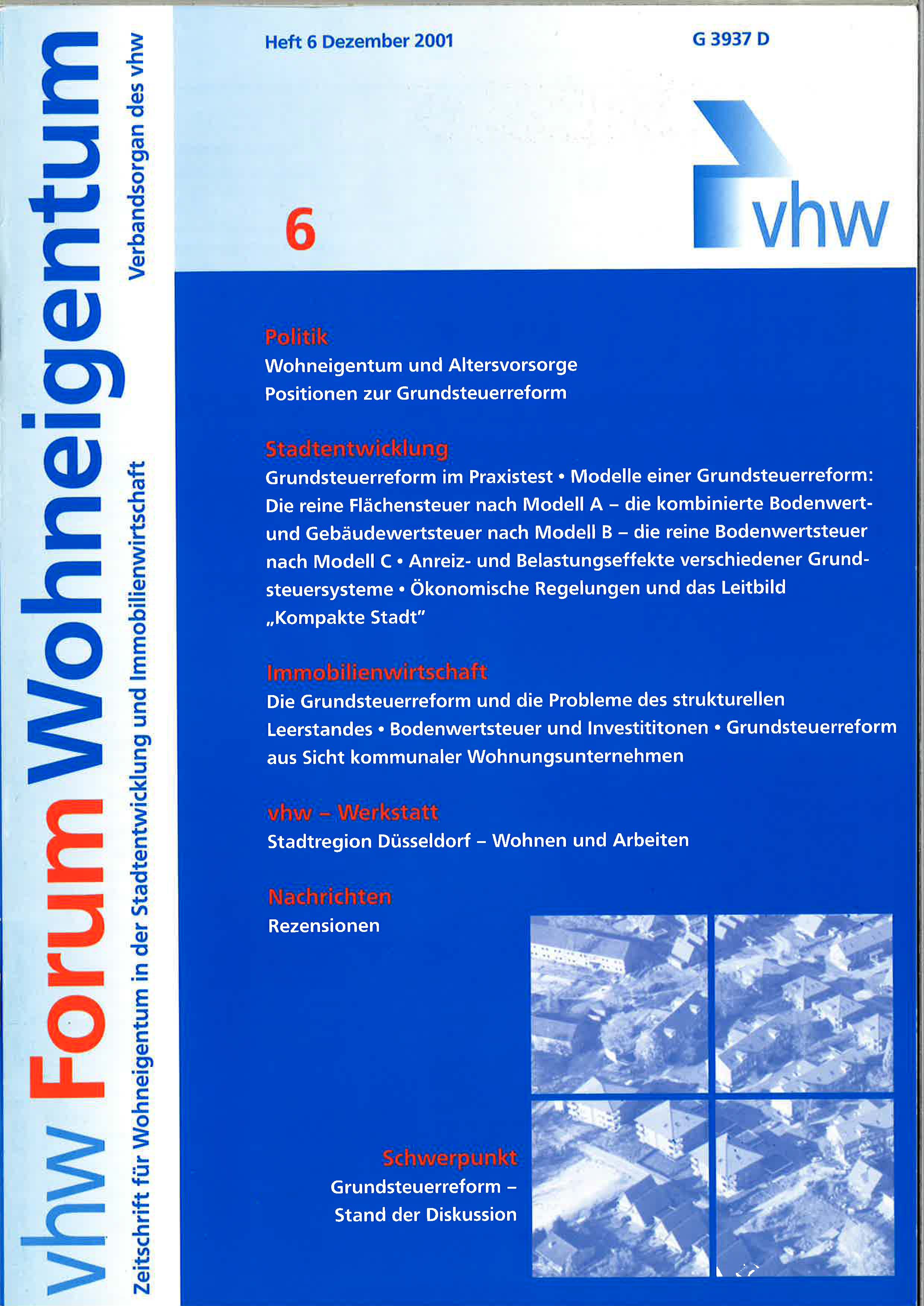
Erschienen in
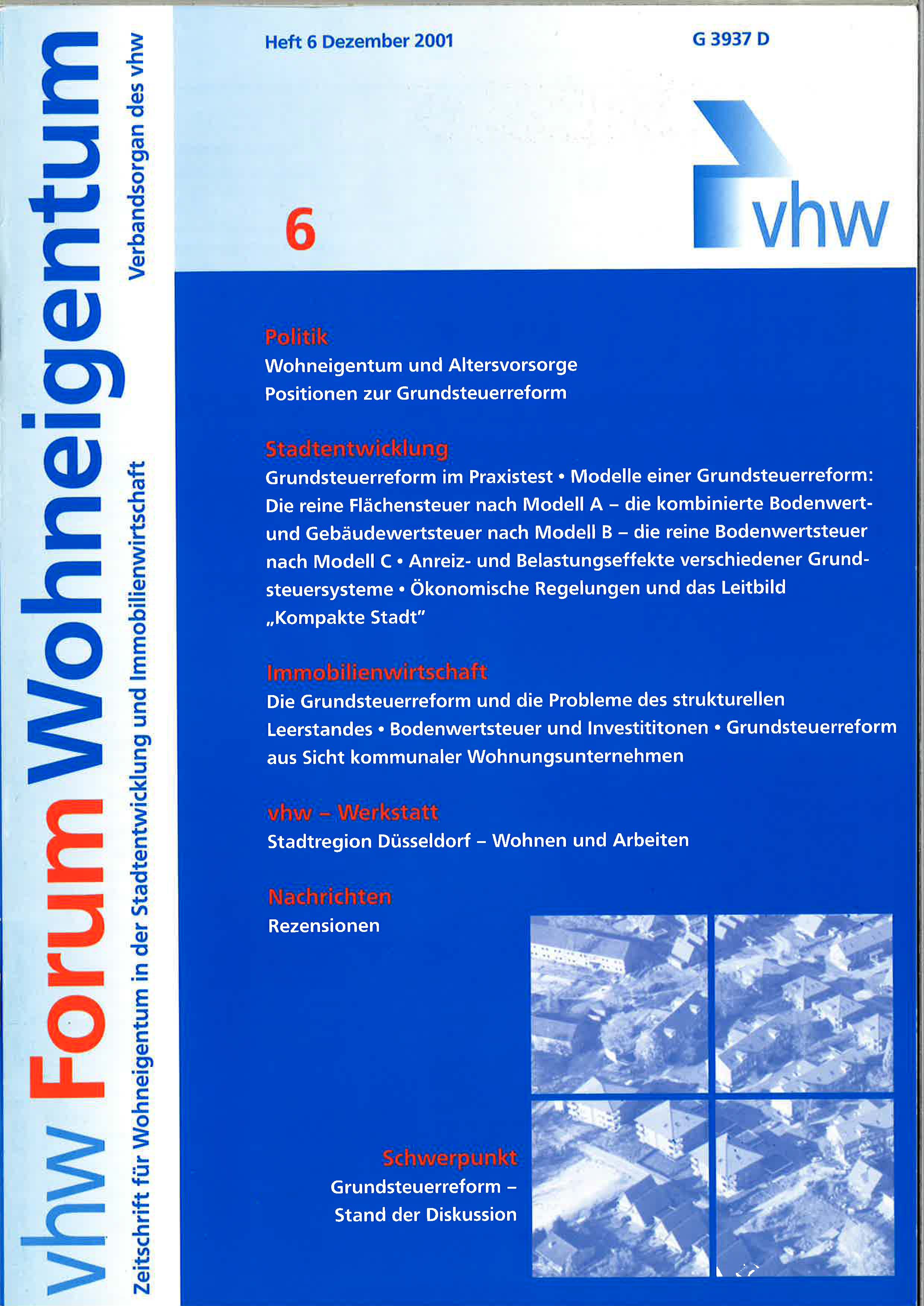
Erschienen in
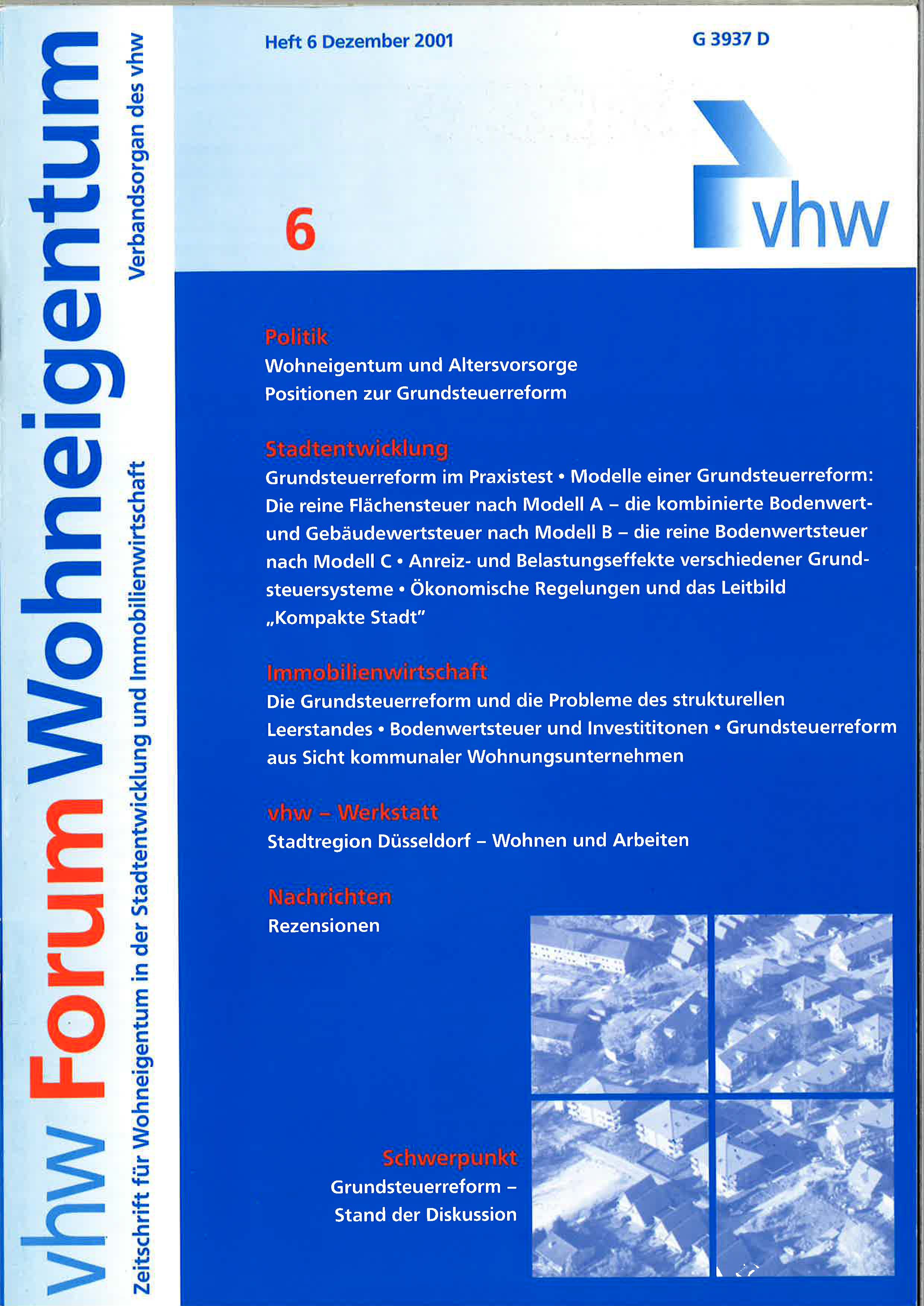
Erschienen in
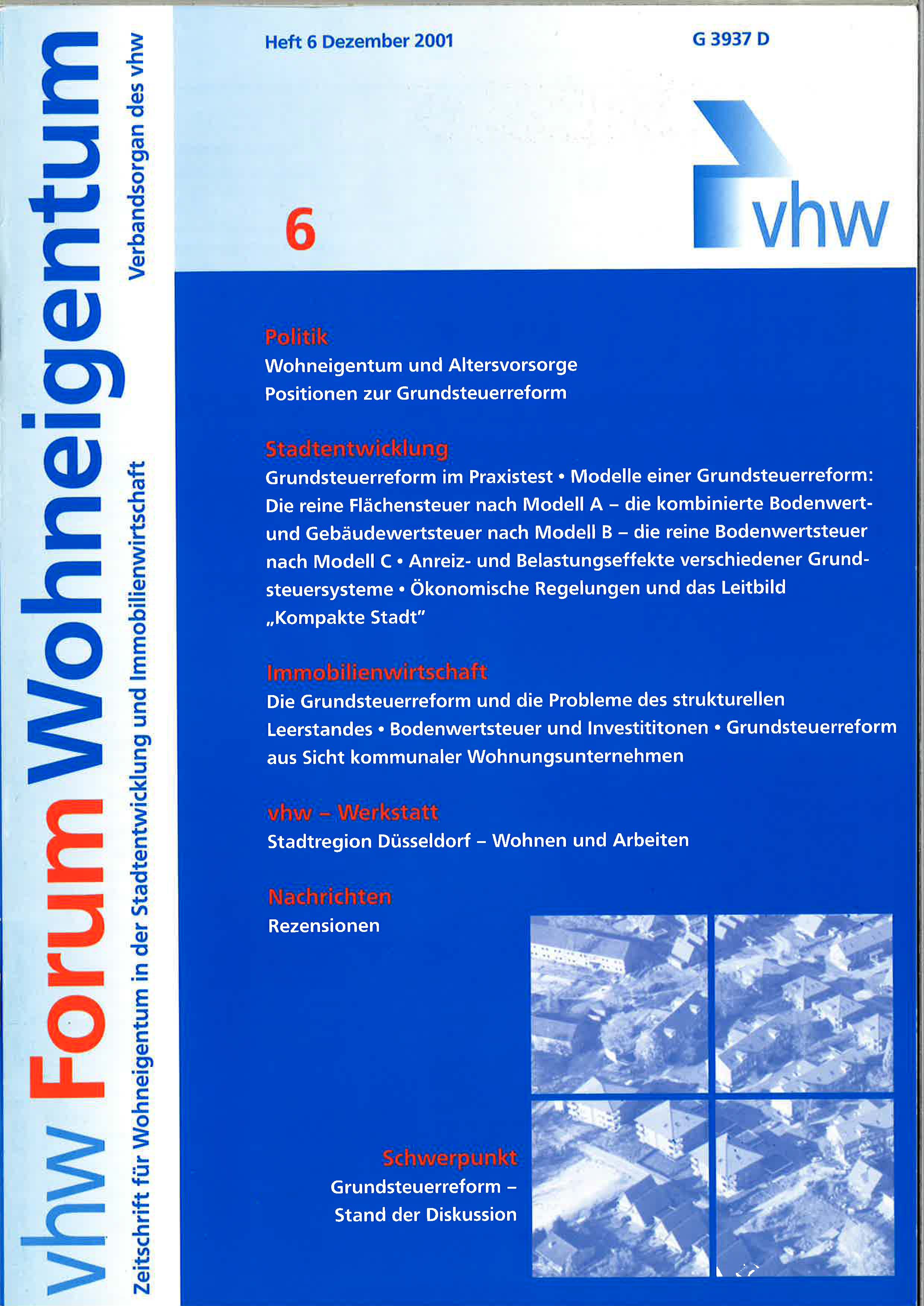
Erschienen in
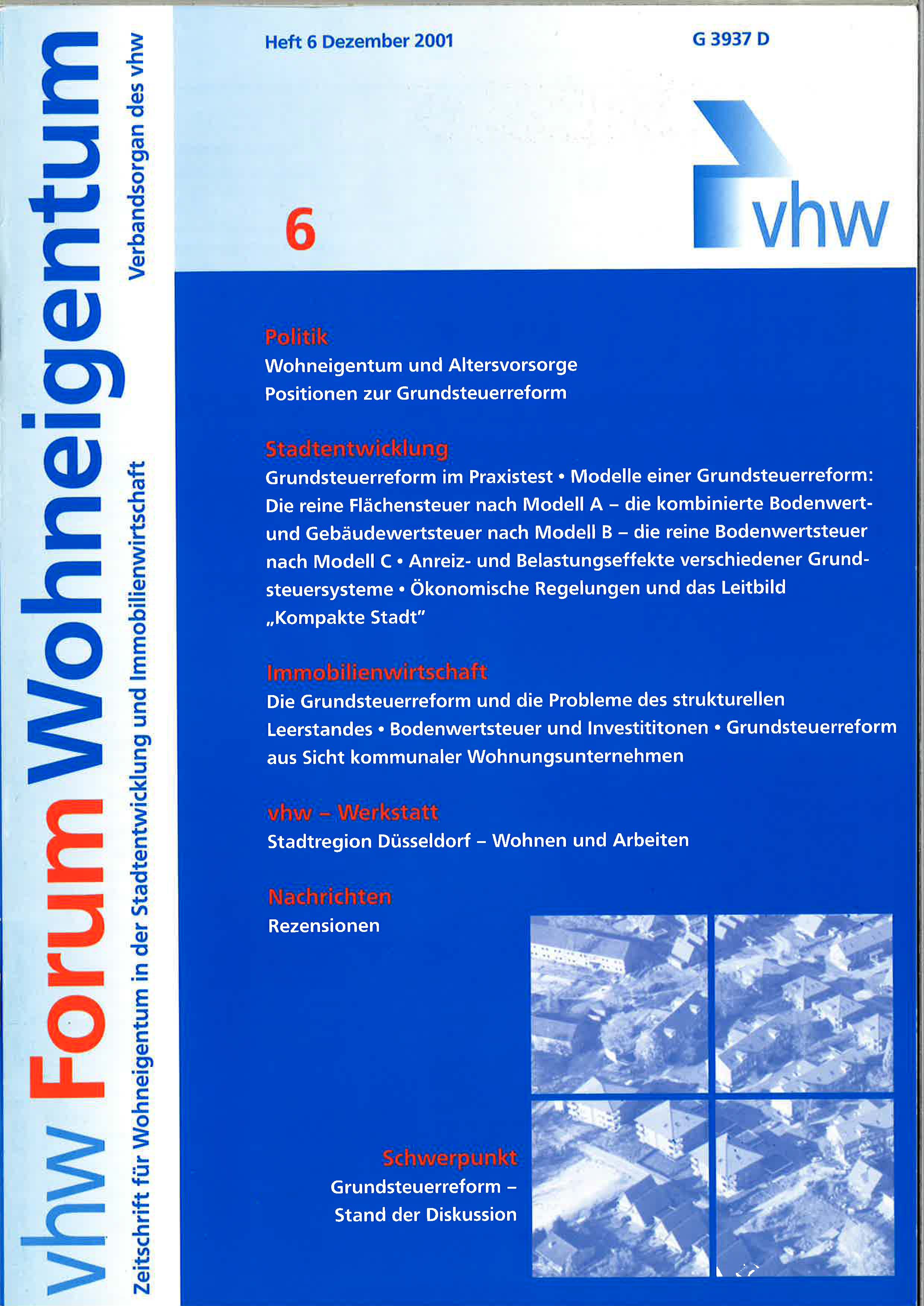
Erschienen in
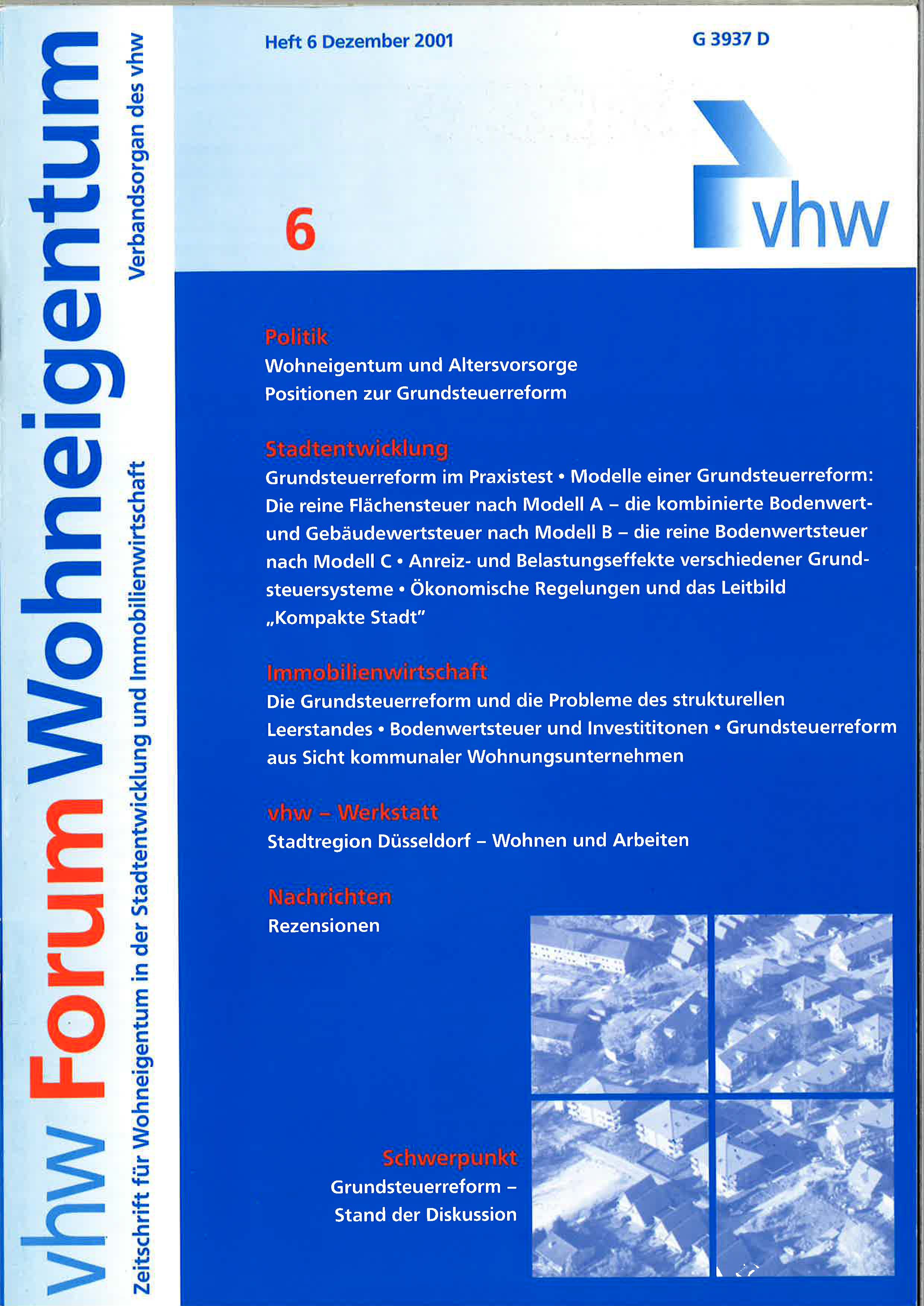
Erschienen in
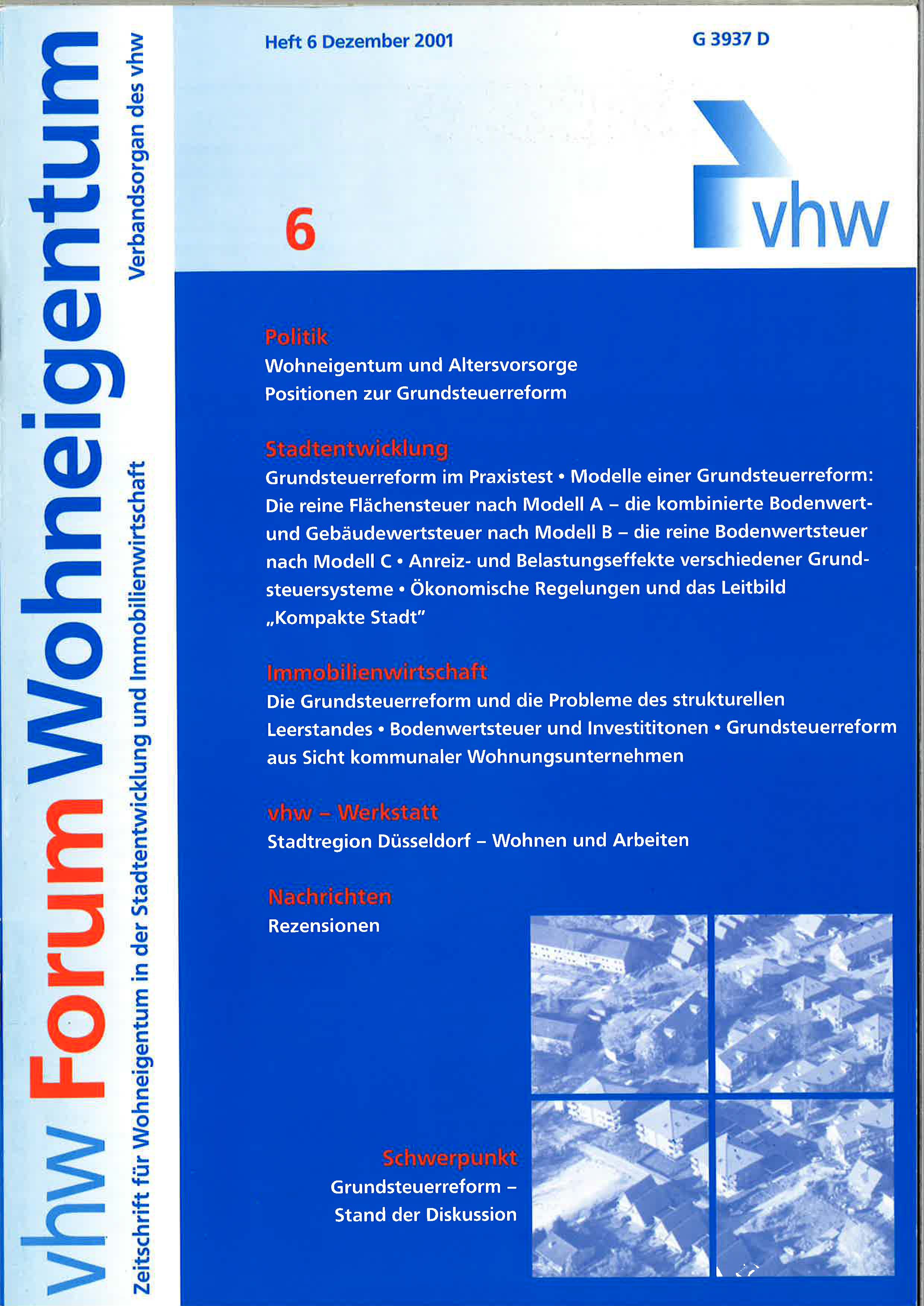
Erschienen in
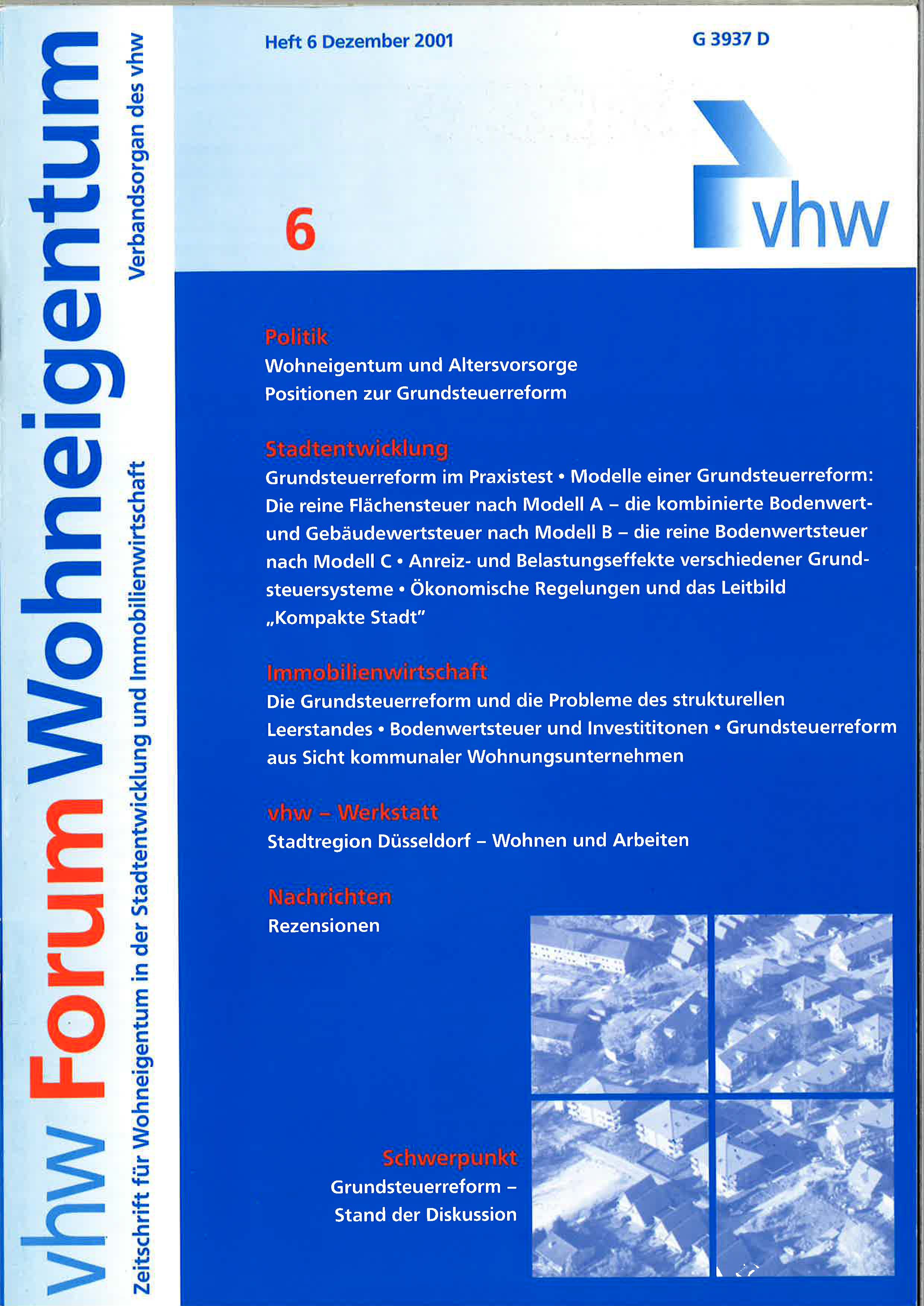
Erschienen in
Wolfgang Spanier, MdB SPD; Peter Götz, MdB CDU; Franziska Eichstädt-Bohlig, MdB Bündnis 90/Grüne; Hans-Michael Goldmann, MdB F.D.P.; Christine Ostrowski, MdB PDS
Beiträge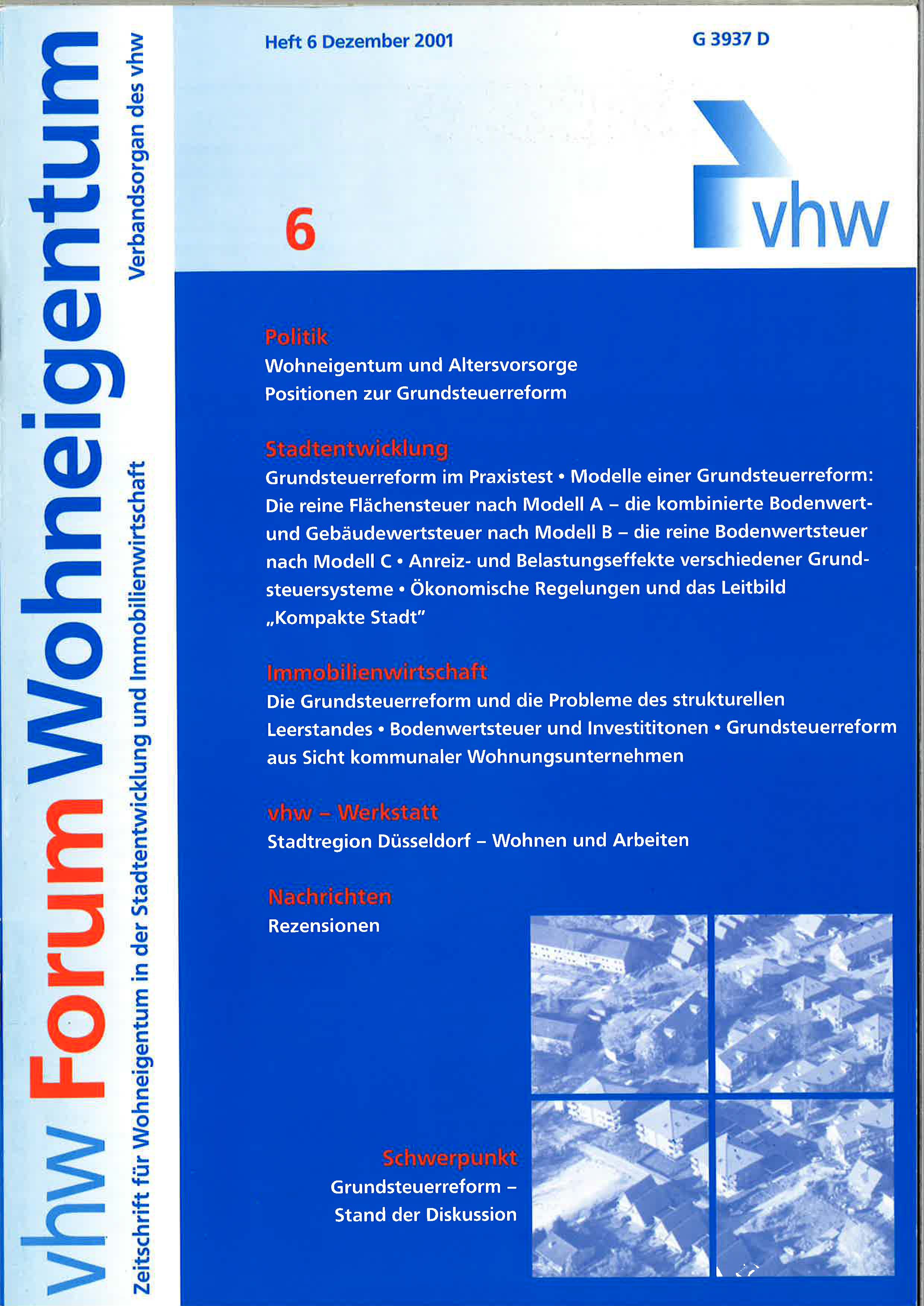
Erschienen in
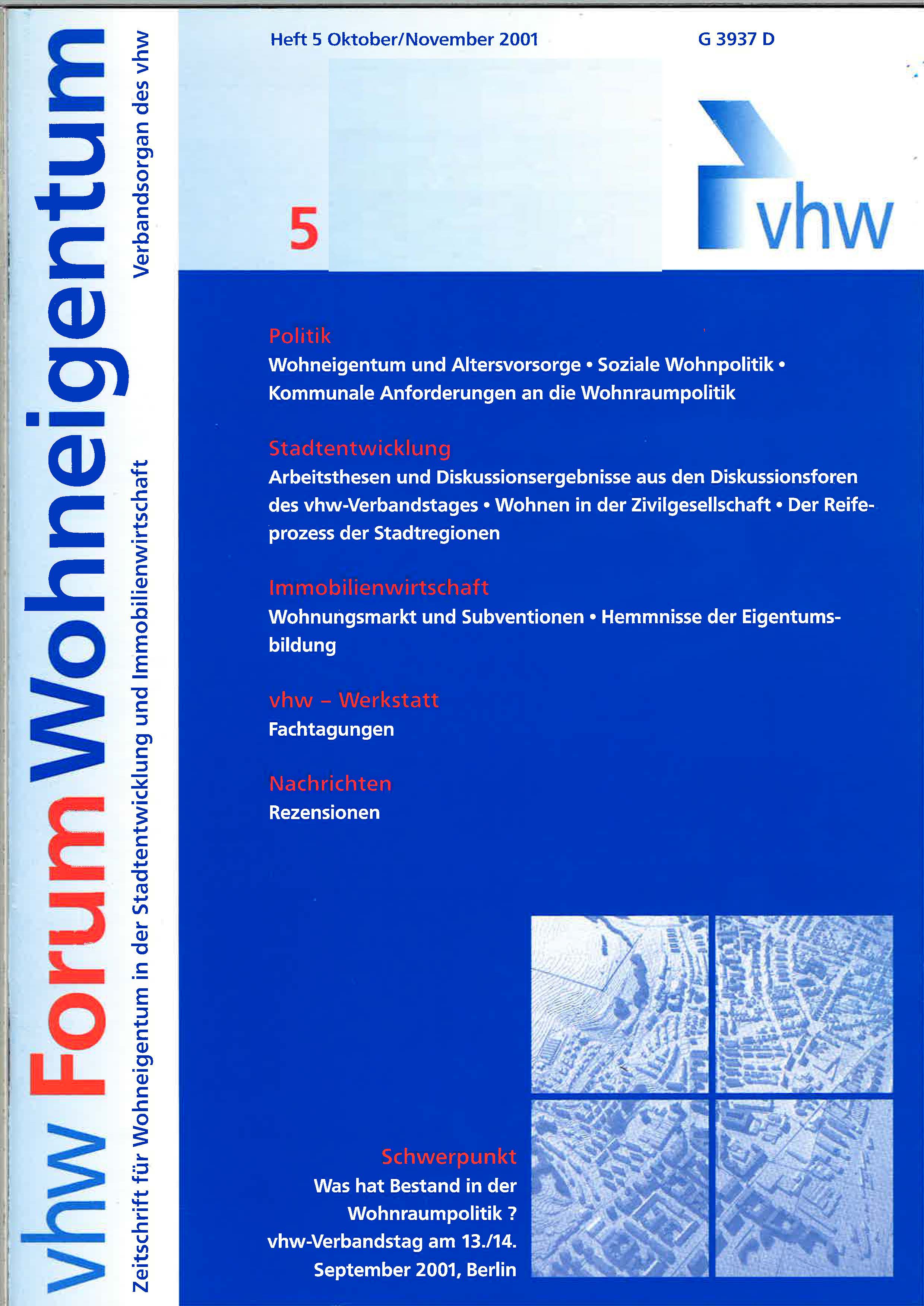
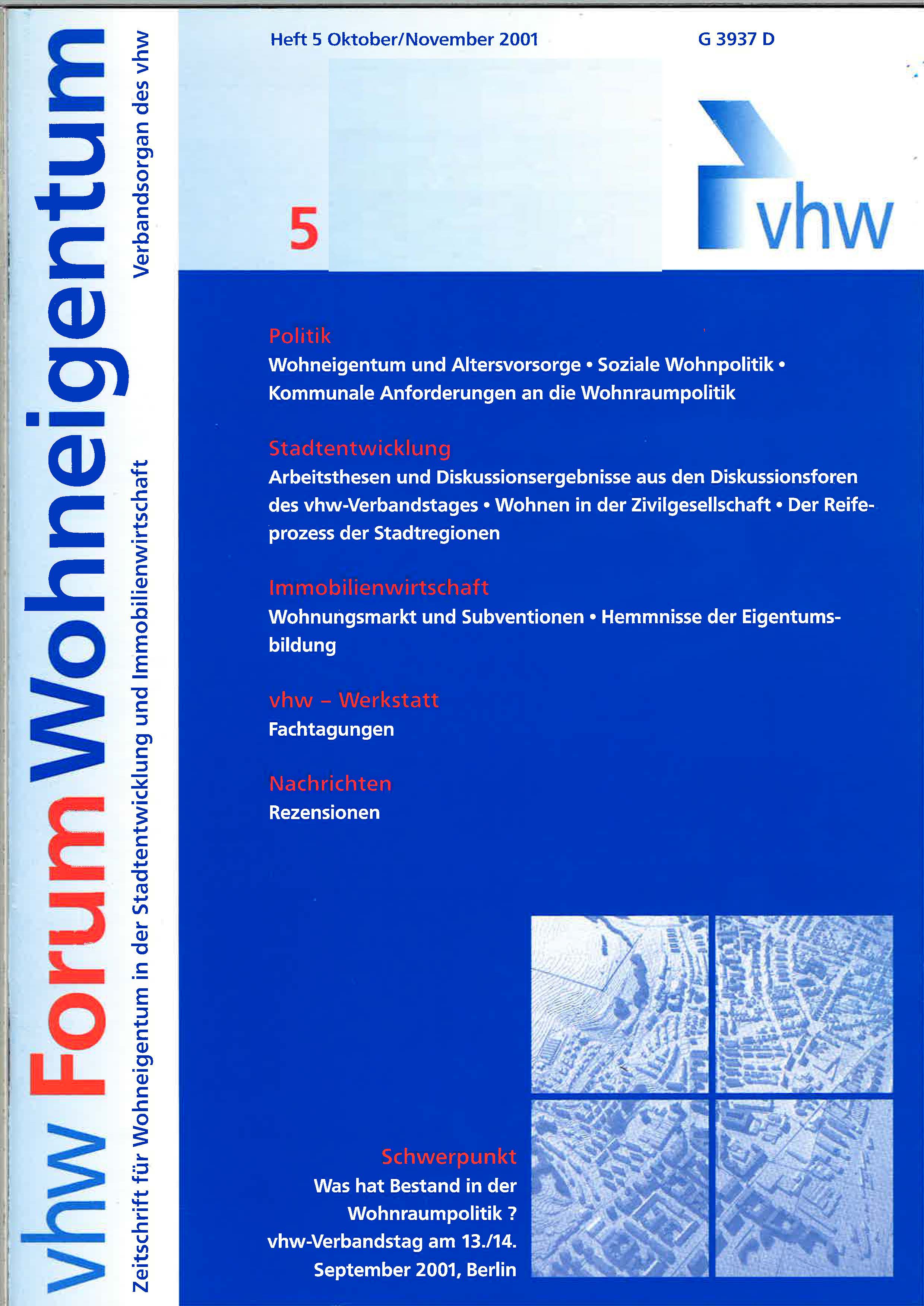
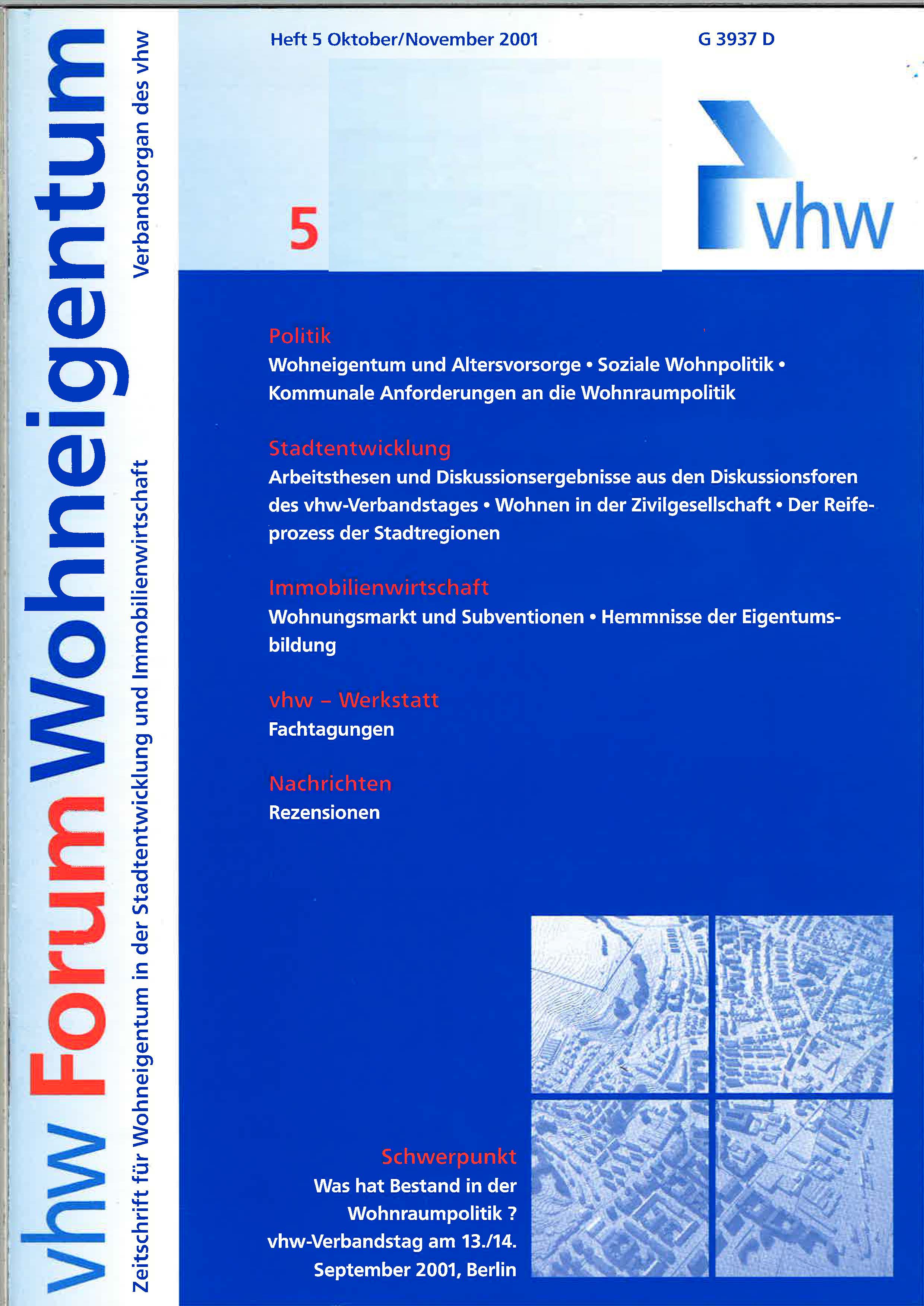
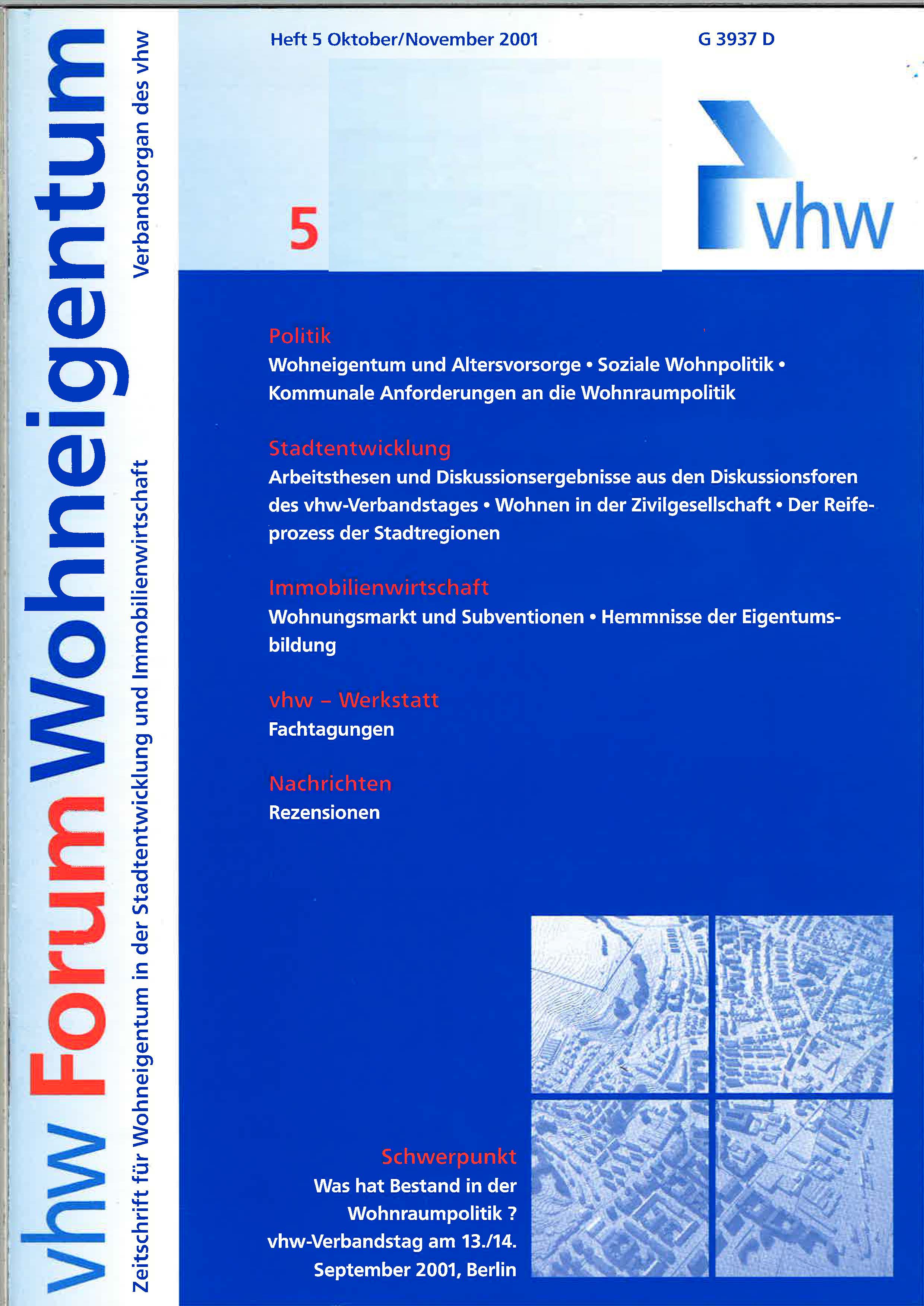
Erschienen in
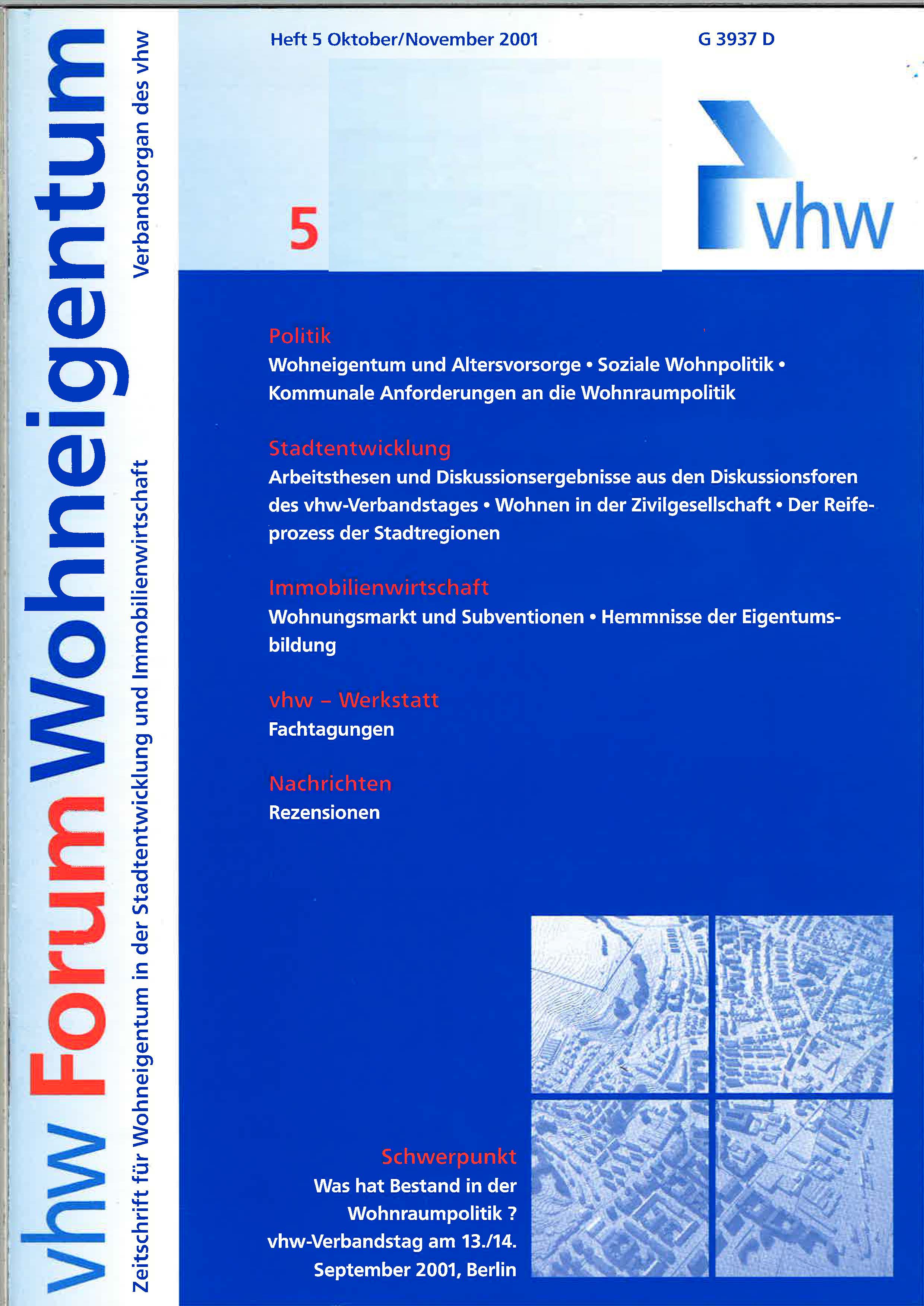
Erschienen in
Arbeitsthesen und Diskussionsergebnisse
Beiträge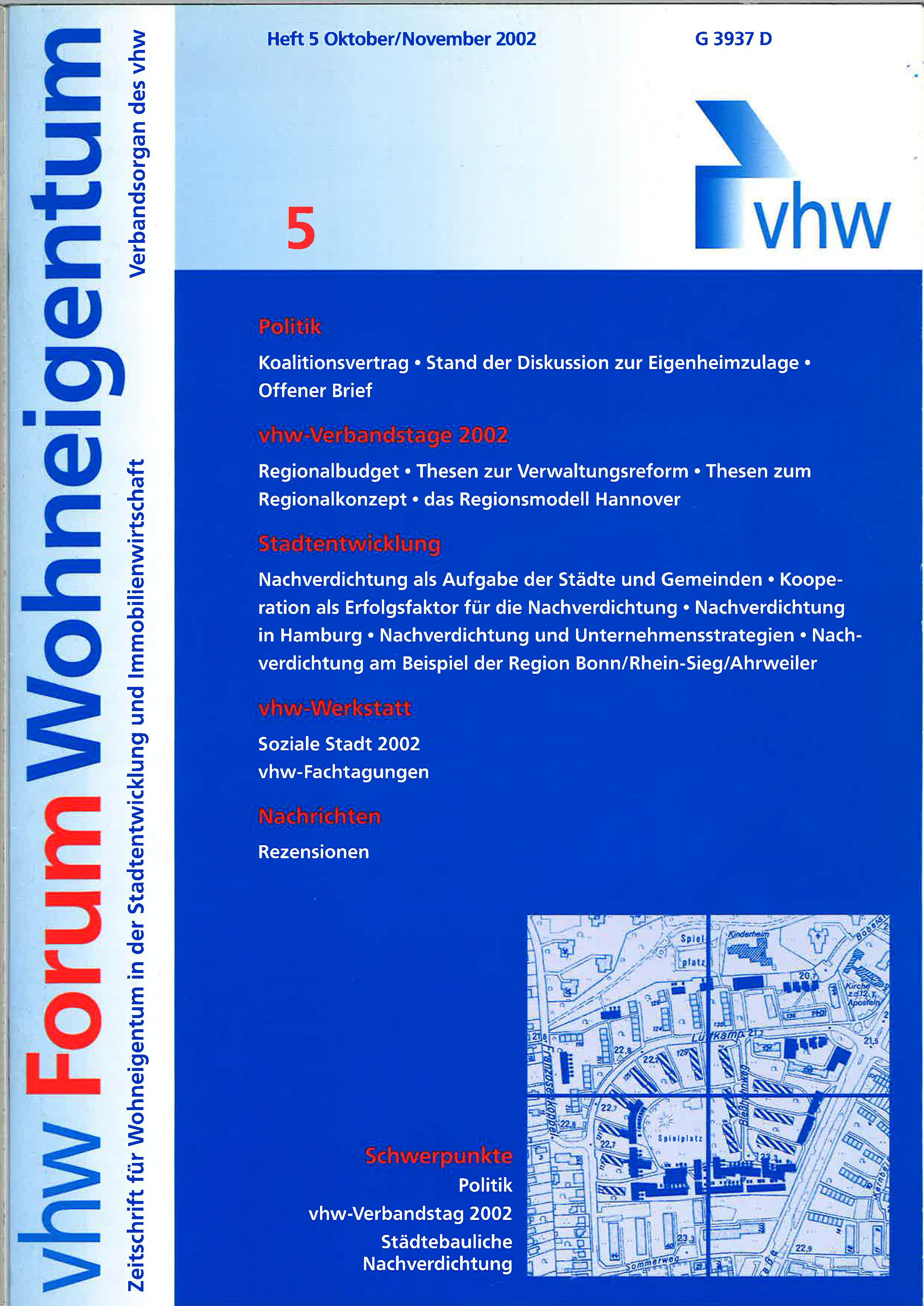
Erschienen in
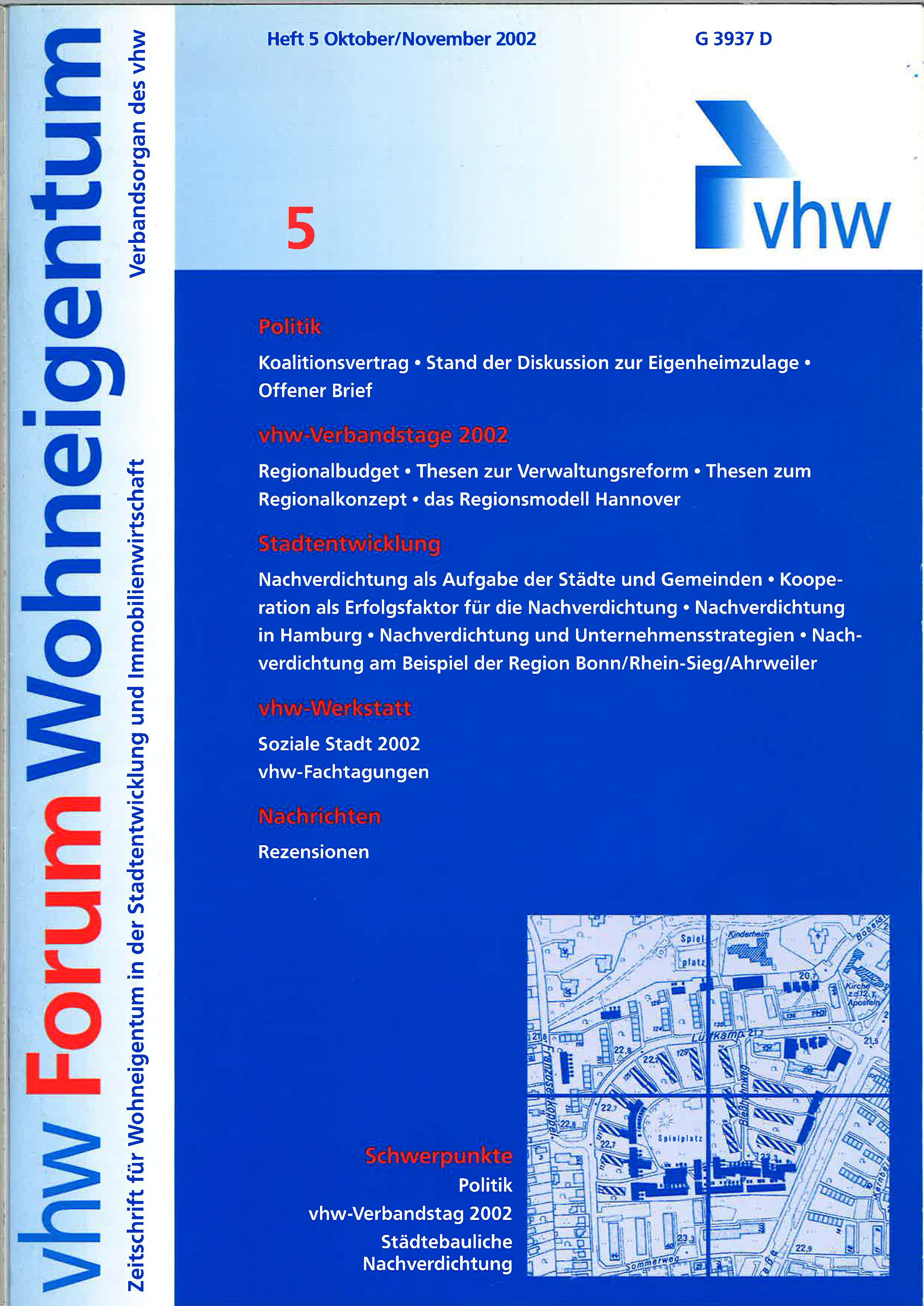
Erschienen in
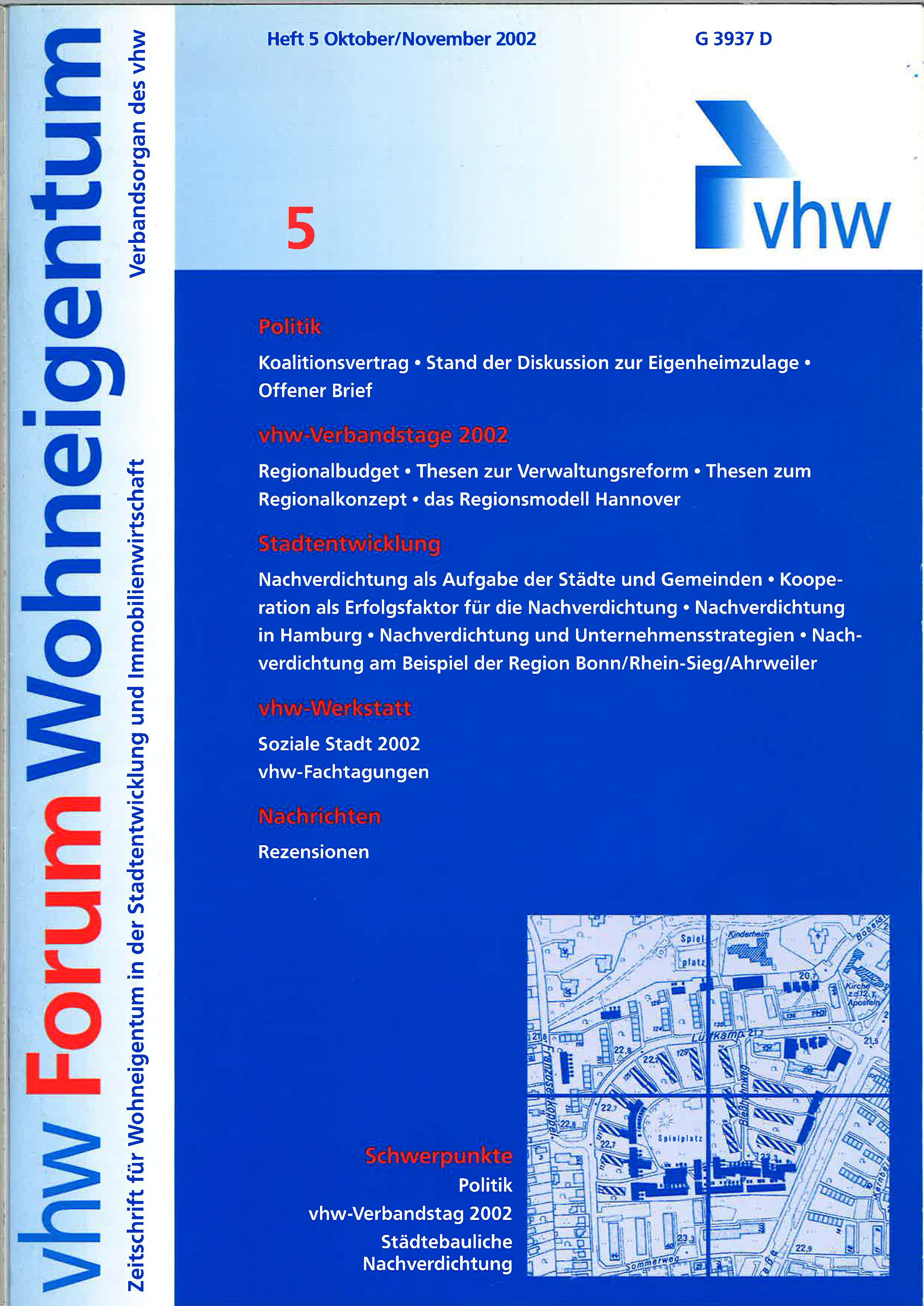
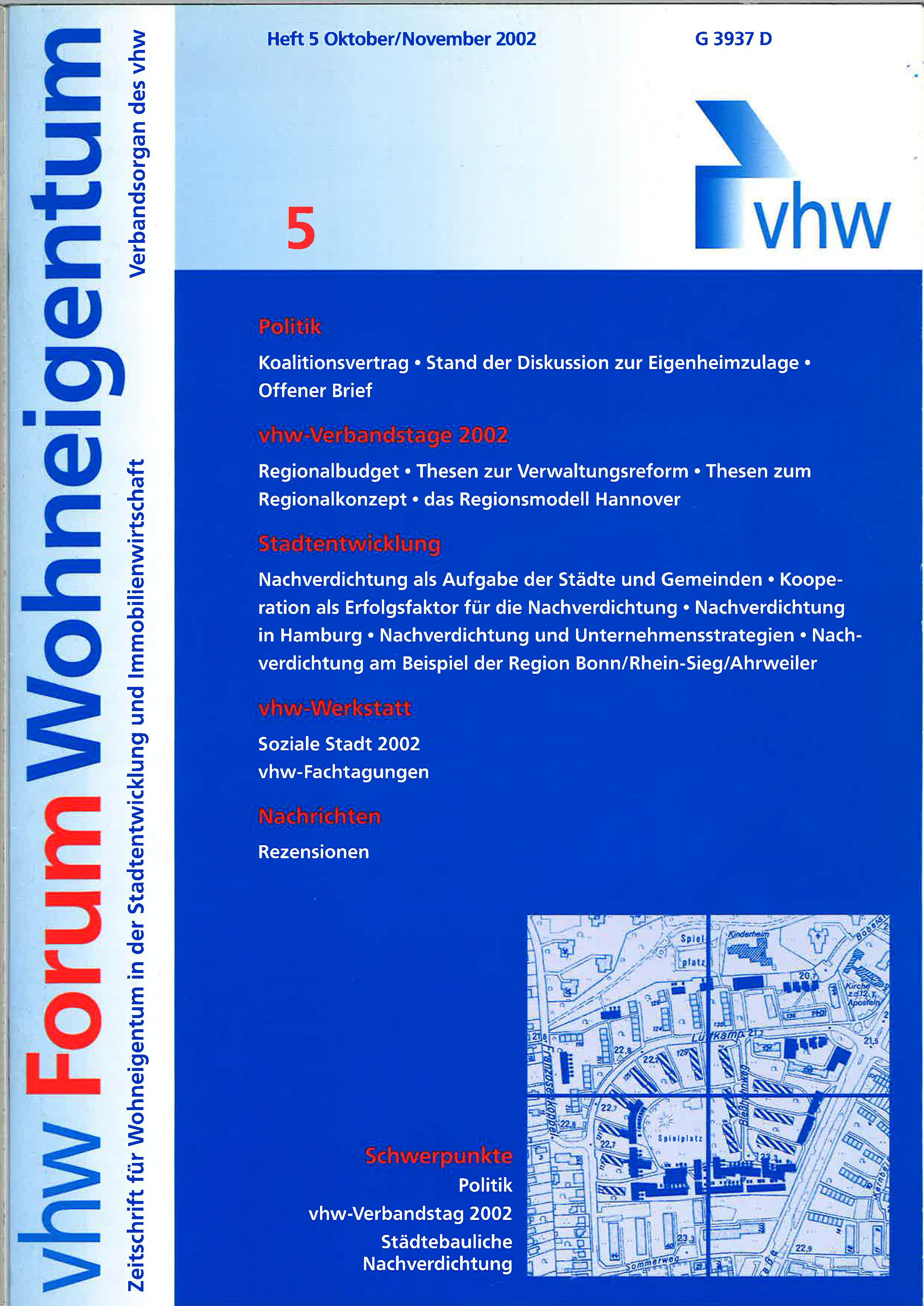
Erschienen in
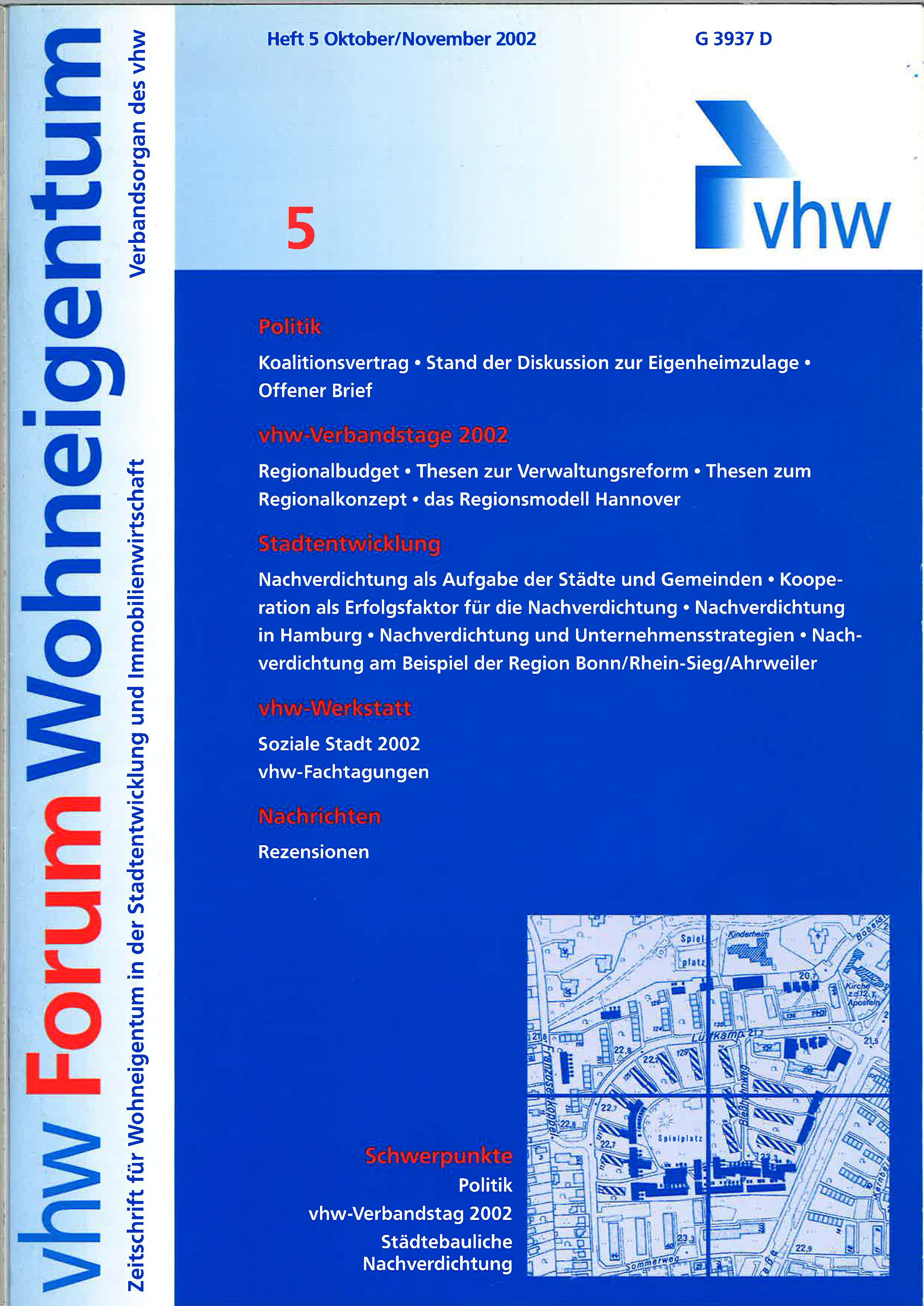
Erschienen in
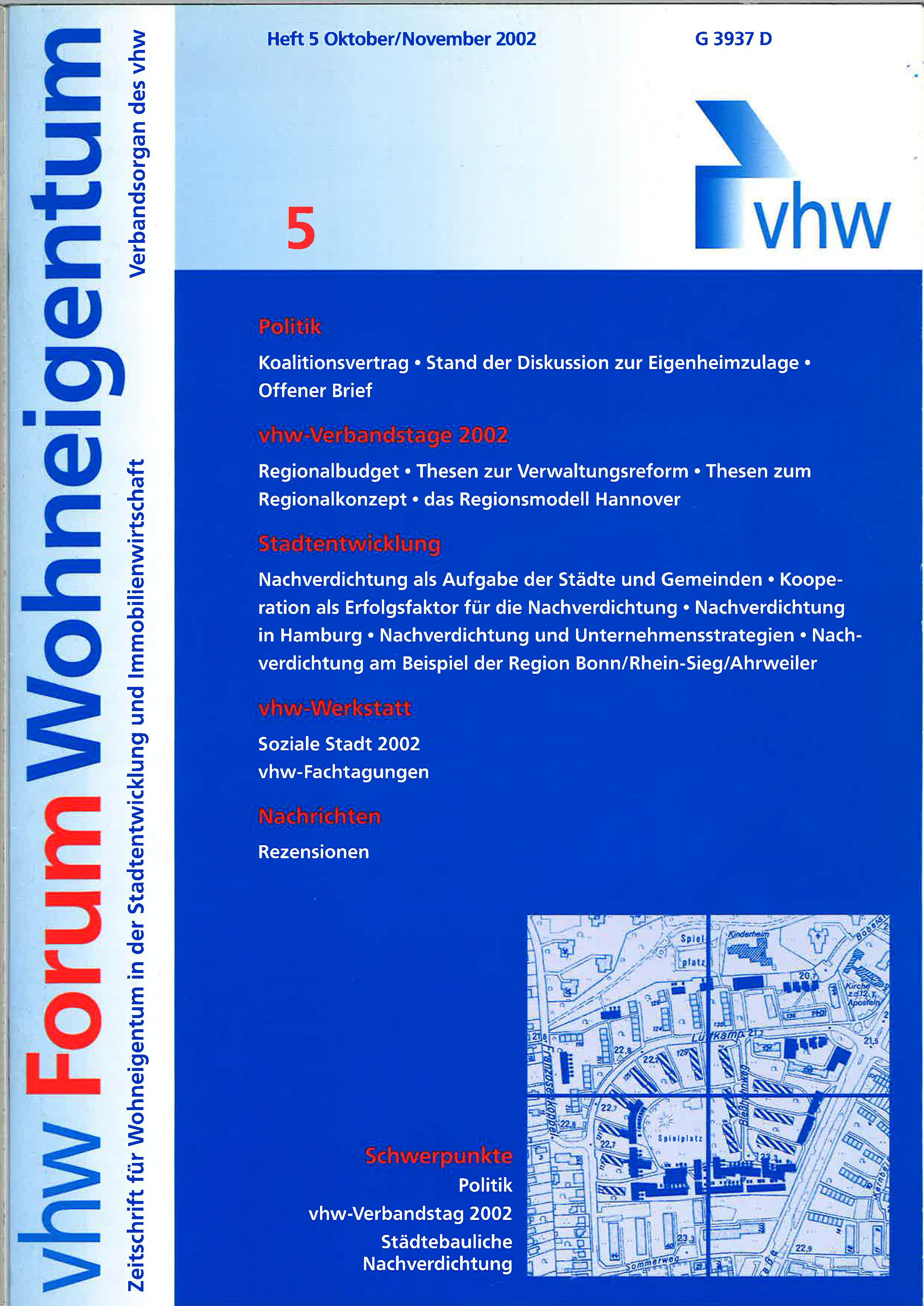
Erschienen in
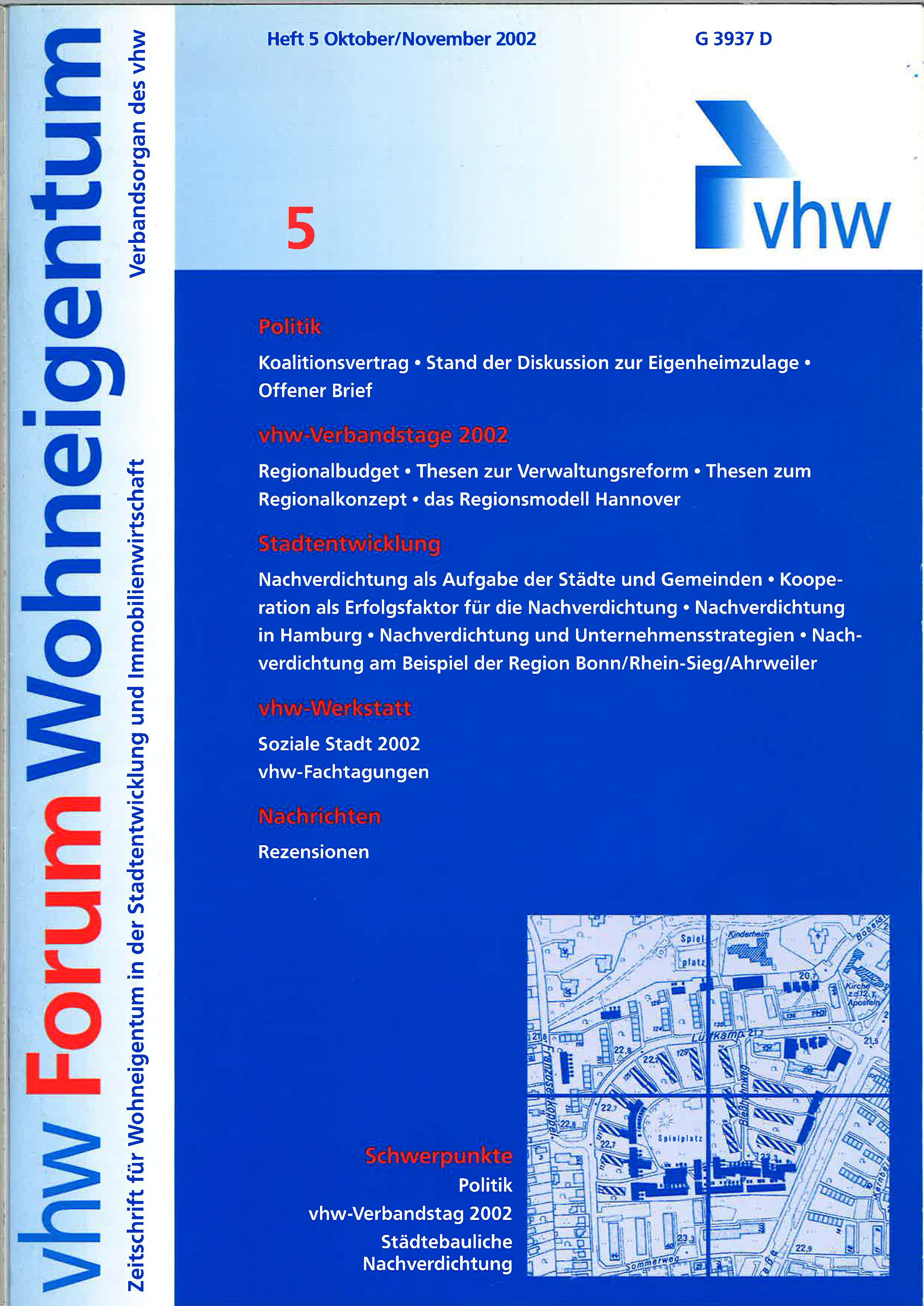
Erschienen in
Die Region Mittelfranken: Zunehmende räumliche Verteilung des Arbeitsplatzangebotes, rückläufige Umlandwanderung
Beiträge