
Erschienen in
Städte schrumpfen - sagt man. Aber ist das Phänomen damit zutreffend benannt? Städte "schrumpfen" nicht, im Gegenteil: Es wird weiter gebaut und versiegelt. Lediglich die Zahl der Bedarfsträger "schrumpft". Es kommt zu räumlicher Umverteilung, zu innerstädtische Brachen. So entsteht eine "perforierte Stadt". Anders als in den letzten zehn Jahren exzessiv geplant, werden sich die Lücken in der städtischen Struktur wohl nicht wieder füllen. Normative Setzungen im Sinne bisherigen Planungshandelns könnten in der perforierten Stadt zum Wunschdenken geraten. Wird Planung stattdessen zu einer rein deskriptiven Wissenschaft?
Beiträge

Erschienen in Heft 4/2008 Engagementpolitik und Stadtentwicklung – Ein neues Handlungsfeld entsteht
Die Sondierungen in Aachen, Dortmund und Hannover haben eine erstaunliche "Topografie des Engagements" – also eine Beschreibung der von den Menschen vor Ort ausgehenden und auf sie und ihr Quartier gerichteten Aktivitäten – sichtbar gemacht: Herausgekommen ist eine "Topografie" – so benannt, weil hier das vom Ort ausgehende und auf ihn gerichtete Engagement im Zusammenhang beschrieben wird: Für drei städtische Quartiere, in denen man mit Blick auf die Sozialstruktur der Bewohner gemeinhin wenig "bürgerschaftliches Engagement" vermutet hätte, lässt sich nun zeigen, wie vielfältig und intensiv das "Engagement vor Ort" ist.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2008 Engagementpolitik und Stadtentwicklung – Ein neues Handlungsfeld entsteht
Im Folgenden werden die Ergebnisse einer von Oktober 2007 bis Juni 2008 in einem Dortmunder Stadtteil erfolgten Recherche zusammengefasst. Im Fokus der Untersuchung standen freiwillige Aktivitäten "im" und "für" den Stadtteil, wobei ein "erweiterter" Engagement-Begriff zugrunde gelegt wurde, der Ansätze informeller Nachbarschaftshilfe und Initiative im Lebensalltag der Bewohner ebenso abdecken sollte wie Formen des klassischen Ehrenamts oder eines neuen freiwilligen Engagements. Wegen des besonderen Charakters der Nordstadt als "Integrationsstadtteil" wurde Wert darauf gelegt, vor allem auch das Engagement von relevanten Zuwanderergruppen angemessen zu berücksichtigen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2008 Engagementpolitik und Stadtentwicklung – Ein neues Handlungsfeld entsteht
Dieser Beitrag stellt das öffentlich geförderte Modellprojekt "Sozialraumanalysen zum Zusammenleben vor Ort" vor, das angesichts Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und speziell Rechtsextremismus die praktische und gezielte Initiierung und Nutzung lokalen Engagements zur Stärkung einer verantwortlichen Zivilgesellschaft fokussiert. Ausgehend von der Annahme, dass das Zusammenleben von Menschen einerseits stark von individuellen, andererseits aber auch deutlich von den kontextuellen Faktoren des umgebenden Sozialraums bestimmt wird, sollen in dem Forschungsprojekt die Rolle des kommunalen als auch des unmittelbaren Wohnumfelds gezielt zu den individuellen Einstellungen der Bewohner in Beziehung gesetzt werden, um so primär das je spezifische lokale Ausmaß feindseliger Mentalitäten abbilden bzw. das in der Bevölkerung vorhandene Potenzial für bürgerschaftliches Engagement beschreiben zu können. Diese raumspezifischen Erkenntnisse sind Basis für eine unmittelbare und praxisrelevante Verwertung, d. h., über die Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren in allen Phasen des Projekts können die wissenschaftlichen Erkenntnisse direkt bezogen auf die je besondere Beschaffenheit eines Sozialraums fruchtbar gemacht werden, um so systematisch bürgerschaftliches Engagement und damit Zivilgesellschaft zu stärken. Das Modellprojekt zielt dabei ausdrücklich auf die dauerhafte Etablierung der zugrunde liegenden Konzeption in Form von Anschlussprojekten, d. h., interessierte Verbände, Städte und Gemeinden können entsprechende Analysen für ihren Sozialraum in Auftrag geben, um empirische Grundlagen für die Initiierung und/oder Stärkung einer reflexiven Stadtgesellschaft zu schaffen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2008 Engagementpolitik und Stadtentwicklung – Ein neues Handlungsfeld entsteht
Was bedeutet heute eine kreative Stadt? Das Bild einer "kreativen Stadt" steht für eine soziale Stadtentwicklung, die den Herausforderungen einer öffentlich verarmten, dem Globalisierungswettbewerb ohnmächtig ausgelieferten, der sozial und nach Ethnien und Generationen zersplitterten Stadt erfolgreich zu widerstehen scheint. Ist die kreative Stadt ein Hoffnungsbild, wie eine moderne Wissensgesellschaft in der Stadt, die ihre Sachzwänge und Blockaden überwindet? Gelingt es in der kreativen Stadt, das Soziale als das Verbindende einer Stadtgesellschaft neu zu entdecken trotz Krise und Umbau des Sozialstaates? Tatsächlich unternehmen wir den Versuch, die Neuaufstellung des (überwiegend) alten städtischen Orchesters mit zusätzlichen Akteuren und neuen Weisen und Melodien als im Ergebnis kreative, gelingende Wiederentdeckung des sozialen Klangs der europäischen Stadt zu bezeichnen.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2008 Segregation und sozialer Raum
Wollen wir Segregation eigentlich wirklich verhindern? Segregation ist eine Entwicklung, die unzweifelhaft unsere Städte stark strukturiert: Hier das Villenviertel für Versicherungen, Ärzte und Rechtsanwälte, da das Reihenhausgebiet für die sparsame Mittelschicht, dort der Kiez für das alternative Publikum, immer mal wieder ein Durchschnittsstadtteil für die breite Masse – und irgendwo dann das Quartier mit dem "besonderen Erneuerungsbedarf" für die benachteiligten Bevölkerungsgruppen ... Jeder wohnt mit den Nachbarn zusammen, mit deren Lebensform er am ehesten übereinstimmt; Segregation als Zeichen von Freiheit, sich auch das Wohnumfeld nach seinen Wünschen auszusuchen? Da liegt die Frage sehr nahe, ob wir Segregation wirklich verhindern, und ob wir wirklich am Ideal durchmischter Wohnquartiere festhalten wollen. "Das würde sicher sehr anstrengend für uns alle werden" – so eine Aussage auf dem Podium des vhw-Symposiums "Integration – Sta(d)tt – Segregation. Perspektiven einer integrativen Stadtgesellschaft" im Mai 2008. Freiheit statt Anstrengung?
Beiträge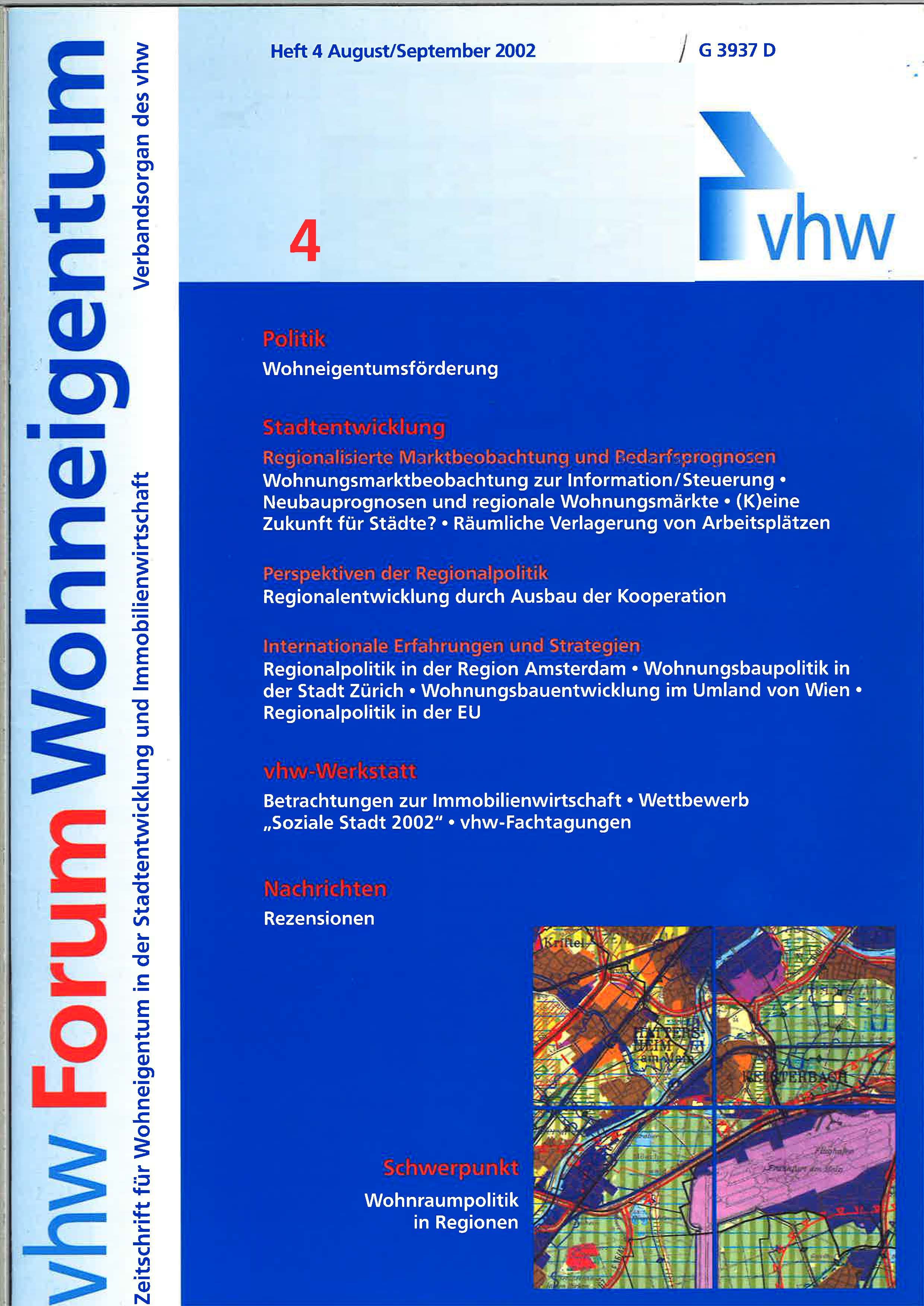
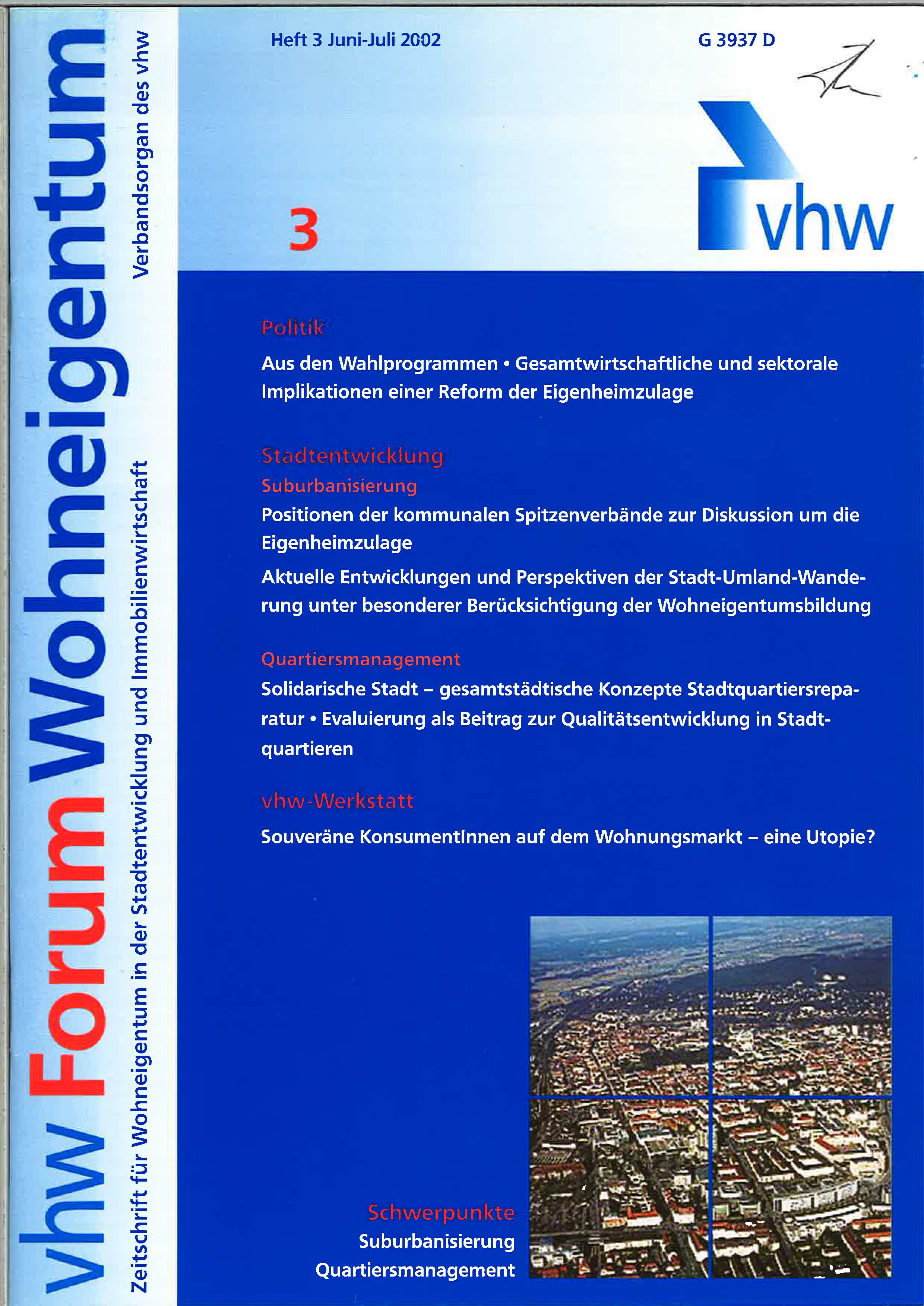
Erschienen in

Erschienen in


Erschienen in
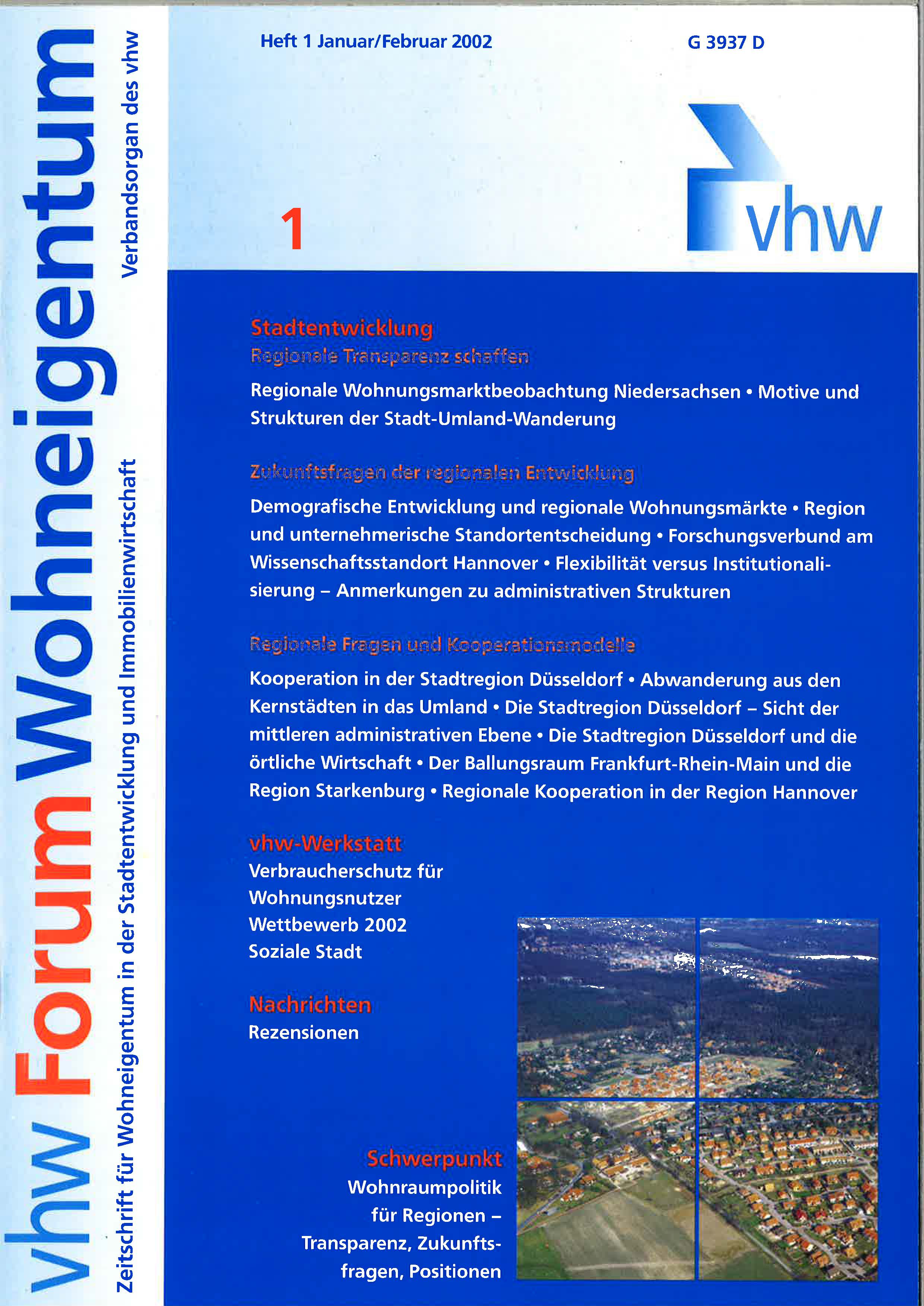
Erschienen in


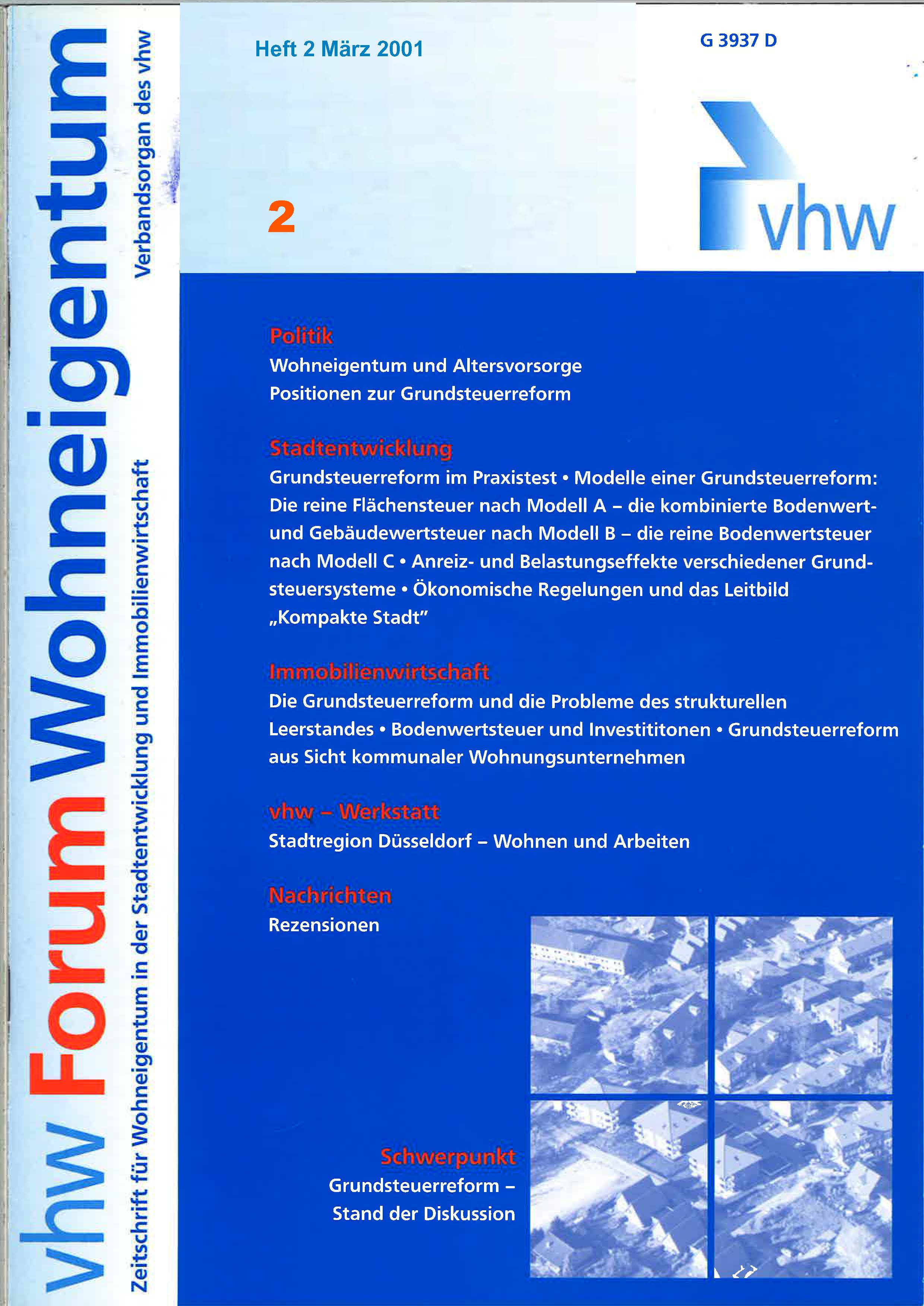
Erschienen in
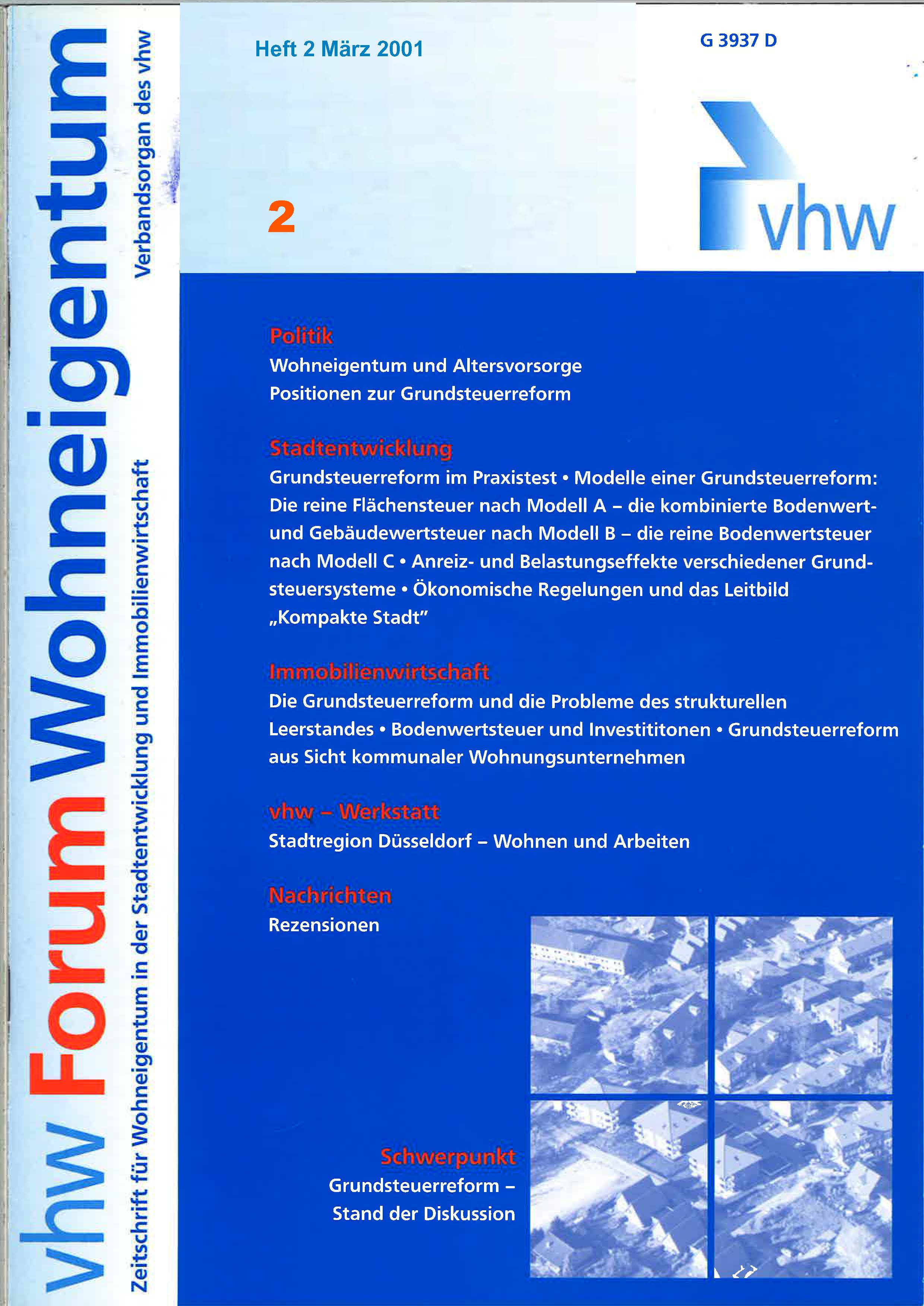
Erschienen in
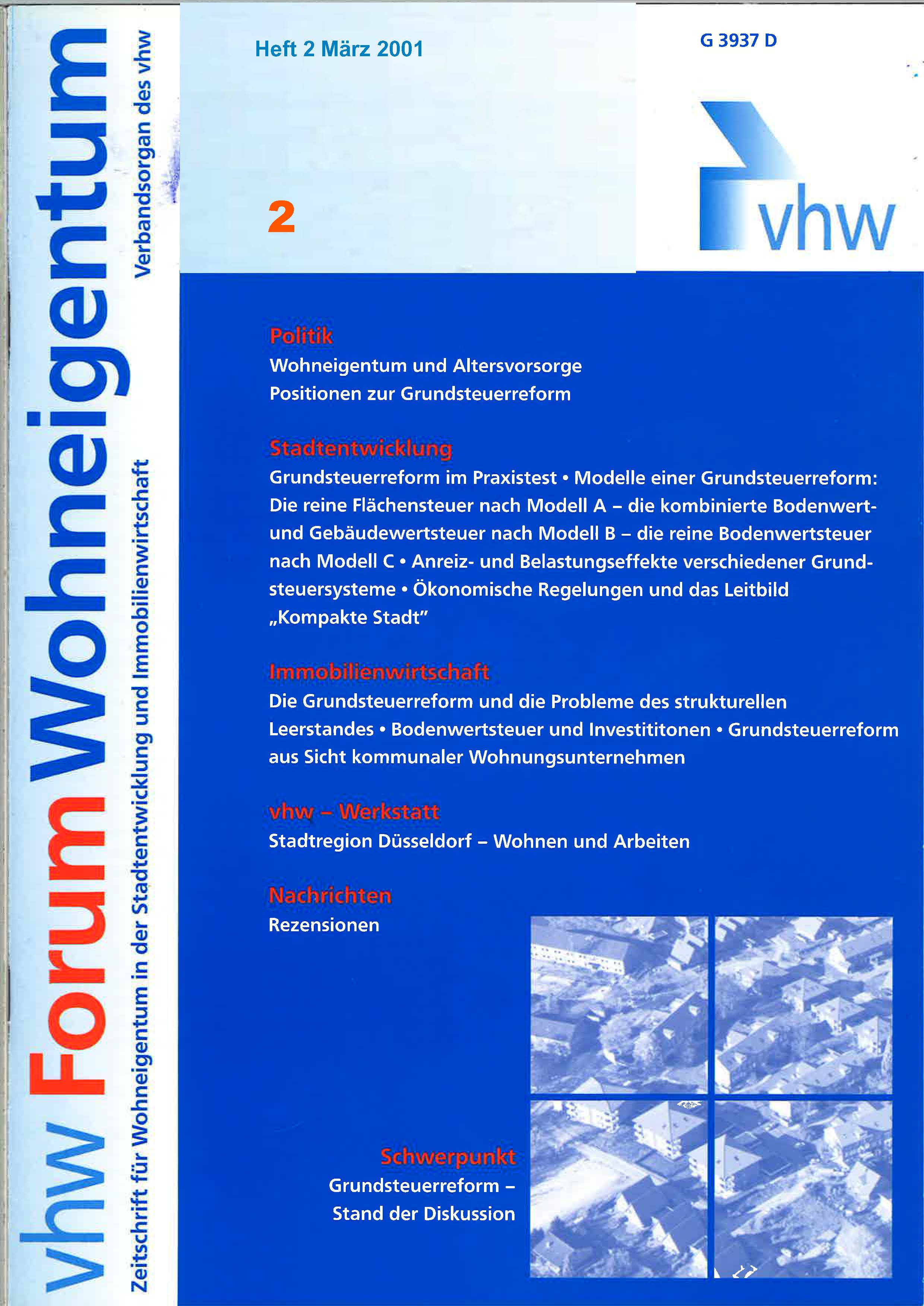
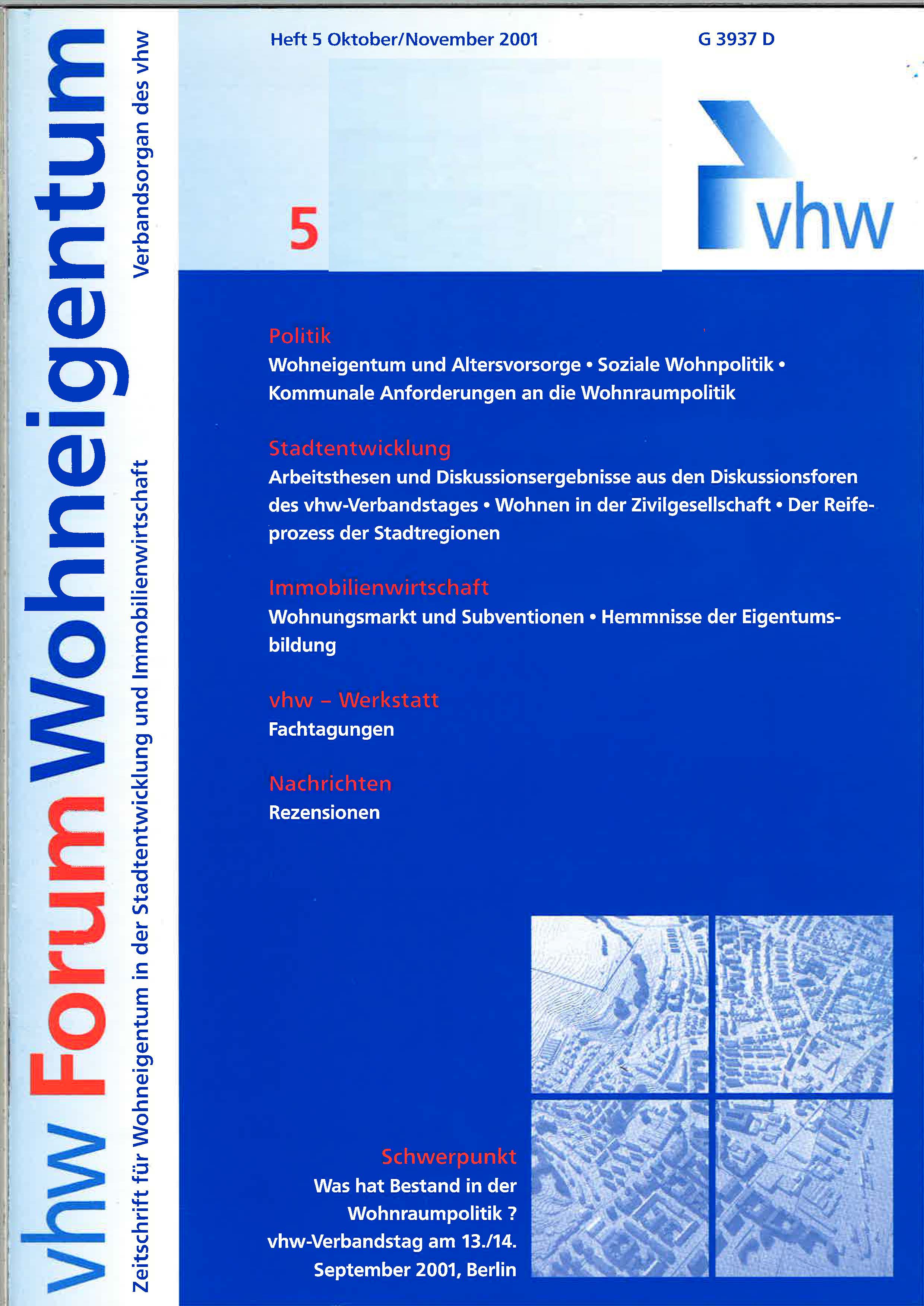

Erschienen in
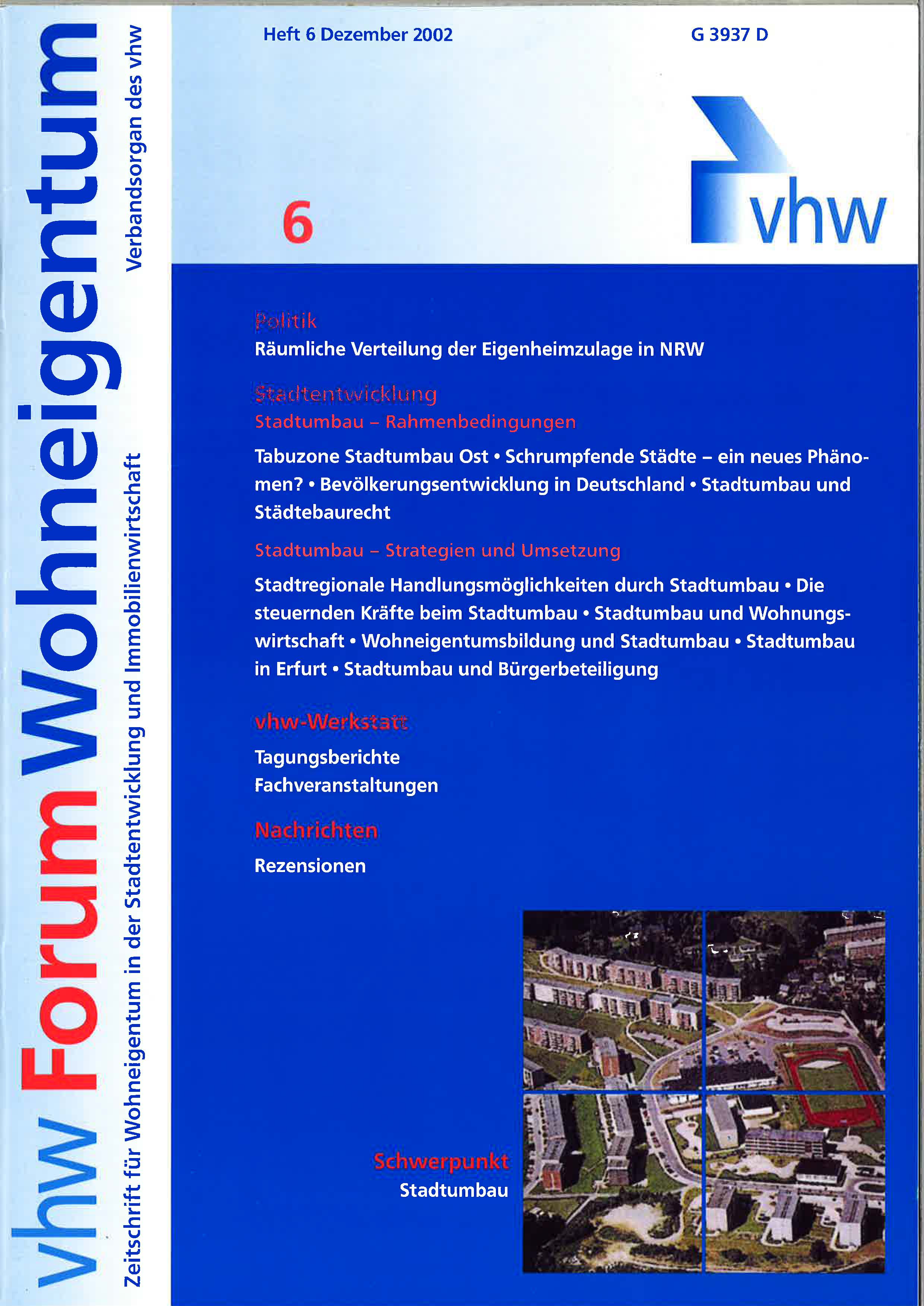
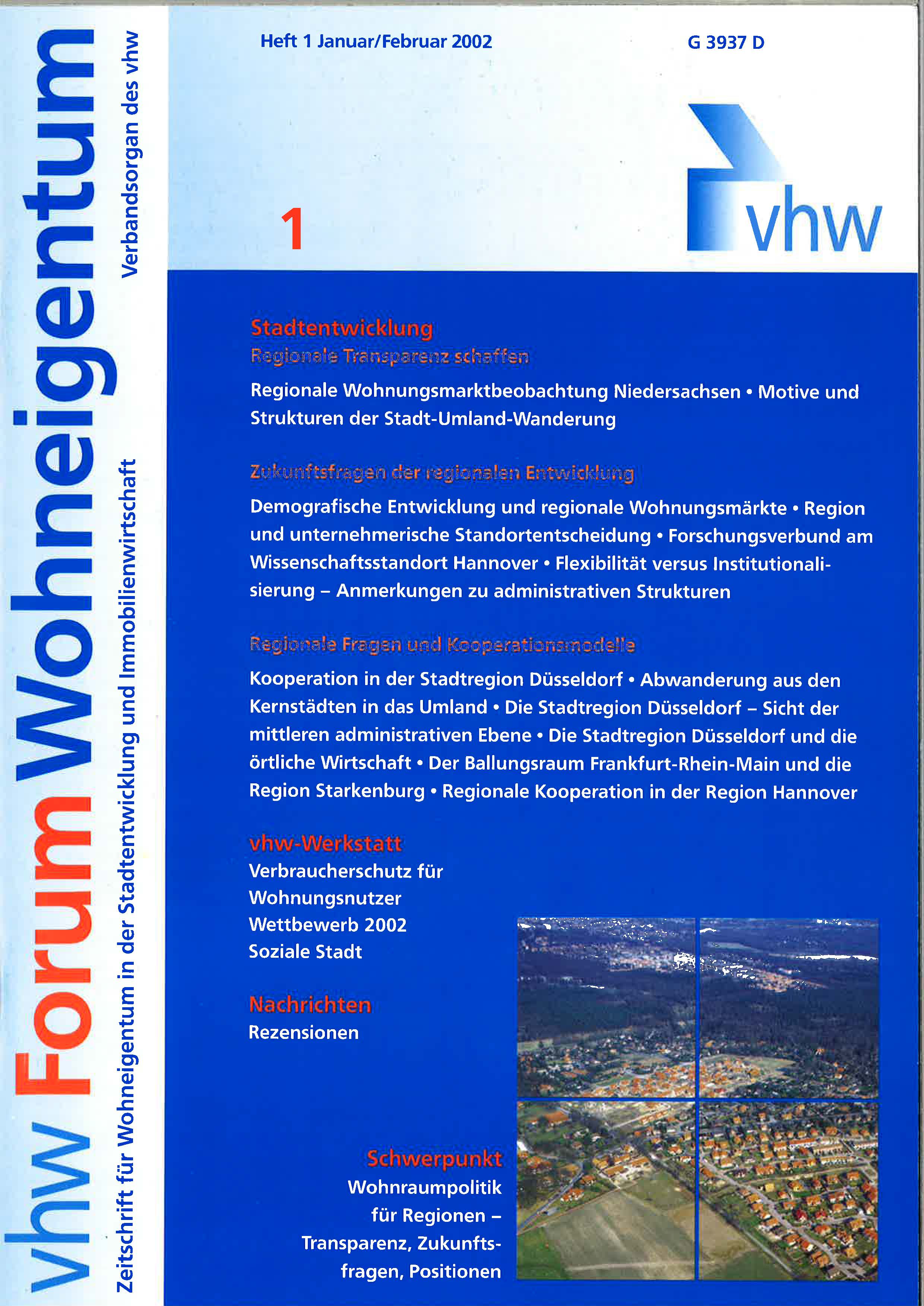
Erschienen in
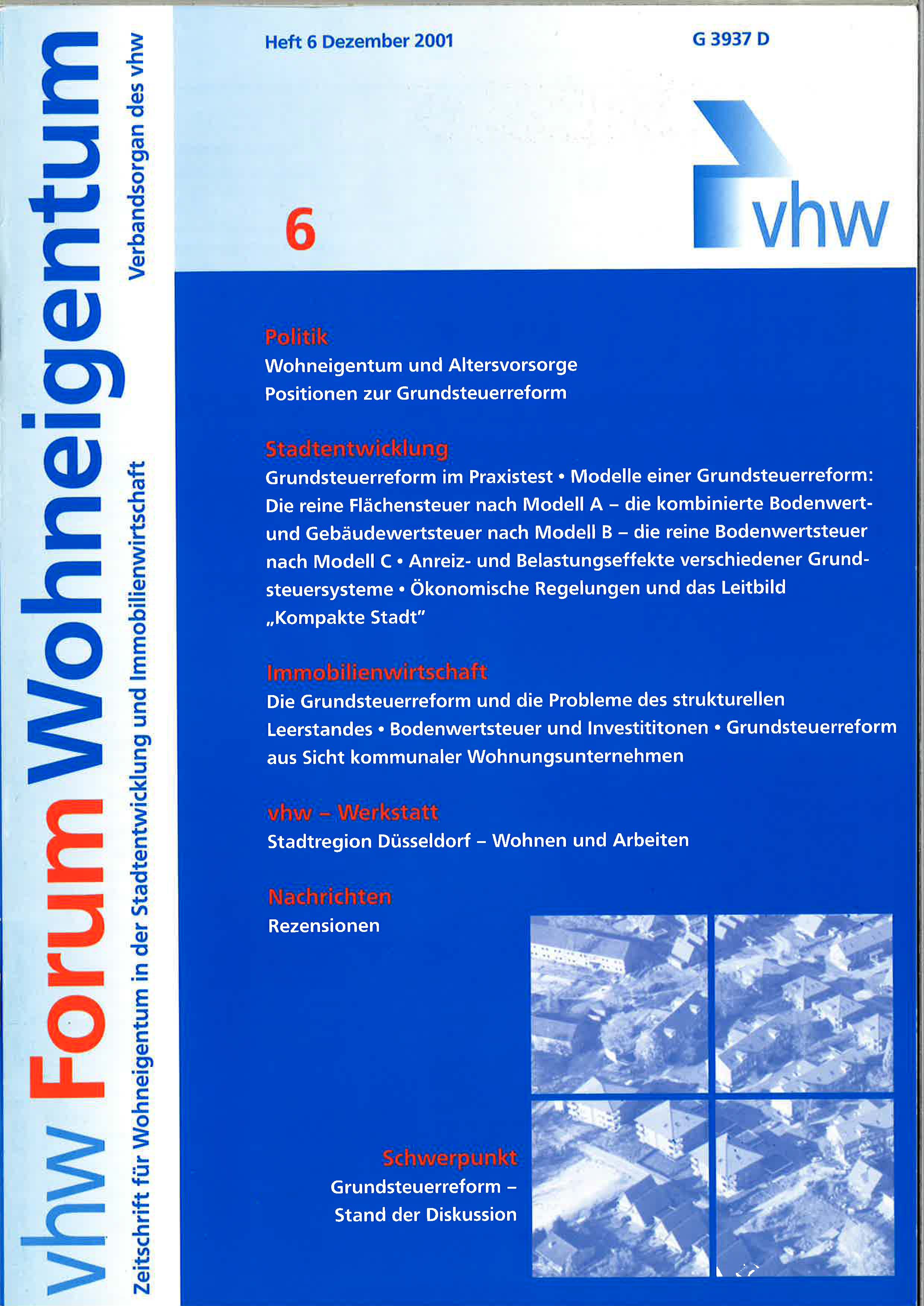
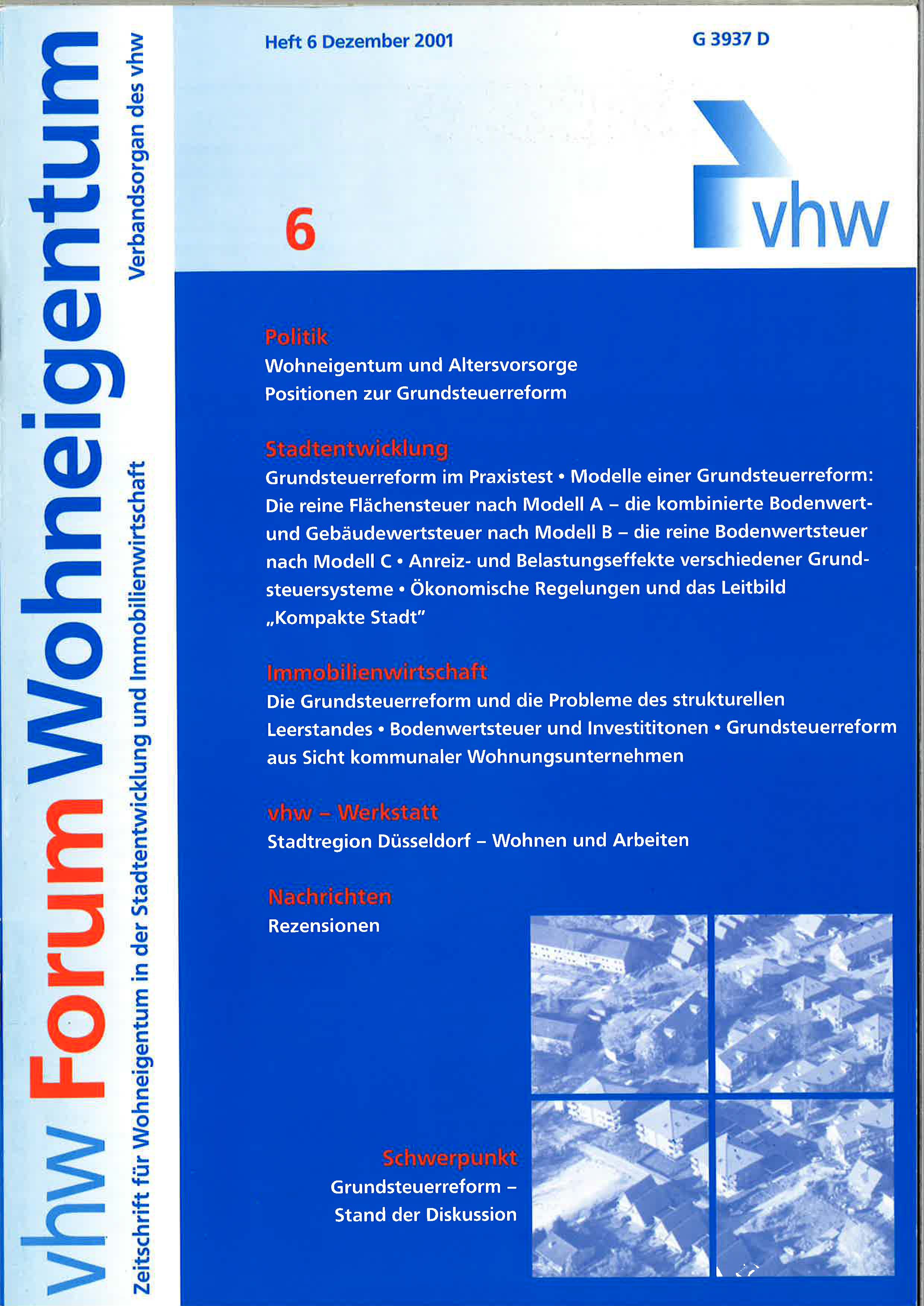
Erschienen in
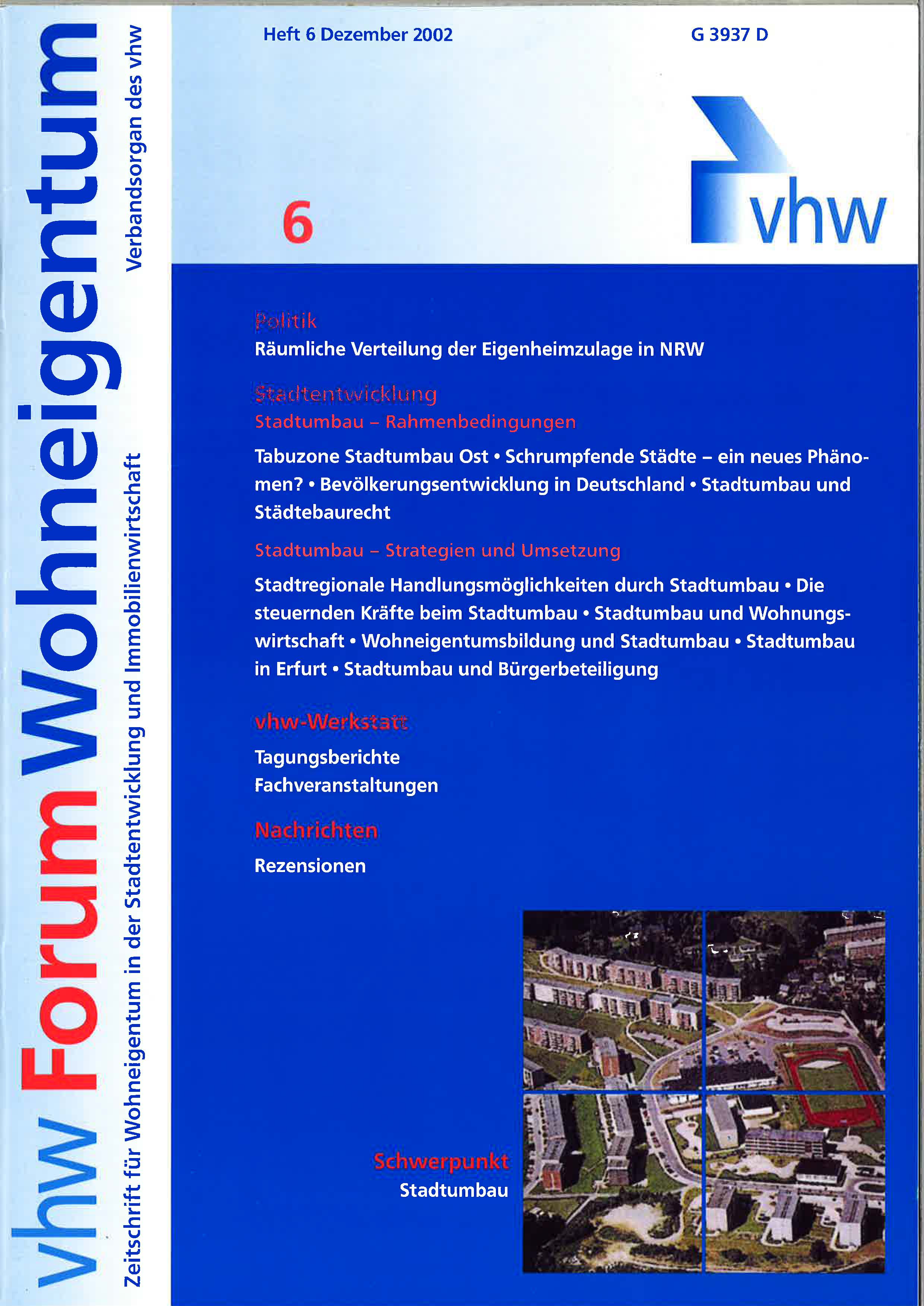

Erschienen in

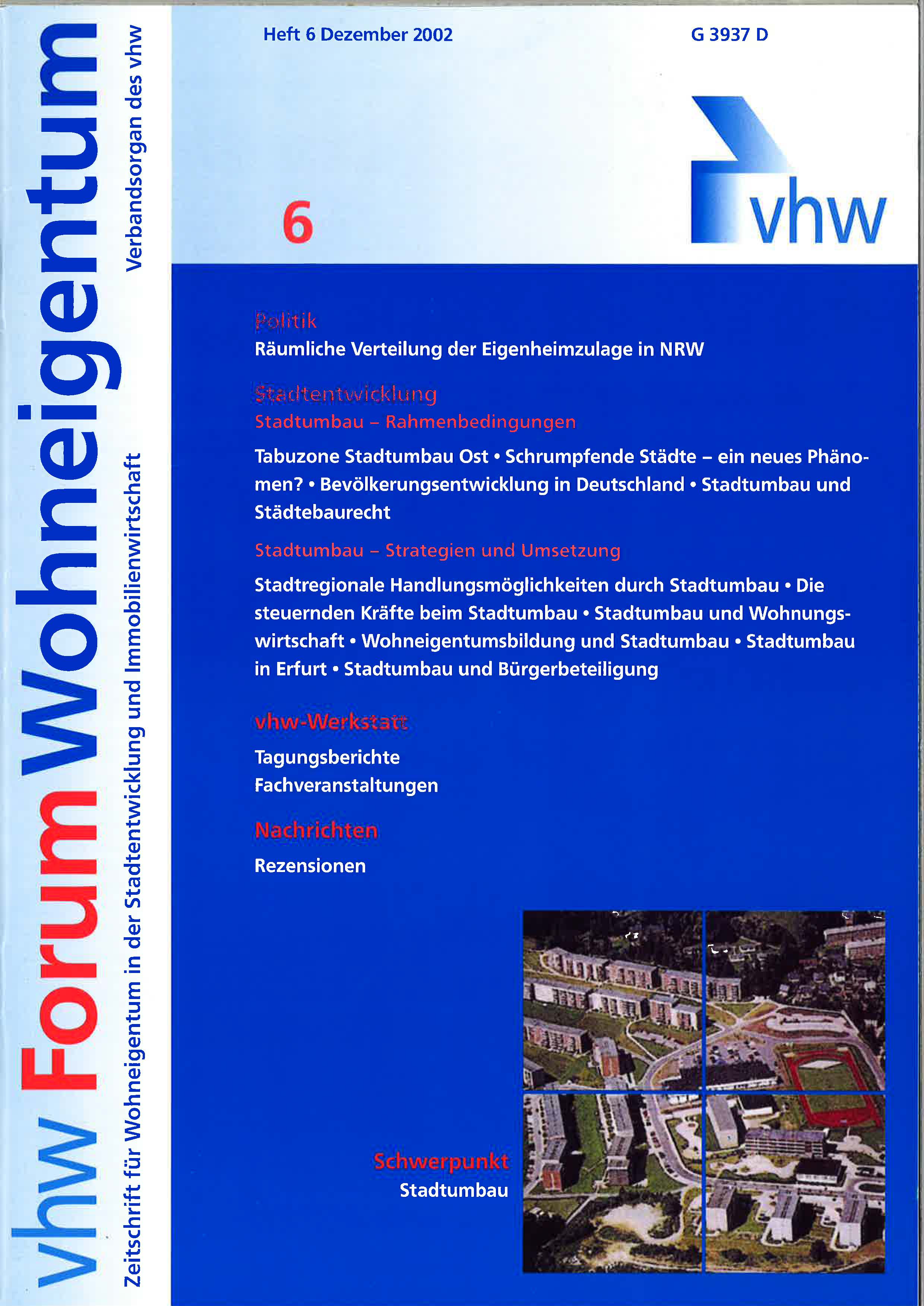
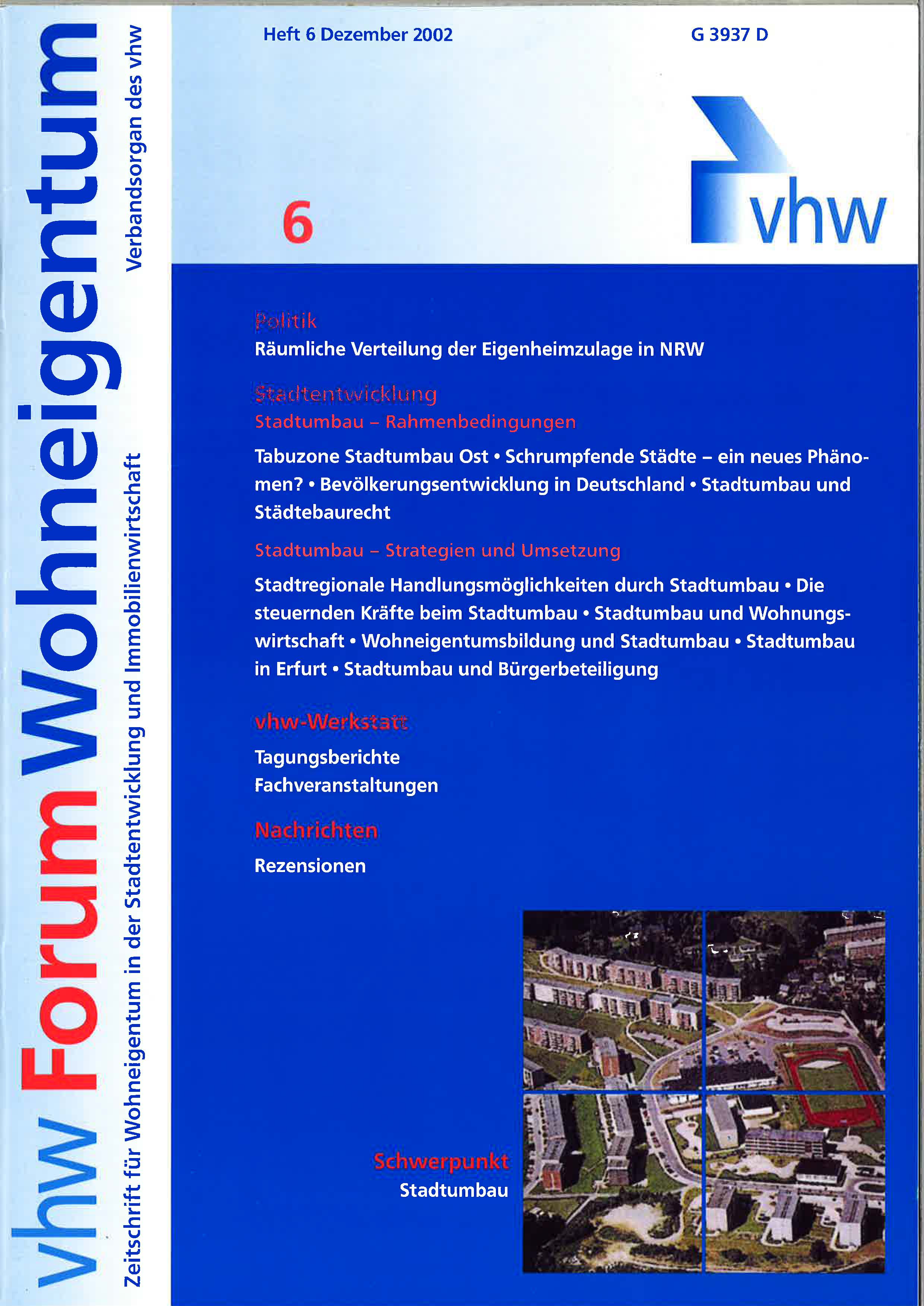
Erschienen in
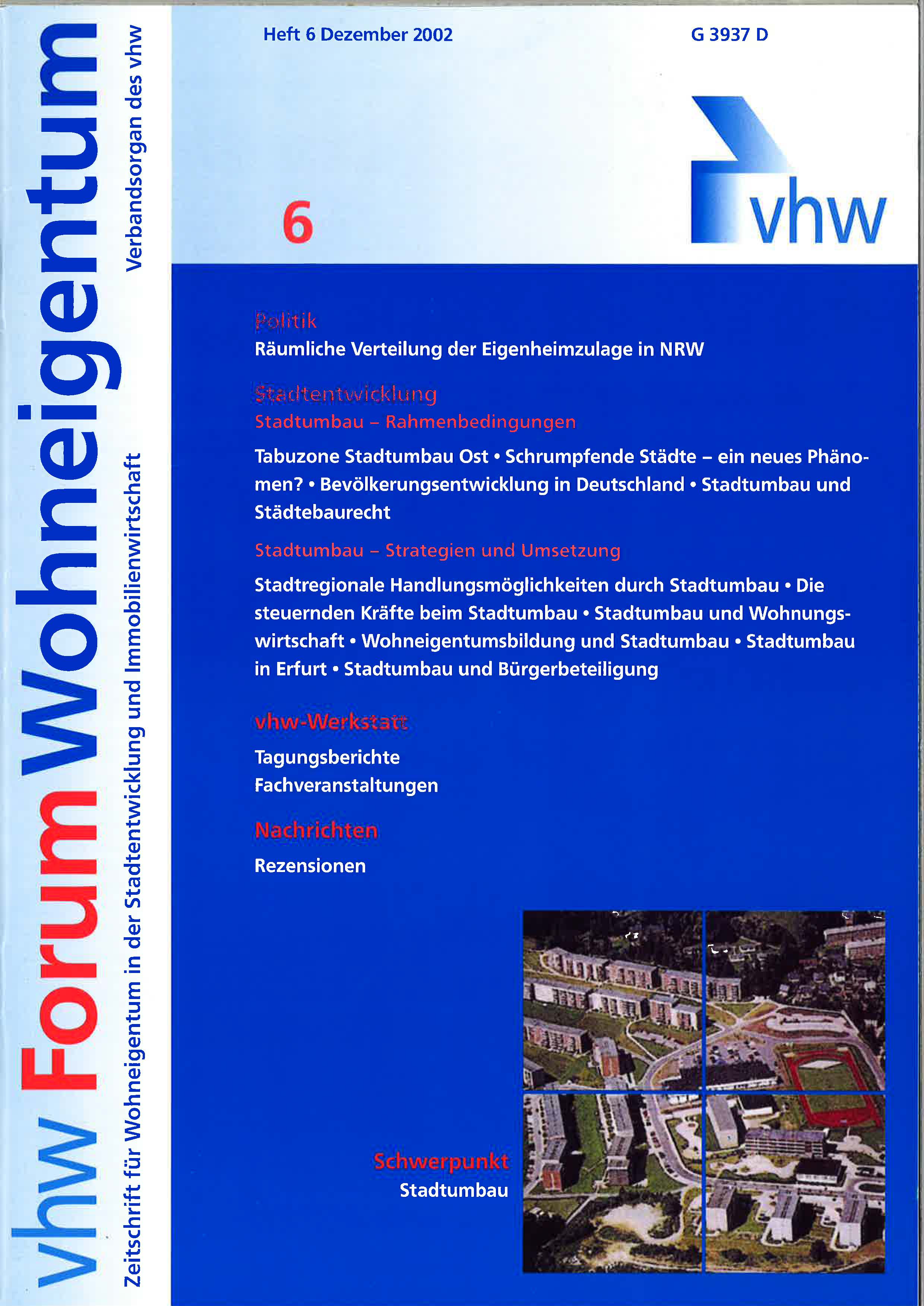

Erschienen in Heft 4/2017 Gemeinwesenarbeit und Stadtentwicklung
Der Wohnungsmarkt erlebte in den letzten Jahrzehnten unterschiedlichste Zyklen. Die Zeiten, in denen Vermieter sich ihre Mieter "aussuchen", sind jedoch (abgesehen von Metropolstädten wie z. B. Hamburg und München) längst vorbei, auch wenn sich die Markt- bzw. Vermietungssituation in vielen Städten für Vermieter insbesondere aufgrund der jüngsten Flüchtlingssituation wieder verbesserte. Viele Stadtteile und Wohnquartiere standen und stehen vor großen Herausforderungen: Armut, Bildungsbenachteiligung, Bewahrung des sozialen Friedens aufgrund multikultureller Nachbarschaften und unterschiedlicher Lebensgewohnheiten, mangelnde Sauberkeit bzw. verantwortungsloser Umgang mit Müll, Ruhestörung durch Mitmieter, Stigmatisierung, Verwahrlosung, Generationskonflikte etc. sind nur einige Aspekte, die das Leben und das Image in Stadtteilen negativ beeinflussen können.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2017 Gemeinwesenarbeit und Stadtentwicklung
Gemeinwesenarbeit als Handlungsfeld der Sozialen Arbeit widmet sich strukturellen Verbesserungen und demokratischen Beteiligungsprozessen in herausfordernden Nachbarschaften. Bereits seit vielen Jahrzehnten wird Gemeinwesenarbeit in Stadtteilzentren und Nachbarschaftshäusern umgesetzt, allerdings ist der strukturelle Veränderungsansatz durch eine chronische Unterfinanzierung häufig unerreichbar. Ende der neunziger Jahre wurde bundesweit das Städtebauförderprogramm Soziale Stadt eingeführt, um integriertes Handeln in benachteiligten Stadtteilen zu fördern. Endlich Geld für die Gemeinwesenarbeit dachten viele, doch die Ausgestaltung des Förderprogramms und die Realitäten vor Ort sind vielschichtig und die Auswirkungen unzureichend beforscht.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2016 Fluchtort Kommune
Zum zweiten Mal seit 2014 fand am 22. Juni 2016 die Preisverleihung im Wettbewerb Preis Soziale Stadt im Berliner Radialsystem statt und wieder hatten die Organisatoren Glück mit dem Wetter, so dass die rund 300 Teilnehmer noch lange nach der Veranstaltung am Ufer der Spree zusammensitzen konnten. Vorher hatten sie eine Preisverleihung erlebt, in der erstmals Preise in sechs Kategorien vergeben wurden. Insgesamt waren 18 Projekte aus ganz Deutschland nominiert, die mit ihren Vertretern nach Berlin angereist waren. Diese wurden zusammen mit den zahlreichen Gästen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft von den beiden Moderatoren Dr. Diana Coulmas vom vhw und Dr. Bernd Hunger vom GdW in gewohnt lockerer Atmosphäre durch die Veranstaltung geführt.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2016 Fluchtort Kommune
Nach der Auseinandersetzung mit einer repräsentativen Rathausmitte und zentralen Foren z. B. für Kultur und Bildung drängt sich die Frage auf, ob sich nicht in den verschiedenen Stadtteilen bis hin in die weiter entfernten Rand-Quartiere ebenfalls besondere Bürgerzentren befinden müssten. Nach allem was wir in diesen dramatischen Zeiten über Gesellschaft und Städtebau lernen, kann man darauf nur mit einem klaren Ja antworten. Neben den Stadtteilen mit ihren angestammten Wohnquartieren geraten die Vorstadt-Wohnsiedlungen bei der Integrationsdebatte wieder in den Fokus. Besonders zeigt sich das bei den Banlieues um Paris. Was nützt eine strahlende und stolze Mitte, wenn es in vielen Vororten aufgrund von krassen Integrationsdefiziten rumort oder gar brennt?
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2017 Vielfalt und Integration
Stadtplanung und Stadtentwicklung sind mehr als ein Fachgebiet oder ein Bauprojekt. Denn sie stellen unverzichtbare Bausteine für die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt dar, sind somit Arbeit an den Grundlagen der lokalen Demokratie. Nicht umsonst beginnt einer der neuesten Ratgeber gegen die Demokratiekrise mit einer starken These, die da lautet: Liebe deine Stadt (Wiebicke 2017). Das Tun und das Lassen der Stadtplaner wirken über Jahrzehnte auf Menschen zurück. Deren Prägekraft, angefangen vom Haus im urbanen Umfeld, hat in den 1960er Jahren Alexander Mitscherlich schon trefflich beschrieben in der „Unwirtlichkeit unserer Städte“. Zwischendrin gab es eine lange Phase, in der es keine planenden Hände mehr zu geben schien, weil die Städte vor der Ohnmacht der Immobilien- und Grundstücksmärkte zu kapitulieren schienen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2017 Vielfalt und Integration
Von allen Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt Zürich haben über 30% keinen Schweizer Pass. Weitere rund 30% können (je nach Definition) als Personen mit Migrationshintergrund bezeichnet werden. Es ist also eine Tatsache, dass in der Stadt Zürich für europäische Verhältnisse eher überdurchschnittlich viele Migrantinnen und Migranten leben. Ebenso ist es eine Tatsache, dass die Stadt Zürich in den letzten Jahren in internationalen Rankings stets sehr gut bewertet wurde und folglich als ein Ort mit einer hohen Lebensqualität bezeichnet werden kann. Man könnte sich folglich fragen, ob denn die Stadt Zürich trotz der vielen Ausländerinnen und Ausländer eine hohe Lebensqualität hat oder ob sie dies gerade wegen der Zugewanderten hat.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2017 Sozialorientierung in der Wohnungspolitik
Viele Kommunen wollen in ihren Quartieren Vielfalt fördern, aber häufig sehen am Reißbrett geplante Neubaugebiete eher monoton aus. Dahinter steckt kein böser Wille: So benötigen beispielsweise nachbarschaftliche Baumodelle wie Genossenschaften und Baugruppen mehr Zeit, um Finanzierung und Baupläne abzustimmen. In der Zwischenzeit hat oft ein Entwickler das Baufeld höchstbietend erworben. Unter Ausnutzung der maximalen Geschossflächen, Abstände und Höhen baut er möglichst dicht, um seine Grundstücksausgaben zu amortisieren – das Ergebnis wirkt oft gleichförmig. Die Stadt Leverkusen und die von ihr beauftragte Tochtergesellschaft neue bahnstadt opladen GmbH (nbs:o) wollte diese Uniformität bei der städtebaulichen Entwicklung des ehemaligen Bahnausbesserungswerks im Stadtteil Opladen verhindern.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2017 Sozialorientierung in der Wohnungspolitik
Wo bisher viele Menschen auf engem Raum in einem achtgeschossigen Hochhaus im typischen Stil der 1970er Jahre lebten, entsteht in Unna das „Parkquartier Königsborn“. Das abgewohnte Hochhaus zwischen Bahnhof und Stadthalle wurde schon lange nicht mehr heutigen Ansprüchen gerecht. Ein grauer Riese mit unzähligen Klingelschildern, viele der 109 Wohnungen standen seit längerem leer, eine energetische Sanierung war nur unter nicht vertretbarem Aufwand möglich. Mit dem Neubau des „Quartiers Königsborn“ wird in enger Verzahnung von Wohnraumförderung und Städtebauförderung aus einer heruntergekommenen Immobilie eine neue Heimat für Jung und Alt – ein Neubauprojekt, das auf das gesamte Quartier positiv ausstrahlt.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2017 Sozialorientierung in der Wohnungspolitik
Bürgerschaftliche Initiativen übernehmen in immer mehr Stadtteilen Verantwortung für ihre Nachbarschaft. Dort, wo kommunale Infrastruktur, bezahlbarer Wohnraum, Kultur-, Lern- und Begegnungsorte drohen verloren zu gehen oder fehlen, werden Bürgerinnen und Bürger aktiv und entwickeln Immobilien für sich und andere. Doch die Rahmenbedingungen bei der Bodenvergabe, der Finanzierung und der Zusammenarbeit mit Kommunen sind zum Teil schwierig. Aber es gibt viele positive Beispiele und das Netzwerk Immovielien, das diese Rahmenbedingungen verbessern will.
Beiträge