
Erschienen in Heft 2/2020 Quartiersentwicklung und Wohnungswirtschaft
Quartiersentwicklung. Soziale Quartiersentwicklung. Soziales Management. Quartiersmanagement. Stadtteilmanagement. Kiezkoordination. Begrifflichkeiten, die verwendet werden, wenn es darum geht, eine Überschrift dafür zu finden, dass sich kommunale Wohnungsunternehmen in ihren Wohnquartieren über die eigentliche Bestandsbewirtschaftung hinaus engagieren und neben der Bereitstellung von Wohn- und Gewerberaum soziale Verantwortung für das "Drumherum" übernehmen. Die Erwartungshaltung an die kommunale Wohnungswirtschaft ist, dabei wirtschaftlich zu agieren, gleichzeitig gesellschaftlich zu wirken und zudem (wechselnde) politische Forderungen zu erfüllen.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2021 Verkehrswende: Chancen und Hemmnisse
Neu ist die Diskussion über die Verkehrswende nicht – bereits in den 1980er Jahren wurde der Begriff genutzt, um anknüpfend an die damals eingeleitete Energiewende auch im Verkehrsbereich eine Umkehr diskutieren zu können. Geändert hat sich allerdings inzwischen die Dringlichkeit einer Wende – unterstrichen durch Ziele, die auf Ebene der EU und des Bundes verbindlich formuliert wurden und die eine klare Zeitperspektive mitsamt Zwischenzielen haben: Europa und auch Deutschland wollen im Jahr 2050 klimaneutral sein. In diesem Beitrag geht es darum, was dieses konkrete, quantifizierte und verbindliche Ziel für die bis dahin aufgestellten und hoffentlich umgesetzten Konzepte rund um Mobilität und Verkehr bedeutet. Grundlage bilden die Ergebnisse eines kürzlich für das Umweltbundesamt (UBA) erarbeiteten Gutachtens.
Beiträge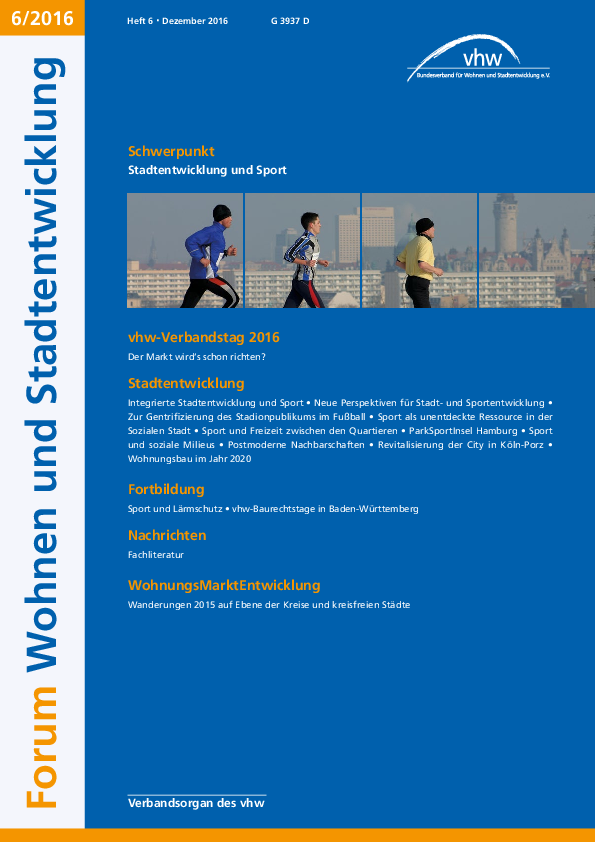
Erschienen in Heft 6/2016 Stadtentwicklung und Sport
Zum zweiten Mal nach 2013 war der vhw mit seinem Verbandstag zu Gast in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am Berliner Gendarmenmarkt. Trotz umfangreicher Sperrungen rund um das Brandenburger Tor im Rahmen des Staatsbesuches von Barack Obama füllte sich der Leibnizsaal pünktlich zum Beginn der Tagung mit rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Anschluss an die jährliche Mitgliederversammlung des Verbandes. Das Thema des vhw-Verbandstages 2016 – „Der Markt wird’s schon richten? Wohnungspolitik als Gemeinschaftsaufgabe“ – zog zahlreiche Akteure aus Politik, Verwaltung, Wohnungswirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft an, um ein dringendes Handlungsfeld mit den geladenen Expertinnen und Experten zu diskutieren. Die Moderation übernahm Elke Frauns aus Münster.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2016 Renaissance der kommunalen Wohnungswirtschaft
Die Wohnungswirtschaft steht vor großen Herausforderungen: Einerseits soll die Energiewende bei bezahlbaren Mieten und hoher Energieeffizienz geschafft werden, gleichzeitig stellen der demografische Wandel und die älter werdende Gesellschaft besondere Ansprüche an die Vermieter. Die Wohnungsunternehmen sollen auch angesichts sinkender Sozialbindungen weiterhin bezahlbaren Wohnraum für alle schaffen und vor dem Hintergrund der steigenden Zahl der Migranten für funktionierende Nachbarschaften sorgen. Gerade in den sogenannten Schwarmstädten, die von starken Zuzügen geprägt sind, wächst die Bedeutung gut funktionierender Wohnungsunternehmen. Kommunale Wohnungsunternehmen sind hier ein entscheidendes Entwicklungsinstrument für die Städte.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2018 Gesundheit in der Stadt
Das eigene, nahe Umfeld ist für Kinder wichtig und prägend. Siedlungs- und quartierbezogene Freiräume sind für sie somit besonders wichtige Orte außerhalb der eigenen Wohnung und außerhalb der Schule oder organisierter Freizeit. In diesem Zusammenhang wichtige Fragen sind, was ein kindergerechter Freiraum ist, wie ein solcher entwickelt und gestaltet werden kann und welche Bedeutung der partizipative Entstehungsprozess und die Nutzung des Freiraums für Kinder haben. Im vorliegenden Artikel werden Freiräume, Partizipation und Gesundheit kurz skizziert, um dann auf den Einfluss der partizipativen Prozesse als solche auf einige gesundheitsrelevante Faktoren einzugehen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2017 Gemeinwesenarbeit und Stadtentwicklung
Gemeinwesenarbeit (GWA) und Sozialraumorientierung (SRO) werden häufig als synonyme Begriffe benutzt, gelegentlich wird SRO dabei als moderner Nachfolger der historisch älteren GWA interpretiert. Damit einher geht die Befürchtung von GWA-Akteuren, dass ihre fachliche Identität einer gesellschaftskritischen und ‚systemdehnenden‘ GWA vom vermeintlich breiteren Konsenskonzept SRO bedroht und am Ende absorbiert werde. GWA und SRO sind aber weder Synonyme noch gehen sie als unterschiedslose Handlungsansätze Sozialer Arbeit ineinander auf. Sie haben verschiedene Ausgangspunkte und Zielsetzungen, können sich dabei aber gerade aus ihrem wechselseitigen Spannungsverhältnis heraus sinnvoll und fruchtbar für die Gestaltung von Gemeinwesen ergänzen.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2011 Städtenetzwerk Lokale Demokratie

Erschienen in Heft 6/2014 Infrastruktur und soziale Kohäsion
Auch nach mehr als einem Jahrzehnt vertiefter Diskussionen und Forschungen über die Folgen von und den Umgang mit kleinräumigem Bevölkerungsrückgang hat das Thema nichts an Aktualität verloren. Im Gegenteil: Längst ist Schrumpfung ein gesamtdeutsches Problem geworden (Küpper et al. 2013). Verlief sie in vielen ostdeutschen Städten und Gemeinden als radikaler Einschnitt, so ist Schrumpfung in Niedersachsen, Hessen und anderen westdeutschen Bundesländern heute ein eher schleichender Prozess und knüpft dabei doch vielerorts, z. B. entlang der vormaligen innerdeutschen Grenze, an Entwicklungen der 1970er und 1980er Jahre an.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2014 Zuwanderung aus Südosteuropa – Herausforderung für eine kommunale Vielfaltspolitik
Allgemein gilt, dass Zuwanderung weit überwiegend auf der Grundlage persönlicher Kontakte und privater Netzwerke erfolgt. Die Rolle staatlicher bzw. institutioneller Angebote ist also nur von geringer Bedeutung. Für die Wohnsituation von Zuwanderern bedeutet dies, dass die Wohnbedingungen und die Zugangsmöglichkeiten zum Wohnungsmarkt ihrer jeweiligen privaten oder sonstigen Kontakte ausschlaggebend sind. Sind hier geringes Einkommen und Ausgrenzung mit schlechten Wohnverhältnissen verbunden, erfolgt die weitere Zuwanderung in ebenso schlechte bis unzumutbare Wohnverhältnisse.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2025 Nachhaltige Stadt- und Sportentwicklung

Erschienen in Heft 4/2024 Transformation des Wohnens
Der als „Bau-Turbo“ angekündigte § 246e des Baugesetzbuchs verspricht eine beschleunigte Genehmigung von Wohnungsbauvorhaben durch weitreichende Abweichungsmöglichkeiten von planungsrechtlichen Bindungen. Beschleunigung ist allerdings kein Wert an sich. Eine unterkomplexe Wohnungspolitik birgt das Risiko, statt mehr bezahlbare Mietwohnungen vor allem unerwünschte soziale und ökologische Nebenwirkungen auszulösen. Unabhängig davon, ob der weitgehend kontraproduktive Paragraf tatsächlich Gesetz wird, besteht die Chance, diese Provokation in fachliche und zivilgesellschaftliche Energie für einen zukunftsfähigen Pfad sozial- und klimagerechter Wohnraumversorgung zu transformieren.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2025 Kommunen zwischen Zukunftsorientierung und Gegenwartsbezug
Private Haushalte haben unterschiedliche Anforderungen und Wünsche an ihren Wohnort. Diese hängen ab von der jeweiligen Lebensphase und Lebenslage, aber auch von den individuellen Vorstellungen, Präferenzen, Lebensstilen und Aktivitätsmustern der Haushaltsmitglieder. Für die tatsächlichen Wohnstandortentscheidungen besitzen dann auch die Ressourcen des Haushalts und die Rahmenbedingungen der Angebotsseite zentrale Bedeutung. Bei begrenzten Ressourcen und einem anbietergesteuerten, knappen Immobilienmarkt wirken diese Ressourcen und Rahmenbedingungen vor allem im Sinne von Beschränkungen des mentalen und räumlichen Suchrasters. Das ‚mentale Suchraster‘ deutet dabei an, dass bereits die Wünsche und Präferenzen durch diese Rahmenbedingungen und Ressourcen ‚zensiert‘ sein können – warum sollte man sich etwas wünschen, von dem man weiß, dass es nicht realisierbar ist?
Beiträge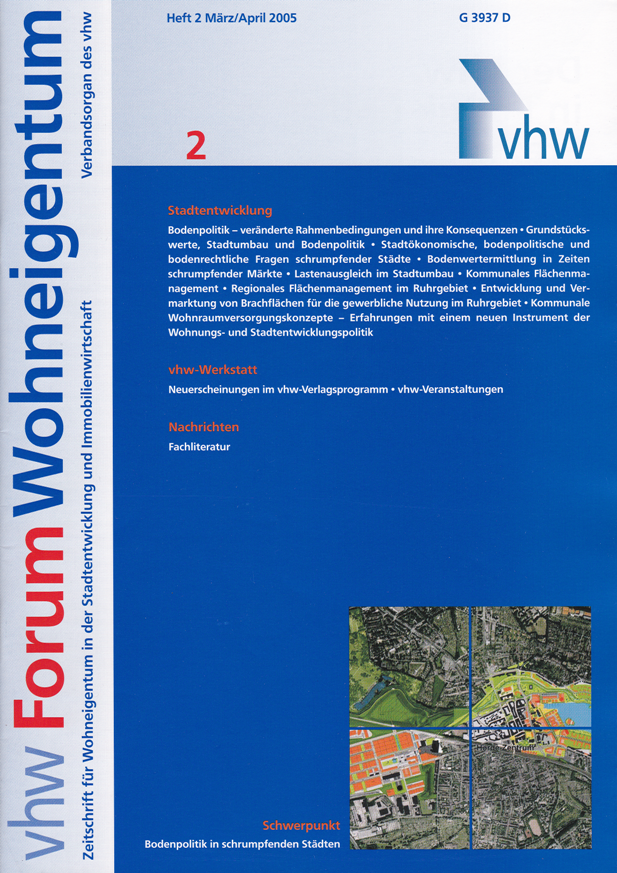
Erschienen in Heft 2/2005 Bodenpolitik in schrumpfenden Städten
Ankündigungen
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2005 Stadtregional denken – nachfrageorientiert planen
Ankündigungen
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2007 Soziale Stadt – Bildung und Integration

Erschienen in Heft 6/2006 Neue Investoren auf dem Wohnungsmarkt – Transformation der Angebotslandschaft
"Dresden" und "Freiburg" markierten 2006 die Kontrapunkte beim Umgang mit kommunalen Wohnungsbeständen, den "Objekten der Begierde" für die Neuen Investoren am deutschen Wohnungsmarkt. Der vollständige Verkauf des kommunalen Bestandes im März in Dresden und die bemerkenswert deutliche Ablehnung entsprechender Bestrebungen durch einen Bürgerentscheid im November in Freiburg dokumentieren den stark polarisierten Charakter der öffentlichen Debatte und die tiefe Verunsicherung vieler Bürger. Die Schärfe der Positionen zu den möglichen Folgen des Verlustes öffentlicher Steuerungsfähigkeit für Wohnungsversorgung und Wohnkostenbelastung der Bürger steht weiterhin in einem auffälligen Kontrast zur Qualität und Belastbarkeit bisheriger Folgeanalysen.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2007 Den demografischen Wandel gestalten!

Erschienen in Heft 4/2008 Engagementpolitik und Stadtentwicklung – Ein neues Handlungsfeld entsteht
Die drei Fallstudien zur "Topografie des Engagements" dokumentieren eine Fülle von Beispielen für Engagement auf Quartiersebene, gerade auch von benachteiligten Menschen. Auf den ersten Blick ergibt sich dadurch – mit je unterschiedlichen Ausprägungen – ein eindrucksvolles Bild ausdifferenzierter Engagementlandschaften, die selbst unter schwierigen Rahmenbedingungen lebendig und leistungsfähig erscheinen. Auf den zweiten Blick offenbaren die Studien allerdings auch eine Realität, die von erheblichen Ambivalenzen und Widersprüchen gekennzeichnet ist.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2010 Integration und Stadtentwicklung
Die aufgeregte Integrationsdebatte der letzten fünf Jahrzehnte hat den Umgang mit Migranten in der Bundesrepublik tief greifend geprägt und ein Rezeptwissen hervorgebracht, das auch heute noch in allen gesellschaftlichen Bereichen als Maßstab der Orientierung gilt. Pauschal ist von Anpassungsproblemen der Migranten, dem Rückzug in ethnische Nischen und von Parallelgesellschaften die Rede. Vor allem im politischen Kontext ist der Integrationsbegriff zu einer Schlüsselkategorie geworden. Immer mehr Städte suchen in letzter Zeit händeringend nach Integrationskonzepten.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2012 Integrierte Stadtentwicklung und Bildung
Die empirischen Daten erlauben keinen Zweifel daran, dass der Demokratie gegenwärtiger Bauart die Menschen davonlaufen: Die Beteiligung an den Wahlen sinkt seit geraumer Zeit dermaßen deutlich, dass man nicht mehr daran vorbeikommt, von einem Trend zu sprechen. Ungeachtet dessen steigt die Zahl der Wechselwähler, die keine eindeutige Bindung zu einer bestimmten Partei mehr besitzen. Aber auch die Zahl der beharrlichen Nichtwähler steigt immer mehr an und wird nur durch gelegentliches Protestwahlverhalten gebremst. Die Mitgliedschaft in den Parteien, die nie sonderlich hoch war, sinkt insgesamt gesehen kontinuierlich weiter ab. Eine Krise der Demokratie abstreiten zu wollen, würde somit offenbar einem Beschwichtigungsversuch gleichkommen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2023 Bildung in der Stadtentwicklung
Zum Jahresbeginn 2023 gab es in Berlin Übergriffe von jungen Erwachsenen auf Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei, die ein erregtes politisches und mediales Echo auslösten. In Stellungnahmen, die im Brustton sozialwissenschaftlicher Erklärung vorgebracht wurden, hieß es unter anderem: Viele der jungen Straftäter würden in Großwohnsiedlungen in den Randbezirken leben. Dort könne aufgrund der sozialen Zusammensetzung der Bewohner Integration nicht gelingen. Auf dem Fuße folgten aus Verbänden und Parteien Forderungen nach einer besseren sozialen Mischung. Das Kompetenzzentrum Großsiedlungen, eine unternehmensnahe Gründung der landeseigenen Wohnungsunternehmen, trat für eine Herabsetzung der Wiedervermietungsquote an die untersten Einkommensgruppen ein, um eine bessere soziale Mischung der Bevölkerung sicherzustellen. Die Ereignisse rund um den Jahreswechsel warfen ihren Schatten bis hinein in die schwarz-rote Koalitionsvereinbarung. Das Leitbild der sozialen Mischung wird hier aus der tagespolitischen Auseinandersetzung herausgenommen und im sozialwissenschaftlichen Kontext überprüft. Gefragt wird, ob es sich um ein taugliches Leitbild der städtischen Planung handelt und ob es funktionieren kann. Die Antwort, das sei vorab verraten, lautet: "Nein".
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2018 Gemeinwohlorientierung in der Bodenpolitik
Die vom Bundesamt für Statistik (Destatis 2017) veröffentlichte Statistik zu den Kaufwerten für Bauland weist beim baureifen Land eine Verdoppelung der Preise von 80,- Euro pro Quadratmeter in 2002 auf annähernd 160,- Euro in 2016 aus. Aufgrund der heterogenen Raumentwicklung in Deutschland stellt es sich allerdings als nicht zielführend heraus, Durchschnittsbetrachtungen in ganz Deutschland bei der Preisentwicklung anzustellen. Eine solche Betrachtung führt oftmals zu eher unauffälligen Ergebnissen, da die angespannten und die entspannten bzw. schrumpfenden Märkte sich in einer solchen Betrachtung meist gegenseitig relativieren und somit kein realistisches Bild von den Dynamiken und Besonderheiten der jeweiligen Raumtypen entsteht.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2014 Wohnen in der Stadt – Wohnungspolitik vor neuen Herausforderungen
Die Energiewende kann nur als "Gemeinschaftswerk" gelingen, resümierte die Ethik-Kommission "Sichere Energieversorgung" 2011. In diesem Zusammenhang ist die Rede von einer "kooperativen Energiewende", die darauf fußt, dass sich viele Menschen, Gruppen und Institutionen für das Thema Energiewende einsetzen, z. B. indem sie ihren Energiebedarf senken, in energiesparende und erneuerbare Energien investieren sowie energiepolitische Maßnahmen unterstützen und aktiv mitgestalten. Dies gilt umso mehr im Wohnungsbestand, da hier noch nicht ausgeschöpfte Potenziale zur Minderung von CO2-Emissionen vorhanden sind. Vor dem Hintergrund einer breiten Beteiligung der Bürger stellt sich die Frage, welche Kommunikationsansätze Verhaltensänderungen in Richtung Energieeffizienz in Bestandssiedlungen forcieren.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2015 Einfamilienhäuser der fünfziger bis siebziger Jahre
In Ein- und Zweifamilienhausgebieten der 1950er bis 1970er Jahre steht aufgrund des stattfindenden oder bevorstehenden Generationenwechsels eine Phase des Umbruchs an. Die damals von jungen Familien bezogenen Ein- und Zweifamilienhausgebiete stehen vor der Herausforderung einer kollektiven Alterung ihrer Bewohner. Perspektivisch wird dies zu einem wachsenden Angebot auf dem Wohnungsmarkt führen, dem eine insgesamt sinkende Nachfrage gegenübersteht. Die Bevölkerungsvorausberechnung für Nordrhein-Westfalen schreibt das schon seit mehreren Jahren zu beobachtende Auseinanderdriften zwischen Wachstums- und Schrumpfungsregionen fort. Damit werden sich die regionalen Disparitäten weiter verstärken. Zu den Regionen mit rückläufiger wirtschaftlicher und Bevölkerungsentwicklung werden weite Teile Nordrhein-Westfalens zählen, während nur einige wenige Wachstumsinseln verbleiben.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2013 Gentrifizierung: Mehr als ein Markphänomen
In allen Zeitungen ist es zu lesen: Untergiesing ist das neue Szeneviertel in München. Für den "Lonely Planet" ist das Viertel, dem gerne nachgesagt wird, irgendwann Szeneviertel zu werden, nicht cool genug. In der Anfang März erschienenen neuen Auflage des Reiseführers mit dem Titel "Munich, Bavaria & the Black Forest" findet man keine einzige Zeile über den Stadtteil. Schnell wird klar, was dem einstigen Arbeiterviertel bevorsteht – das böse G.-Wort! Und wer sich mit den alteingesessenen Bewohnern über das Viertel unterhält, hört viel über die moustache YUPPIES, die "zugroast’n" Schnösel, die Schickeria 2.0 und das Boazn-Sterben. Die Heimat der "Ureinwohner" verändert sich und das Erscheinungsbild der eindringenden "Preißn" wird facettenreicher.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2009 Anerkennungskultur im bürgerschaftlichen Engagement
Stellen Sie sich einmal vor: ... im Jahr 2019 ist "Anerkennungskultur für alle" längst zum zentralen Slogan der Bürgergesellschaft geworden. Bei regelmäßigen Ehrungen von aktiven Bürgern, bürgerorientierten Verwaltungen und engagierten Kommunalpolitikern, die immer am Samstag-Nachmittag in der Halbzeitpause der Bundesligaspiele in den Stadien stattfinden und somit eine große Öffentlichkeit erreichen, ist eine ganz neue Kultur der Anerkennung entstanden.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2020 Ertüchtigung der Agglomerationen
In den zurückliegenden Jahren gelang es nicht, die notwendige Wohnungszahl zu errichten, um Zuzüglern in Ballungsregionen ausreichend Platz zu bieten – trotz großer Anstrengungen. In Berlin stieg beispielsweise zwischen 2013 und 2018 die Zahl der jährlich fertiggestellten Wohnungen von 6.641 auf 16.706, in Düsseldorf kletterte sie in diesem Zeitraum von 1.367 auf 2.575 und in Hamburg von 6.407 auf 10.674 Wohneinheiten. Laut einer Analyse des Instituts der Deutschen Wirtschaft ist dies aber nicht genug: Für Berlin rechnen die Experten in den Jahren 2019/20 mit einem Bedarf von rund 21.000 zusätzlichen Wohnungen. Wenn Wohnungsneubauten im gewünschten Maße realisiert werden und Ballungsräume lebenswert bleiben sollen, sollte der Platz in Innenstädten neu gedacht werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2024 Zukunft der Innenstädte in Deutschland

Erschienen in Heft 5/2014 Kommunikationslandschaften
Bürgerbeteiligung gehört in den deutschen Städten und Gemeinden bereits seit vielen Jahrzehnten zum „guten Ton“. Meist sind die Kommunen alleinige Verfahrensträger und die Verfahren sind an konkrete Projekte und vorgegebene Tagesordnungen gekoppelt. Alle Betroffenen werden eingeladen und man freut sich bei Politik und Verwaltung, wenn neben Experten auch viele Bürger anwesend sind. Die Teilnehmenden werden über die Pläne der Kommunen informiert, wodurch man, so die oft geäußerte und gerne auch sarkastisch zitierte Erwartung, den Bürger „mitzunehmen“ hofft. Manchmal wird zudem eine von über fünfzig komplexen, gleichwohl ähnlichen Beteiligungsformen durchgeführt, z.B. eine Charette. Anregungen und Bedenken werden von der Verwaltung in eine ggf. formelle Abwägung und Entscheidungsvorbereitung einbezogen, bevor das Ergebnis den Gemeinde- oder Stadträten zur verbindlichen Entscheidung übermittelt wird.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2017 Gemeinwesenarbeit und Stadtentwicklung
Soziale Medien und digitale Plattformen ermöglichen den Menschen sich weltweit zu vernetzen und auszutauschen. Das Aufkommen des Internets wird daher oft mit dem Bedeutungsverlust nahräumlicher Beziehungen in Zusammenhang gebracht. Seit Kurzem wächst in Deutschland jedoch ein vielfältiges Angebot an Nachbarschaftsplattformen, die Menschen digital in ihrer Nachbarschaft vernetzen und vor Ort zusammenbringen wollen. Bislang ist allerdings noch wenig über die Auswirkungen dieser Plattformen auf das soziale Zusammenleben und politische Engagement vor Ort bekannt. Diese Wissenslücke will der vhw mit dem Forschungsprojekt "Vernetzte Nachbarn" schließen.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2013 Soziale Stadt und Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklung
Was Fukushima für den Ausstieg aus der Atomenergie, bedeutet Stuttgart 21 für die Debatte über Bürgerbeteiligung. In den öffentlichen Debatten hat sich ein politischer Dammbruch vollzogen, die Staumauer repräsentativer Alleinvertretungsansprüche hat Löcher bekommen, mehr direkte Demokratie ist angesagt. Gegen mehr Bürgerbeteiligung ist heute (fast) niemand mehr. Unstrittig scheint, dass der verstärkte Rückgriff auf direkt-demokratische Formen die repräsentativen Strukturen ergänzen, vertiefen oder verbessern, aber nicht ersetzen kann. Direkt-demokratische Formen werden aber auch nicht mehr, wie noch über viele Jahrzehnte der Nachkriegszeit ("Weimar-Komplex") als systemwidrige Bedrohung für repräsentative Demokratien gesehen. Starke Vorbehalte gibt es allenfalls noch gegen Volksentscheide auf Bundesebene.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2018 Tourismus und Stadtentwicklung
Seit jeher spielt das „Alleinstellungsmerkmal“ bzw. ein unverwechselbares Nutzenangebot (auch USP – Unique Selling Proposition/Point) eine wesentliche Rolle bei der Inszenierung und Vermarktung von Orten als sogenannte „touristische Destinationen“. Hierzu werden „Eigenarten“ in Szene gesetzt und „Kundenvorteile“ herausgestellt, um sich mit diesen Wettbewerbsvorteilen von Mitbewerbern abzuheben und um vor allem Zielgruppen anzusprechen, die als Touristen in Stadt und Region kommen. Die Tourismusregion Sauerland macht sich als eine von sieben ExWoSt-Modellregionen in Deutschland auf den Weg zu einer verstärkten Kooperation zwischen Touristikern und Baufachleuten.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2014 Zuwanderung aus Südosteuropa – Herausforderung für eine kommunale Vielfaltspolitik

Erschienen in Heft 1/2025 Urbane Räume im digitalen Wandel
Digitale Nachbarschaftsplattformen sind inzwischen ein weit verbreitetes Phänomen. Etwa jede dritte Person in Deutschland gibt an, digitale Nachbarschaftsgruppen auf Social Media, Messengerdiensten oder Nachbarschaftsplattformen wie nebenan.de zu nutzen. Über sie werden nicht nur Gegenstände in der Nachbarschaft verkauft. Es werden auch gemeinschaftliche Aktivitäten im Quartier organisiert und sich gegenseitig mit Informationen über die Nachbarschaft, dem Verleihen von Werkzeugen und anderen Gegenständen oder mit praktischer Hilfe unterstützt. Es liegt also der Schluss nahe, dass diese Plattformen inzwischen Teil von Care-Infrastrukturen in Quartieren geworden sind. Allerdings, so lässt sich beobachten, gibt es strukturelle Unterschiede, wo und von wem diese digitalen Kommunikationstools in Nachbarschaften genutzt werden. Vor diesem Hintergrund fragt dieser Beitrag, welche Potenziale digitale Plattformen bieten, um gegenseitige Fürsorge in Nachbarschaften zu stärken – und wo sich Grenzen und Selektionsmechanismen bei der Nutzung der Plattformen zeigen.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2009 Lernlandschaften in der Stadtentwicklung
Schaut man sich in den europäischen Bildungslandschaften um, so fällt auf, dass insbesondere Länder ohne eine Tradition von Ganztags-Gesamtschulen daran arbeiten, diesen Schultypus mit ihrem bestehenden Bildungssystem kompatibel zu machen. Zu diesen Ländern gehören die Niederlande ebenso wie Deutschland, Österreich und die Schweiz, während die comprehensive school in Großbritannien und den Skandinavischen Ländern seit langem bekannt ist. Sowohl das deutsche wie das niederländische Bildungssystem – auf diese beiden Länder konzentriere ich mich im folgenden – zeichnen sich durch ein hoch selektives Schulwesen aus, das seinem Anspruch, allen Schülern optimale Entwicklungs- und Lernchancen zu bieten, nicht gerecht wird und in Legitimationsprobleme kommt. Insbesondere ist es nicht zu verantworten, dass Kinder mit Migrationshintergrund strukturell schlechtere Bildungschancen haben als ihre Altersgenossen aus einheimischen Familien.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2025 Infrastrukturen in ländlichen Räumen
Viele erfolgreiche Beteiligungsverfahren belegen sehr anschaulich ihren Mehrwert. Insbesondere in den großen Städten ist die Beteiligung zu einem wesentlichen Faktor in den Planverfahren geworden. Dazu ist inzwischen eine Vielzahl von – auch digitalen – Formaten entwickelt worden, mit denen es gelingt, die Bürger mitzunehmen und ihre Ortskenntnisse in den Prozess einzubringen. Unbestritten ist aber auch, dass mit den Verfahren ein erheblicher Aufwand verbunden ist, der personelle und finanzielle Ressourcen erfordert, über die die Großstädte im Regelfall verfügen. Das Kontrastprogramm hierzu liefern hingegen kleinere Städte und Gemeinden. Insbesondere in den dünn besiedelten ländlichen Räumen, deren Entwicklungsperspektive begrenzt ist, hat die Beteiligung der Betroffenen einen anderen Stellenwert als in den Großstädten. Unbestritten ist aber auch, dass mit den Verfahren ein erheblicher Aufwand verbunden ist, der personelle und finanzielle Ressourcen erfordert, über die die Großstädte im Regelfall verfügen.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2018 Kooperationen im ländlichen Raum
Städte und Regionen in Deutschland sind von unterschiedlichen demografischen und ökonomischen Entwicklungen geprägt. Besonders viele kleinere und mittlere Städte in Ostdeutschland abseits der prosperierenden Zentren in der Peripherie verlieren noch immer überproportional viele Einwohner oder sind stark überaltert. Der oft damit einhergehende Abbau wichtiger Infrastrukturen sowie sinkende finanzielle Einnahmen wirken sich dabei auf die Handlungsmöglichkeiten der Kommunen aus, neue Entwicklungspfade einzuschlagen. „Überhitzte Ballungsräume und abgehängte Regionen“ (Deutschlandfunk, 07.November 2018) haben in diesem Zusammenhang zuletzt medial und politisch große Aufmerksamkeit erfahren.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2025 Urbane Räume im digitalen Wandel

Erschienen in Heft 2/2019 Digitale Verwaltung
Die Digitalisierung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft schreitet mit großer Geschwindigkeit voran. Digital geht nicht mehr weg – die Digitalisierung hat Städte und Gemeinden längst erreicht und wird immer schneller. Die Zukunft der Kommunen ist digital – noch digitaler als bisher. Es gibt nur noch wenige Modernisierungs- und Veränderungsprojekte in der Kommunalverwaltung, die keinen IT-Bezug und damit eine digitale Grundlage haben. Sowohl die technische als auch die organisatorische Unterstützung derartiger Projekte steht im Mittelpunkt vieler Vorhaben mit der Fragestellung, wie können Verwaltungen ihre Leistungen und die damit verbundenen Prozesse effektiver und effizienter gestalten sowie nachhaltiger handeln.
Beiträge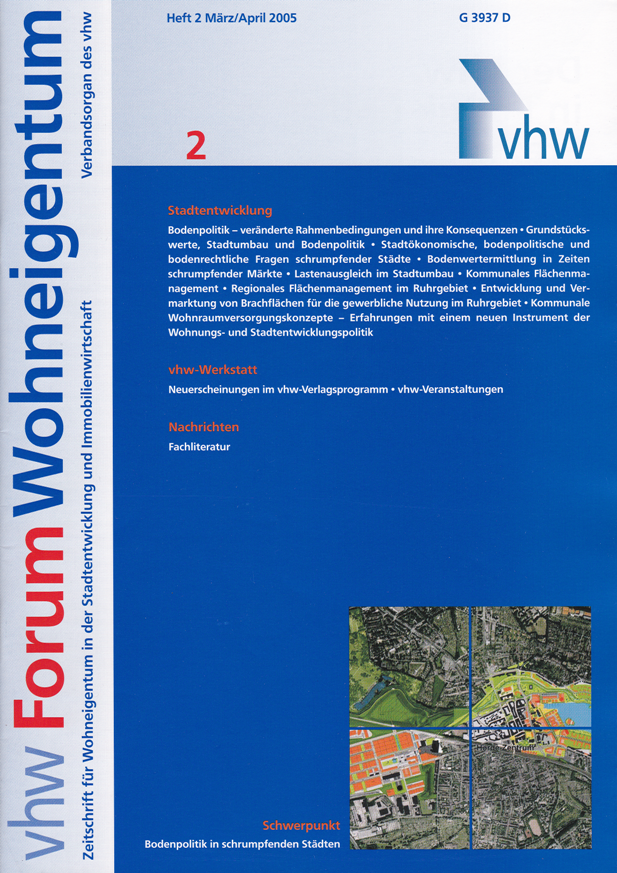
Erschienen in Heft 2/2005 Bodenpolitik in schrumpfenden Städten

Erschienen in Heft 1/2016 E-Commerce und Stadtentwicklung
Der Einzelhandel erlebt mit der Digitalisierung einen Strukturwandel, der diesen Wirtschaftszweig vermutlich tiefgreifender und nachhaltiger verändern wird als die Einführung der Selbstbedienung vor einem halben Jahrhundert. Das verändert auch die Innenstädte; einige dürften von der Veränderung profitieren, während andere stärker unter Druck geraten. Die digitalen Technologien beeinflussen die Wertschöpfungsprozesse in der Wirtschaft und das Verhalten der Kunden. Diese Veränderungen spielen sich in einem stagnierenden Wirtschaftszweig ab, der preisbereinigt seit zwei Jahrzehnten ein Nullwachstum verzeichnet.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2020 Stadtmachen
Die Idee, dass Nachbarschaften eine plan- und beeinflussbare Dimension des städtischen Lebens sind, lässt sich seit der Industrialisierung belegen. Auch gegenwärtig stellt Nachbarschaft eine relevante Planungs- und Interventionsebene dar. Im Kontext des gesellschaftlichen Wandels und einer zunehmenden Ausdifferenzierung erscheint eine solche Fokussierung vielversprechend, denn die Reduktion auf überschaubare sozialräumliche und territoriale Ausschnitte vermittelt Berechenbarkeit. Nachbarschaften zeichnen sich jedoch durch Prozesshaftigkeit und eine hohe Komplexität und Dynamik aus. Was eine Fokussierung auf Nachbarschaften beachten muss und welche Potenziale dadurch eröffnet werden, dieser Frage geht die hier vorgestellte Studie nach.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2019 Child in the City
Es gibt kaum einen Faktor, der den Alltag und die Entwicklung von Kindern mehr beeinflusst, als die räumliche Gestaltung des Wohnumfeldes und die damit verbundenen Möglichkeiten zum „freien Spiel“. Dies ist das zentrale Ergebnis von Studien, die von der Forschungsgruppe „Raum für Kinderspiel!“ in verschiedenen Ländern und Städten durchgeführt wurden. Sie zeigen auf einer breiten empirischen Grundlage, welche erhebliche Bedeutung die Qualität urbaner Räume auf den Lebensalltag und die Entwicklungschancen von Kindern hat. Daraus ergibt sich, dass sich durch eine auf Kinder bezogene Stadtentwicklungspolitik viel erreichen lässt.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2008 Engagementpolitik und Stadtentwicklung – Ein neues Handlungsfeld entsteht

Erschienen in Heft 6/2020 Klimaanpassung im Stadtquartier
In einer Pressemitteilung vom Mai 2020 macht die pantera AG, ein auf die Projektentwicklung von sog. Serviced Apartments spezialisiertes Unternehmen aus Köln, mit der Nachricht auf: "Jeder Zweite würde im Alter in eine kleinere Wohnung ziehen – über 10 Mio. m2 Wohnreserven in den Städten würden auf diese Weise frei." In Zeiten, in denen vor allem in Großstädten und Ballungsräumen ausreichender und bezahlbarer Wohnraum für viele Familien Mangelware ist und die Entwicklung von Neubauvorhaben viel Planungszeit in Anspruch nimmt, wäre es interessant, ob nicht bereits durch eine bessere Verteilung der vorhandenen Wohnflächen ein wirksamer Beitrag zur Befriedigung der Wohnungsnachfrage geleistet werden kann.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2009 vhw-Verbandstag 2009 / Leitbilder für die Innenstädte
Unternehmensengagement ist nach Auffassung des vhw notwendiger Bestandteil einer gelingenden Bürgergesellschaft. Alle müssen lernen zur Lösung der Probleme und fürs Gemeinwohl aufeinander zuzugehen und Wege zu finden – um dies zwischen Wohnungswirtschaft, Stadt, Bürgern und der Öffentlichkeit zu erleichtern, betreibt der vhw eine Art Kampagne: Ein Beirat wurde gebildet, eine Interviewstudie in Auftrag gegeben, Indikatoren entwickelt und eine Tagungsreihe ins Leben gerufen ("urbane Landschaften", beginnend am 24. November 2009) für diejenigen, die ihre Mitarbeiter fit machen wollen für eine strategische Ausrichtung des betrieblichen Engagements. Der nachfolgende Artikel beschreibt den Versuch drei Dimensionen auszumachen, in denen sich diese Strategie bewegen muss, um mehr zu sein als nur Sponsoring.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2024 Wasser als knappe Ressource
Live dirty, die young. Klingt wie ein Rock’n‘Roller-Mantra, war aber bis tief ins 19. Jahrhundert noch allseits gestorbene Wirklichkeit. Rhythmische Epidemien aller Art hielten erwartbare Lebensalter kurz und Einwohnerzahlen übersichtlich. Und dann kam vor fast genau 150 Jahren – tätä – und damit atemlose 4600 Jahre nach ihrer Erfindung in Pakistan die Kanalisation auch nach Berlin. Ab jetzt wurden die Städter zusehends mehr und immer älter.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2024 Transformation des Wohnens
Wie Menschen zusammenleben und welche Wohnform sie dafür wählen – gemeinschaftlich oder allein, im Eigentum oder zur Miete, in Ballungsräumen oder auf dem Land –, gehört zu den wichtigsten Feldern veränderter Lebens- und Arbeitsbedingungen der Spätmoderne. Klimakrise, gesellschaftliche Ausdifferenzierung und steigende Ansprüche stehen dabei knapper werdenden Ressourcen und fehlenden Angeboten gegenüber, sodass die Wohnungsfrage auch als politisches Thema zurück auf der Agenda ist. Das von subsolar* architektur und stadtforschung für den vhw durchgeführte laufende Projekt „Transformative Wohnformen“ nimmt deshalb Projekte im deutschsprachigen Raum in Augenschein, die mit unterschiedlichen Strategien und Instrumenten Alternativen zu gängigen Wohnmodellen schaffen. Eine Typologisierung schafft dabei eine Wissensbasis und einen Orientierungsrahmen, der nicht nur zu einer Diversifizierung des Wohnungsangebots, sondern auch zur sozialökologischen gesellschaftlichen Transformation im Themenfeld Wohnen beitragen möchte.
Beiträge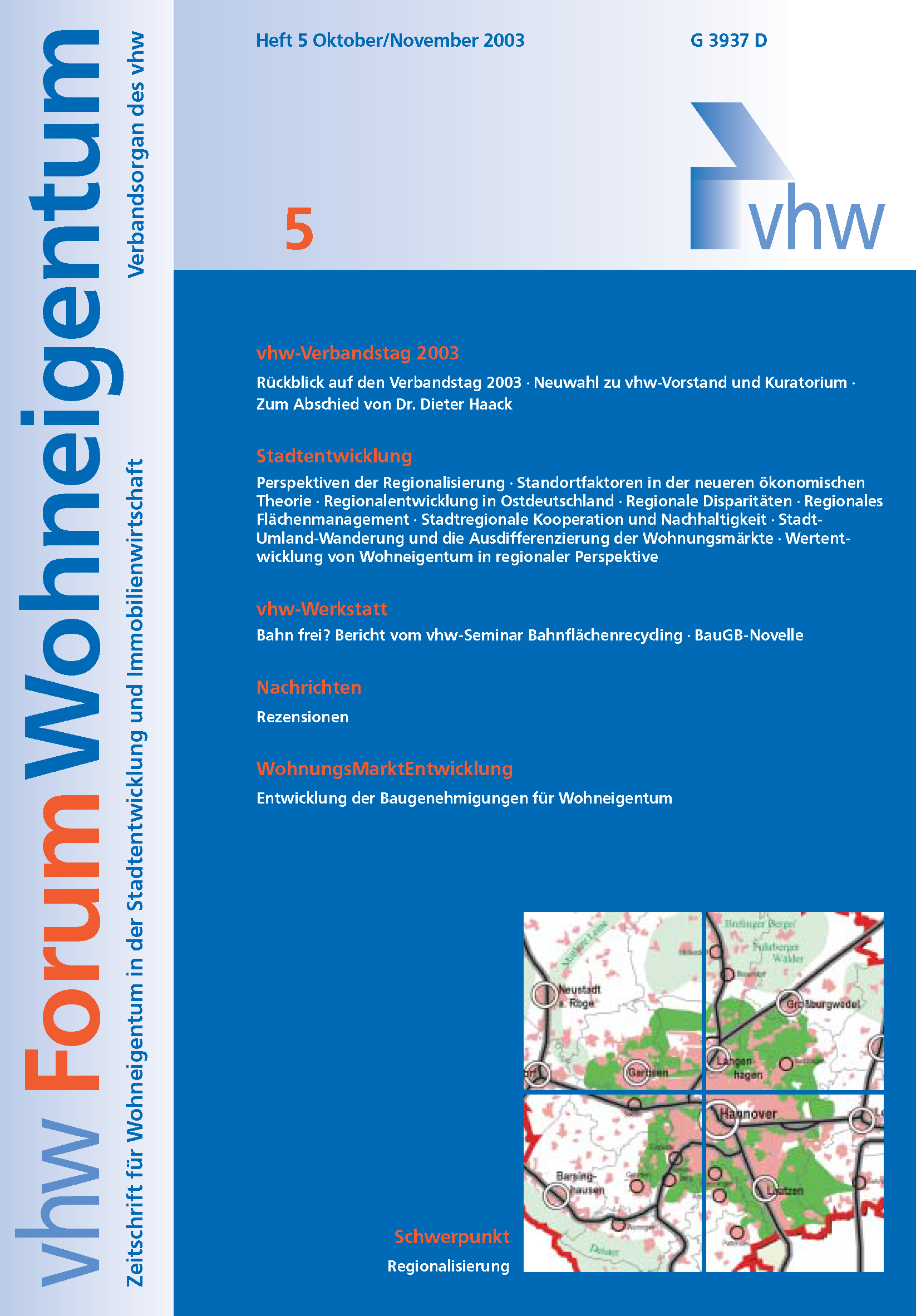
Neu zusammengesetzt präsentiert sich der vhw-Vorstand: Im Rahmen des jährlichen Verbandstages wählte die Mitgliederversammlung am 24. September in Potsdam eine neue Führungsriege: Vorstand, Kuratorium und Rechnungsprüfungsausschuss wurden neu bestimmt.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2019 Stadtentwicklung und Sport
Der Boxclub im Offenbacher Nordend ist vor allem ein Ort für junge Kämpfer, sportlich wie schulisch. Gestartet als Gewaltpräventions- und Integrationsprojekt im Jahr 2003 mit dem Ziel, jungen Männern Disziplin und Respekt anzuerziehen, konnten sich Clubpräsident Wolfgang Malik und Geschäftsführer Bernd Hackfort noch nicht ausmalen, wie gut das Projekt vorankommen würde und wie schnell es auch Preise und Auszeichnungen auf Bundesebene für ihre Arbeit geben würde. Der sportliche Erfolg ist auch nicht ausgeblieben. So boxen die jungen Schützlinge weit vorne mit, wie zuletzt im Finale der Deutschen Meisterschaft der Juniorinnen in Binz auf Rügen im April 2019.
Beiträge