
Erschienen in Heft 5/2010 Stadtentwicklung und demografischer Wandel

Erschienen in Heft 3/2011 Stadtentwicklung in Klein- und Mittelstädten

Erschienen in Heft 4/2010 Bürgerorientierung in der integrierten Stadtentwicklung

Erschienen in Heft 3/2013 Differenzierte Märkte – differenzierte Antworten am Wohnungsmarkt
Die 1954 gegründete Wohnungsbau-Genossenschaft "Treptow-Nord" eG verfügt aktuell über 4.412 Genossenschaftswohnungen an vier Standorten in Berlin-Treptow. Der überwiegend im Blockbau (Q3A, TB, WBS70) errichtete Bestand hat vorwiegend kleine Wohnungen, ca. 75 Prozent der Wohnungen haben 2 bis 2,5 Räume. Der Wohnungsbestand ist überwiegend saniert, allerdings fehlen Aufzüge und nur wenige Wohnungen sind barrierefrei. Viele Wohnungen entsprechen nicht den Ansprüchen der überwiegend älteren Genossenschaftsmitglieder. Die Bestandsmiete der WBG "Treptow-Nord" liegt mit 4,65 Euro je m² unterhalb des Berliner Durchschnitts (5,54 Euro je m²) sowie des Durchschnitts der Mitglieder des Verbandes der Berliner und Brandenburgischen Wohnungsunternehmen e.V. (BBU) (5,15 Euro je m²).
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2010 Öffentlicher Raum: Infrastruktur für die Stadtgesellschaft

Erschienen in Heft 2/2008 Transformation der Angebotslandschaft auf dem Wohnungsmarkt

Erschienen in Heft 5/2008 Klimaschutz im Städtebau
Veranstaltungsbericht
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2009 Lernlandschaften in der Stadtentwicklung
Der möglichst weitgehende Schutz des Klimas zählt zu den zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Neben der Bundesregierung haben inzwischen viele Kommunen, teilweise im EU-Rahmen, ehrgeizige Ziele bei der Reduzierung der für den Treibhauseffekt hauptverantwortlichen CO²-Emissionen formuliert, Deren erfolgreiche Umsetzung hängt jedoch nicht zuletzt von der lebensnahen Berücksichtigung von Einstellungs- und Verhaltensmustern sowie der aktiven Mitwirkung des Bürgers ab.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2008 Migranten-Milieus in Deutschland
Basierend auf einer empirischen Umfrage bei Unternehmen und Kommunen in Deutschland, die 2006/07 im Nachgang zum Forschungsprojekt "Gender Mainstreaming im Wohnungswesen" durchgeführt worden war, wurden vor gut einem Jahr bereits Teilergebnisse veröffentlicht. Dabei handelte es sich um die Auswertung der quantitativen Aspekte; gleichzeitig wurden nur die Antworten der Kommunen berücksichtigt, da der Rücklauf aus den Unternehmen zu gering gewesen war. Der folgende Artikel untersucht nun die qualitativen Aspekte der Umfrage: die subjektiven Einschätzungen zur Situation von männlichen und weiblichen Beschäftigten in den für Bauen und Wohnen zuständigen kommunalen Ämtern und Dezernaten. Ziel der Umfrage war es, Informationen über die Repräsentation von Frauen und Männern in Führungspositionen sowie ein Bild über die nach Geschlechtern differenzierte Situation in den Entscheidungsstrukturen im Wohnungswesen zu erhalten. Der Bezugsrahmen wurde bereits in dem Artikel vor einem Jahr vorgestellt, daher wird hier vorab nur eine kurze Zusammenfassung gegeben und im Übrigen auf den Beitrag aus 2007 verwiesen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2025 Kommunales Gebäudemanagement

Erschienen in Heft 4/2024 Transformation des Wohnens
Seit über 100 Jahren ist die gefährliche Wirkung von Asbest bekannt. Bereits im Jahr 1943 wurde Lungenkrebs als Folge von Asbestbelastungen in vielen Ländern als Berufskrankheit anerkannt. Seit 1970 wird die Asbestfaser offiziell als krebserzeugend bewertet. Erst zum 31.10.1993 trat das vollständige Herstellungs- und Verwendungsverbot für den Einsatz von Asbest in technischen Bauprodukten in Deutschland in Kraft. Ein weitgehendes Herstellungs- und Verwendungsverbot für Asbest in der EU besteht dagegen erst seit 2005.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2024 Transformation des Wohnens
Immobilienfirmen und Projektentwickler sollten spätestens in der derzeitigen Situation ihre Firma resilienter machen. Inwiefern sie Krisenmanagementtools dabei unterstützen und wie diese erarbeitet werden können, darum geht es in dem vorliegenden Beitrag.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2025 Korruptionsprävention in Kommunen

Erschienen in Heft 1/2024 Zukunft der Innenstädte in Deutschland
Große Modeketten prägten bis vor wenigen Jahren die Fußgängerzonen. Das hat sich geändert und schafft Raum für Konzepte anderer Branchen. Warum unter anderem Drogeriemärkte und Gastronomiebetriebe in Toplagen gehen und welche weiteren Branchen flächenhungrig sind, darum geht es im vorliegenden Beitrag.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2022 Auswirkungen des Klimawandels und die Anforderungen an das kommunale Krisenmanagement

Erschienen in Heft 2/2019 Digitale Verwaltung
Neue Medien und Technologien sorgen für eine immer einfachere und direktere Kommunikation sowie die leichte Zugänglichkeit von Informationen und Dienstleistungen. Dies betrifft insbesondere die sog. sozialen Medien, wie Facebook, YouTube oder andere Online-Dienste, die es den Nutzern ermöglichen, sich untereinander auszutauschen und Texte, Fotos und andere Inhalte zu teilen. Längst ist Social Media dabei kein reines Werbe- und Vermarktungsmedium mehr, sondern eine Möglichkeit der praktischen Umsetzung von Kundennähe. Dies betrifft keineswegs nur Unternehmen. Auch von Kommunen und der öffentlichen Verwaltung wird von Bürgerseite her erwartet, dass diese mit der technischen Entwicklung Schritt halten.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2019 Child in the City
In der Fragerunde der child in the city conference 2019 zu meiner Präsentation der partizipativen Schulhausplanung in Breitenbach, Kanton Solothurn Schweiz, wurde ich gefragt, ob durch die Beteiligung der Schulkinder in der Schulhausplanung nun ein besseres Projekt resultiert, als wenn Architekten das geplant hätten. Ich habe darauf geantwortet, dass diese Frage für die Beteiligten nicht relevant ist. Wichtig ist, dass sie als direkt Betroffene ihre Erfahrungen, Bedürfnisse und Ideen zur Raumplanung und Gestaltung für ihre neue Schule einbringen konnten und diese im Wettbewerb berücksichtigt wurden. Im Folgenden will ich aus der Praxis der Kinderpartizipation meinen Standpunkt erläutern.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht
Das Erbbaurecht fristet in Deutschland auch 100 Jahre nach Inkrafttreten am 15. Januar 1919 ein Nischendasein. Es ist kaum verbreitet und es herrschen viele Vorurteile in den Köpfen von Eigentümern, Investoren und Wohnungssuchenden. Dabei vergünstigt es den Immobilienerwerb und ist äußerst flexibel, weil Erbbaurechte vererbt, veräußert und beliehen werden können. Hinzu kommt, dass es sich sowohl für Wohn- wie für Gewerbeimmobilien eignet. Kommunen können Flächen gemäß diesem Modell auch für große Infrastrukturmaßnahmen vergeben wie etwa für Flughäfen oder Gewerbegebiete. Es sichert Grundstückseigentümern durch den Erbbauzins einen langfristigen Cashflow, dessen Höhe regelmäßig gemäß dem Verbraucherpreisindex angepasst werden kann.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht
Damit Erbbaurechte sich auch wirklich gegenüber Volleigentum durchsetzen können, müssen sie marktgerecht ausgestaltet sein. „Marktgerecht“ bedeutet, dass die Akteure das Erbbaurecht nicht nur deswegen wählen, weil sie mangels Alternativen faktisch dazu gezwungen werden, sondern weil sie es als mindestens gleichwertig gegenüber dem Volleigentum an einer Immobilie erachten. Gleichwertig – in Bezug auf was? Bei Anlageentscheidungen geht es niemals nur alleine um die Rendite, sondern auch um das Risiko. Mehr Rendite ist i.d.R. nur zu haben, wenn man zur Übernahme eines entsprechend höheren Risikos bereit ist.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht

Erschienen in Heft 3/2022 Zukunft Landwirtschaft: zwischen konkurrierender Landnutzung und Klimawandel
Eigentlich sollen Bauverträge Sicherheit bei Kosten und Fertigstellungsterminen geben. Diese ist gerade schwer zu garantieren. Zunächst führte die Pandemie zu Lieferengpässen, Personalmangel und Bauverzögerungen. Der Ukrainekrieg verschärft die Situation zusätzlich: Gestiegene Energiepreise, Materialmangel und eine hohe Inflation bringen Auftraggeber und -nehmer zunehmend in Bedrängnis. Was sollten Sie bei neuen Bauverträgen beachten, und wie sind gegebenenfalls laufende Kontrakte anzupassen, damit diese neuen Risiken transparent und fair verteilt sind?
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2022 Zukunft Landwirtschaft: zwischen konkurrierender Landnutzung und Klimawandel
Die landwirtschaftliche Produktion muss nachhaltiger werden. Mehr Vielfalt auf dem Acker und kleinere Anbauflächen könnten Ressourcen schonen, die Bodenfruchtbarkeit erhalten, den Verbrauch an Pflanzenschutz- und Düngemitteln senken und die Artenvielfalt fördern – davon sind Forschende des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. überzeugt. Ihre These testen sie nun unter Praxisbedingungen. Welche Auswirkungen hat es, wenn etwa Mais, Lupine und Sonnenblume auf kleinen Feldeinheiten direkt nebeneinanderstehen? Kann ein landwirtschaftlicher Betrieb am Ende damit noch Geld verdienen? Und welche Rolle müssen dabei neue Technologien, wie Roboter und künstliche Intelligenz, einnehmen? All das untersucht das Forschungsteam jetzt in einem einzigartigen Landschaftsexperiment.
Beiträge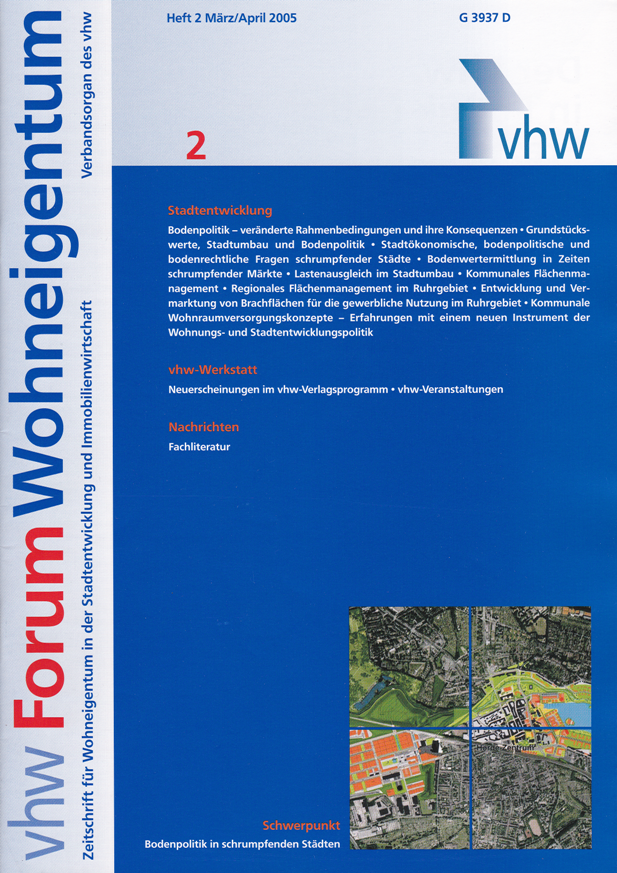
Erschienen in Heft 2/2005 Bodenpolitik in schrumpfenden Städten
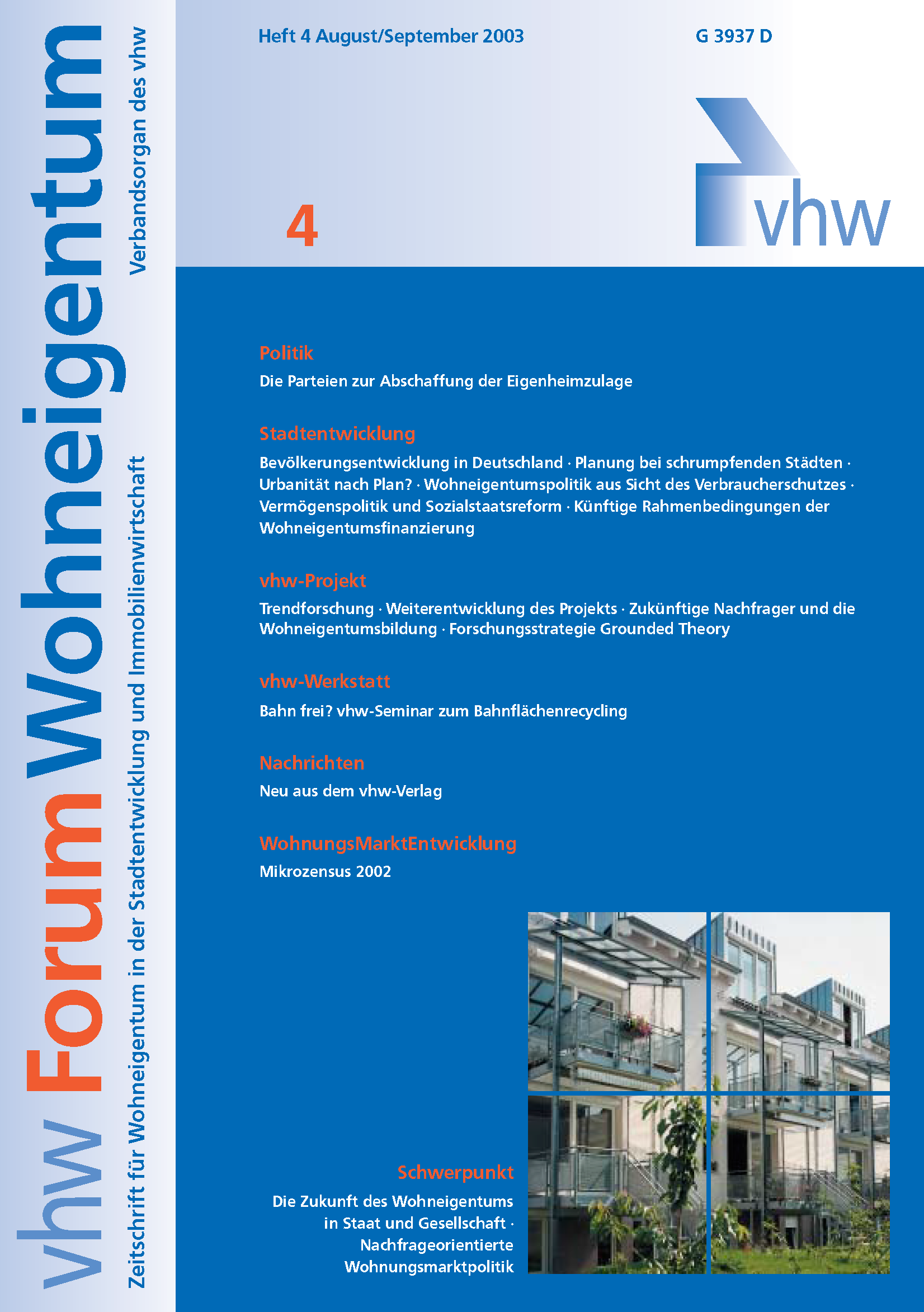
Erschienen in
Die im vier- bis fünfjährigen Turnus von den Statistischen Ämtern der Länder durchgeführten Untersuchungen zur Wohnungssituation liefern differenzierte Aussagen zur strukturellen Entwicklung des Wohnungsbestandes, zur Ausstattung der Wohnungen und nicht zuletzt zur Wohnungsversorgung der Haushalte und Familien in Deutschland. Seit August 2003 liegen nunmehr die Ergebnisse der Zusatzerhebung zum Mikrozensus vom April 2002 (MZZ) vor. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Diskussion über die Zukunft der Wohneigentumsförderung in Deutschland mit dem Beschluss der Bundesregierung, die seit 1996 bestehende Eigenheimzulage mit Wirkung vom 1. Januar 2004 vollständig zu streichen, richtet sich das Interesse besonders auf die jüngste Entwicklung der Wohneigentumsquote.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2016 Kultur und Stadtentwicklung
Vom 7. März bis zum 8. April 2016 hat der vhw eine bundesweite Online-Befragung zur Situation, den Herausforderungen und den Perspektiven der Flüchtlingsaufnahme durchgeführt. Unterstützt vom Deutschen Städtetag, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund sowie dem Hessischen Städte- und Gemeindebund wurden 1.521 Kommunen und Kreise angeschrieben. Die Rücklaufquote lag bei 44%. Insgesamt haben 583 Kommunen und 71 Landkreise an der Befragung teilgenommen. Zusammen haben sie etwa 425.000 Geflüchtete aufgenommen. Die ungewöhnlich hohe Teilnahme reflektiert die Einschätzung der befragten Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte, nach der die aktuelle Bedeutung des Themas „sehr groß“ (49%) oder „groß“ (42%) sei. Dabei nehmen diese Anteile mit der Größe der Städte zu; von den 41 beteiligten Großstädten halten 62% die Bedeutung für „sehr groß“.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2016 E-Commerce und Stadtentwicklung
Das Online-Shopping ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Käufer- und Umsatzzahlen sind in den letzten fünfzehn Jahren förmlich „explodiert“ und ein Ende der Entwicklung ist nicht abzusehen – weder national noch international. 2015 lag der Anteil des Online-Handels am gesamten Handelsvolumen in Deutschland bereits bei 10%; fast zwei Drittel der befragten Deutschen hatten 2015 in den letzten drei Monaten einen Online-Kauf getätigt. Die Pro-Kopf-Ausgaben für das Online-Shopping lagen 2014 bei 532 Euro, der Gesamtumsatz bei 42,9 Mrd. Euro, ein Zuwachs von 25% in Jahresfrist. Und die Tendenz ist weiter steigend. Doch welche Gruppen sind die Treiber dieses Booms und welche halten sich zurück? Auch hier gibt die Milieuforschung aktuellen Aufschluss.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2015 Aus- und Weiterbildung in der Stadtentwicklung
Bildung ist der Schlüsselfaktor für eine stabile Gesellschaft. Sie ist für die individuelle, persönliche Entwicklung genauso entscheidend, wie sie es für die räumliche, kommunale Entwicklung ist. Sind hier gute Grundlagen und Rahmenbedingungen geschaffen, so lassen sich die verschiedenen, oftmals anspruchsvollen lebensbiografischen Stationen – nicht selten mit gesellschaftlichen Entwicklungen verbunden – für jede und jeden angemessen meistern. Es sollten also die räumlichen, ebenso wie die individuellen Rahmenbedingungen im Lebensumfeld so beschaffen sein, dass sie im gesamten Lebenslauf der Bürgerinnen und Bürger die adäquaten Lernumgebungen – orientiert an den jeweiligen Handlungsanforderungen – bieten können.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2016 Renaissance der kommunalen Wohnungswirtschaft
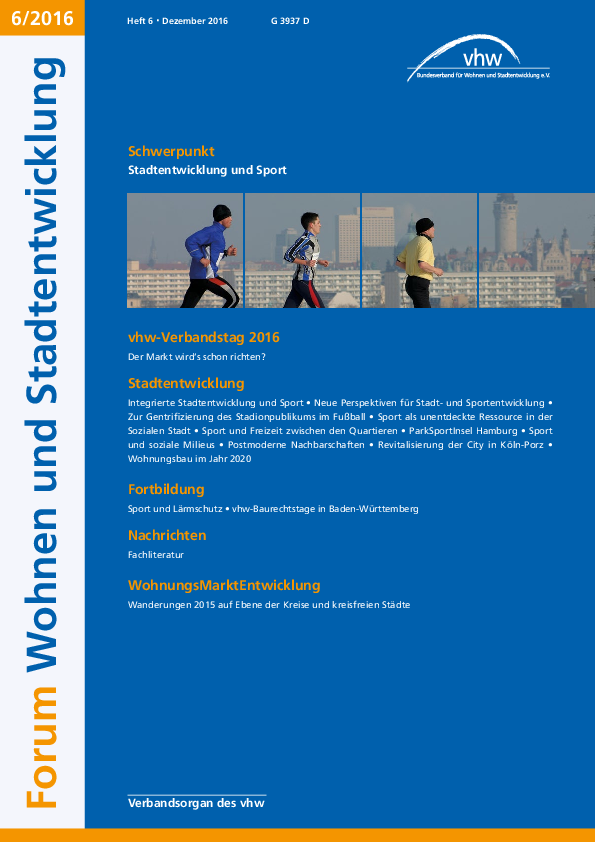
Erschienen in Heft 6/2016 Stadtentwicklung und Sport
Das weite Konfliktfeld „Sportausübung und Lärmschutz“ schien lange Zeit weitgehend befriedet zu sein. Infolge der sog. Tegelsbarg-Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts und der sog. Tennisplatz-Entscheidung des Bundesgerichtshofs hatte der Bund mit der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) Anfang der neunziger Jahre eine für alle Rechtsanwender verbindliche Lösung getroffen. Bei den darin festgelegten differenzierten Lärmschutzregelungen wurde den gesellschaftlichen Belangen der Sportausübung hinreichend Rechnung getragen und so gegenüber den sonstigen Lärmregelwerken (TA Lärm, 16. BImSchV, Freizeitlärmrichtlinie, FluglärmG) die Sportausübung bewusst privilegierende Regelungen geschaffen (z.B. Altanlagenbonus, Sonderregelung für kleine Sportanlagen). Man war sich einig, die Vorschriften der 18. BImSchV hätten sich bewährt.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2020 Quartiersentwicklung und Wohnungswirtschaft
Seine 14. Bundesrichtertagung zum Städtebaurecht konnte der vhw am 25. November 2019 wieder im ausgebuchten großen Saal des Kardinal-Schulte-Hauses mit den anwesenden Richtern und rund 160 Gästen begehen. Auch der Vorstand des vhw, Prof. Jürgen Aring, nahm teil, er wollte sich in diesem Jahr persönlich ein Bild von der Tagung machen. In bewährter Weise haben die Leipziger Richter aus erster Hand nahe Einblicke in ihre höchstrichterlichen Entscheidungen zum Städtebaurecht aus dem zu Ende gehenden Jahr berichtet und diese mit den Fachleuten im Publikum diskutiert. Den Teilnehmern wurde eine vielseitige Auswahl einschlägiger Leitentscheidungen zum Städtebau-, Planungs- und Umweltrecht vorgestellt und Wege für eine rechtssichere Anwendung dieser immer komplexer werdenden Rechtsgebiete aufgezeigt. Fragen aus dem Kreis der Teilnehmer waren wie immer ausdrücklich willkommen, was zu teilweise regen Diskussionen geführt hat.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2018 Meinungsbildung vor Ort – Chancen für Stadtentwicklung und lokale Demokratie
Der gesellschaftliche Wandel verläuft rapid, vielfach nicht einfach erkennbar, partiell konfliktreich. Vor allem die Folgen der segmentären Differenzierung der Gesellschaft werden sichtbar und erweisen sich als konfliktreich: Individualisierung, Pluralisierung, Werte-, Normen- wie Wissenskonflikte. Der soziale Wandel wird durch Social Media sichtbarer und beschleunigt. Social Media ermöglichen den immer schnelleren Austausch von Mitteilungen, Kommentierungen, Bewertungen. Neu ermöglichen sie Einzelnen, Gruppen wie Organisationen den direkten Zugang zur allgemeinen Öffentlichkeit – vorbei an den etablierten Intermediären wie Parteien, Kirchen, Verbänden und Massenmedien. Mittels Social Media können sich Einzelne wie Gruppen kostengünstig und rasch organisieren und politische Prozesse zu beeinflussen versuchen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2018 Meinungsbildung vor Ort – Chancen für Stadtentwicklung und lokale Demokratie
Der Journalist und Philosoph Jürgen Wiebicke gibt uns mit seiner Publikation "Zehn Regeln für Demokratieretter" zehn griffige Regeln an die Hand, mit deren Hilfe wir unsere Ratlosigkeit überwinden können. Mit deren Hilfe jeder von uns jederzeit anfangen kann. Vor der eigenen Haustür. Im Alltag. Weil es auf jeden Einzelnen von uns ankommt bei der so bitter nötigen Neubelebung unserer Demokratie. Denn – und daran müssen wir uns wieder erinnern: Die Demokratie ist mehr als eine Regierungsform, sie ist eine Lebensform! Wir danken dem Verlag Kiepenheuer & Witsch für die freundliche Abdruckgenehmigung der Regeln 5 und 6 aus dem Buch.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2005 Bürgerorientierte Kommunikation / Teilhabe an Stadtentwicklung und Wohnungspolitik

Erschienen in Heft 1/2007 Soziale Stadt – Bildung und Integration

Erschienen in Heft 6/2006 Neue Investoren auf dem Wohnungsmarkt – Transformation der Angebotslandschaft
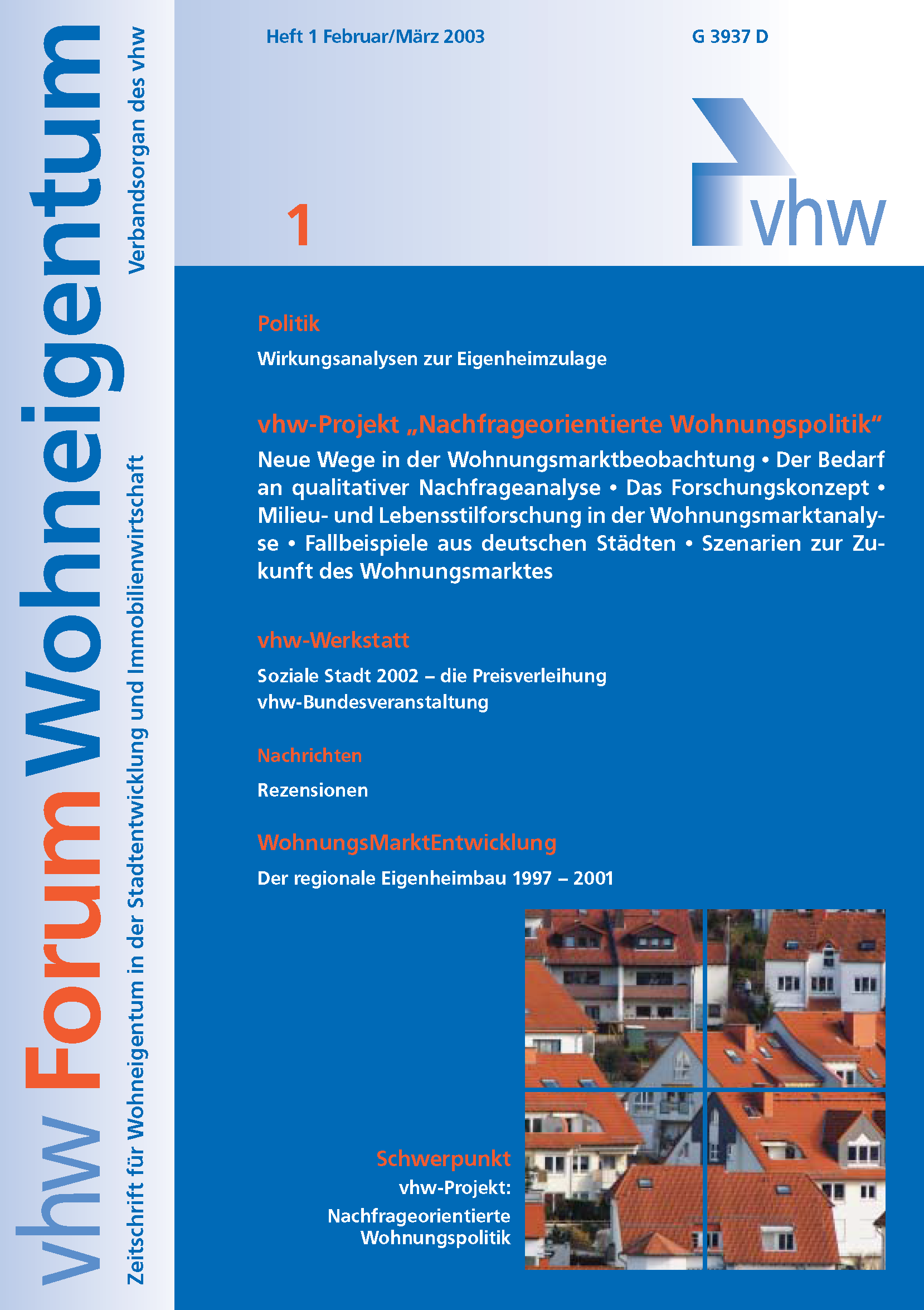
Erschienen in
Das Gesetz der Bundesregierung zur Reform der Eigenheimzulage wurde vom Bundestag bereits verabschiedet (Steuervergünstigungsabbaugesetz). Das Votum der Bundesländer wird im März erwartet. Dies gibt Anlass, die zentralen Aussagen aus den bisher einzigen umfassenden Analysen zur Inanspruchnahme der Eigenheimzulage darzustellen. Beide Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen und Schlussfolgerungen. Unerlässlich für eine politische Interpretation ist daher eine detaillierte Auseinandersetzung mit den empirischen und den methodischen Grundlagen der beiden Untersuchungen. Exemplarisch für die Differenzen werden in dem Beitrag die unterschiedlichen Analysen zur Zielgenauigkeit und der einzelwirtschaftlichen Auswirkungen der Eigenheimzulage aufbereitet und teilweise durch neue Berechnungen ergänzt.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2009 Corporate Citizenship in Wohnungswirtschaft und Stadtentwicklung
Das Szenario eines Marktplatzes ist ganz einfach: Es kommen Vertreter von Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen für ca. zwei Stunden an einem Ort zusammen. Durch eine gute Vorbereitung von Seiten eines Projektteams können sie dann innerhalb dieser Zeit mit Vertretern der jeweils anderen Seite über mögliche gemeinsame Projekte verhandeln. Die Marktplatz-Methode bringt auf diese Weise die Nachfrage nach bürgerschaftlich-engagierter Unterstützung und das Angebot bürgerschaftlichen Engagements zueinander.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2011 Städtenetzwerk Lokale Demokratie
In der erneut anschwellenden Debatte um das Für und Wider direkter Demokratie als einer Ergänzung des repräsentativ-demokratischen Systems – und nicht an dessen Stelle – gibt es keinen argumentativen Fortschritt. In dieser festgefahrenen Lage kann dreierlei hilfreich sein: die Tiefenstruktur der argumentativen Auseinandersetzung zu beleuchten, problematische argumentative Strategien und einen fragwürdigen Umgang mit empirischen Hinweisen zu benennen und den gleichermaßen von starren Prinzipien wie spekulativen Prognosen geprägten Streit um mehr direkte Demokratie durch eine experimentelle, aber zeitlich zunächst begrenzte Praxis zu entschärfen.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2010 Integration und Stadtentwicklung
Engagement von Menschen mit Migrationshintergrund geschieht oft leise und unbemerkt und meist in den eigenen Communities. Von Politik und Verbänden wird es beschrieben als großes, ungenutztes Potenzial und als Baustein zu Integration und mehr gesellschaftlicher Partizipation. Und: Organisationen – vom Patenschaftsprojekt bis zum Krankenhausbesuchsdienst – suchen händeringend nach Freiwilligen mit Migrationserfahrung. Mit dem Engagementpotenzial von Migrantinnen und Migranten ist somit gegenwärtig eine hohe Erwartungshaltung verbunden.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2012 Stadtentwicklung und Sport

Erschienen in Heft 6/2012 Stadtentwicklung und Sport

Erschienen in Heft 1/2014 Ländlicher Raum und demografischer Wandel
Der demografische Wandel prägt unsere Gegenwart und Zukunft nachhaltig. Er ist nicht umkehrbar, aber dennoch gestaltbar. Doch wie können die Akteure vor Ort damit umgehen? Die Serviceagentur Demografischer Wandel (SADW) berät und unterstützt Thüringer Kommunen und Bürger in dieser Frage. Seit Jahrzehnten verändert sich die Bevölkerungsstruktur Deutschlands: Sinkende Geburtenraten, höhere Lebenserwartung, starke Individualisierung und eine zunehmende Mobilität der Menschen auch über die Landesgrenzen hinweg kennzeichnen das, was heute unter dem Schlagwort demografischer Wandel verstanden wird. Diese Veränderungen, die in den Jahren nach der Deutschen Einheit vor allem in den neuen Ländern an Dynamik gewonnen haben, lassen sich auch wie folgt zusammenfassen: Wir werden weniger, älter und bunter.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2013 Perspektiven für eine gesellschaftliche Anerkennungskultur
Ehrenamtspreise, Ehrenamtscards, Wettbewerbe zur Prämierung von Best-Practice-Beispielen und öffentliche Veranstaltungen unter Beteiligung lokaler Politiker, in denen engagierte Bürgerinnen und Bürger geehrt und ausgezeichnet werden, sind nur eine Auswahl vielfältiger neuer Formen zur Anerkennung freiwilligen bürgerschaftlichen Engagements. In den letzten Jahren sind auf Bundesebene, in den Bundesländern und Kommunen sowie in Stiftungen, Vereinen und Verbänden zahlreiche Programme und Instrumente entwickelt worden, um Bürger für ihr Engagement zu würdigen. Über die tradierten Formen wie Ehrenbriefe, Medaillen für besondere Verdienste und sonstige Auszeichnungen für ein langjähriges Engagement in einer Organisation sind neue Varianten der Anerkennung hinzugekommen.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2012 Integrierte Stadtentwicklung und Bildung

Erschienen in Heft 6/2020 Klimaanpassung im Stadtquartier
Pakete verteilen, Akkus von Elektroautos aufladen und sichere Stellplätze für teure Elektrofahrräder bieten: Die Liste der Möglichkeiten ist lang, die Parkhäuser bieten können. Auch als "Mixed-used-Gebäude" könnten sie zusätzlichen Nutzen schaffen: In ersten Projekten wurden die oberen Etagen zurückgebaut und stattdessen mit Wohnungen versehen, auf dem Dach eines anderen Parkhauses wurde eine Kita errichtet. Denn viele Parkgebäude der 1960er Jahre sind für die heutige Auslastung überdimensioniert. Weil sie häufig zentral in der City stehen, liegt es nahe, sie intelligenter zu nutzen und mit der Nachbarschaft zu vernetzen. Welche Beispiele gibt es und welche sind künftig denkbar?
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2023 Urbane Transformation als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
Dieser Beitrag prozeduralisiert Transformation. Denn wenn tiefgehende Wandlungsprozesse (Transformationen) nicht nur akzidental passieren sollen (wie bei Digitalisierung und Globalisierung), sondern intentional jenes Gute hervorbringen, weshalb sie angestoßen wurden (wie eine sozio-ökologische, demografische Wende beispielsweise), dann muss das Wie des Transformierens mitgedacht sein. Denn dass Transformation gefordert wird, impliziert ja bereits, dass die gegenwärtige Art und Weise kollektiver, transsektoraler Problembearbeitung (Politik durch Demokratie) den Anforderungen und Erwartungen nicht gerecht wird. Gesellschaftliche Transformationsprozesse erfordern darum eine breit angelegte, professionalisierte, institutionalisierte und ausdifferenzierte Demokratieentwicklung, als Teil einer Demokratiepolitik, die sich dem Leitbild der lernenden Demokratie verpflichtet fühlt.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2023 Wohneigentum als Baustein für die Wohnungspolitik
Zu den oft genannten Verheißungen einer Stärkung der Wohneigentumspolitik zählen die Verbesserung der Altersvorsorge, die Minderung der Vermögensungleichheit, die Stärkung des Neubaus und der Beitrag zur Entspannung des Mietwohnungsmarkts – und das alles, ohne den öffentlichen Haushalten große Lasten aufzubürden. Neben diesen gesamtgesellschaftlichen Gründen wird der individuell weit verbreitete Traum vom Eigenheim und die höhere Wohnzufriedenheit von Eigentümern ins Feld geführt. Warum also nicht auf diesen „Zaubertrank“ setzen, der eine so breite Wirksamkeit verspricht? In der oft binär geführten Diskussion Miete oder Eigentum hat die Notwendigkeit, über die Praxis des Wohneigentums nachzudenken, in der Regel keinen Platz. Der Beitrag greift dieses Defizit auf. Darin geht es nicht darum, der Wohneigentumspolitik ihren Stellenwert im Konzert der wohnungspolitischen Instrumente abzusprechen, sondern eine Reihe an Nebenwirkungen der gegenwärtigen Praxis des selbst genutzten Wohneigentums aufzuzeigen.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2023 Urbane Daten in der Praxis
In öffentlichen Verwaltungen liegt eine Fülle von Daten vor, die zu zahlreichen Themengebieten wertvolle Informationen über die aktuelle Situation sowie Entwicklungen der Vergangenheit liefern. Wenn solche Daten mit adäquaten Methoden genutzt werden, können sie einen wichtigen Beitrag beim Treffen von raumplanerischen Entscheidungen leisten. Eine datengetriebene Entscheidungsunterstützung kann jedoch maximal so gut sein wie die Daten, die ihr zugrunde liegen. Daher ist es eine wichtige Aufgabe, Personen zu sensibilisieren und zu schulen, die Daten nutzen, verarbeiten, erzeugen oder in ihre Systeme integrieren. Dies betrifft sowohl Mitarbeitende in öffentlichen Verwaltungen als auch Forschende und andere Nutzergruppen. Sie benötigen leicht verständliche und umsetzbare Prozesse zur Dokumentation und Sicherstellung von ausreichender Datenqualität sowie intuitiv nutzbare Werkzeuge, die sie hierbei unterstützen. Eine Schlüsselrolle spielen in diesem Kontext Metadaten, die Informationen über die verwendeten Datensätze bieten. Sie sind bedeutend für die Auffindbarkeit, die Beurteilung der Relevanz, den Umgang und die Nutzung der Daten. Insbesondere der letztgenannte Punkt ist wichtig, wenn die Daten im Rahmen von algorithmischen Entscheidungsunterstützungssystemen verwendet werden. Anhand des Forschungsprojekts Ageing Smart wollen wir einen Ansatz vorstellen, der die Wichtigkeit einer guten Datenverwaltung im allgemeinen Bewusstsein aller Projektbeteiligten verankert und sowohl Bereitstellende als auch Nutzende von kommunalen Daten darin unterstützt.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2014 Zuwanderung aus Südosteuropa – Herausforderung für eine kommunale Vielfaltspolitik

Erschienen in Heft 4/2014 Wohnen in der Stadt – Wohnungspolitik vor neuen Herausforderungen