
Einzelpreis: 14,00 zzgl. Versandkosten
Lange Zeit standen die deutschen Großstädte als Zielgebiete im Mittelpunkt des Binnenwanderungsgeschehens. Das hat dazu geführt, dass die Attraktivitäts- und Ausstattungsunterschiede zwischen Stadt und Land, aber auch zwischen wachsenden und schrumpfenden Regionen größer geworden sind. Die zu Beginn der Coronapandemie entstandenen Irritationen auf dem Immobilienmarkt waren jedoch erheblich. Es deutete sich an, dass eine neue „Flucht“ aus den Ballungszentren bevorstünde, von der die ländlichen Regionen profitieren müssten - die neuen Möglichkeiten von Homeoffice, Zoom-Meetings und Onlineshopping machen es möglich. Vor diesem Hintergrund wurden die Stadtregionen als strategischer Handlungsraum sukzessive (wieder-)entdeckt.
Beiträge
Einzelpreis: 14,00 zzgl. Versandkosten
Gemeinwohlorientierung, Koproduktion und Nachhaltigkeit haben sich zu zentralen Leitbildern der Stadt- und Regionalentwicklung entwickelt. Dabei ist „Stadtmachen“ das aktuelle Thema der Stunde. Wer etwas auf sich hält und dazu gehören möchte, der oder die „macht Stadt“, möchte man meinen – am besten gemeinsam mit anderen Engagierten zusammen im Rahmen einer „koproduktiven“, von allen gesellschaftlichen Kräften gemeinsam getragenen Stadtentwicklung. Während jedoch das Potenzial und die Verantwortung der Zivilgesellschaft bisweilen idealisiert werden, zweifeln die Kommunen deren Legitimität und Gemeinwohlorientierung oft an. Wie kann aus dieser Konstellation eine Win-win-Situation entstehen, und wie können Kooperationen zwischen Kommunen und Zivilgesellschaft funktionieren?
Beiträge
Einzelpreis: 14,00 zzgl. Versandkosten
Lange Zeit fokussierte sich die Diskussion um Religion auf die nationale oder Landesebene. Durch verschiedene religionsbezogene Ereignisse weitet sich diese Perspektive seit Ende der 2000er Jahre aber auf, und so sind auch auf kommunaler Ebene verstärkte Diskurse zu Religion und Religionsgemeinschaften zu verzeichnen. Diese Veränderungen zeigen sich unter anderem in entsprechenden politischen Schwerpunktsetzungen und neu entstehenden Koalitionen zwischen religiösen und staatlichen Akteuren. Gerade nach dem Abklingen der Nachwirkungen von 9/11 haben sich in vielen Städten und Gemeinden vermehrt religionspolitische Foren und Strukturen entwickelt, die ein Ausdruck davon sind, dass auch auf der kommunalen Ebene zunehmend ein Umgang mit religiöser Vielfalt gesucht wird. Das vorliegende Heft gibt einen Einblick in verschiedene Ansätze und Formate der Zusammenarbeit von Glaubensgemeinschaften auf kommunaler Ebene.
Beiträge
Einzelpreis: 14,00 zzgl. Versandkosten
Angesichts der Vielzahl schockartiger Ereignisse und Krisen ist der Begriff der Resilienz schon länger in aller Munde und wird entsprechend auch als wichtige Komponente für eine zukunftsfeste integrierte Stadtentwicklung gesehen. Was Resilienz konkret bedeutet, erschließt sich jedoch nicht unmittelbar. Kommunen stehen zunehmend vor der Herausforderung, ihre Resilienz gegenüber Krisen und Katastrophen zu stärken. Die vorliegende Schwerpunktausgabe „Urbane Resilienz“ geht diesen Herausforderungen nach und weitet den Blick auch auf Kleinstädte und ländliche Regionen.
Beiträge
Einzelpreis: 14,00 zzgl. Versandkosten
Gerade auf kommunaler Ebene sind Entscheidungen greifbarer als auf Landes- oder Bundesebene: Wer baut hier, an wen werden Dienstleistungsaufträge vergeben, wie wird mit dem An- und Verkauf städtischer Grundstücke verfahren, wie werden Beteiligungen kommunaler Unternehmen gesteuert? In all diesen Bereichen liegt ein großes Risiko, dass Korruption Fuß fasst – und zugleich ein enormes Potenzial zur Prävention. Die Beiträge zum Schwerpunkt dieser Ausgabe von Forum Wohnen und Stadtentwicklung wollen nicht anklagen, sie wollen Anregungen zu einem aktiven Präventionsmanagement geben.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2013 Stadtentwicklung anderswo
Im Süden Vietnams, im Delta des Mekong-Flusses, liegt Ho Chi Minh Stadt, die wirtschaftliche Metropole der Sozialistischen Republik Vietnam. In Folge der ökonomischen Reformen und der Erneuerungspolitik der 1990er Jahre (Doi-Moi-Politik) hat die Stadt nach der Abkehr von der staatsgelenkten Wirtschaftspolitik einen rasanten Aufschwung erlebt. Der folgende Beitrag legt vor diesem Hintergrund den Fokus auf die Rolle der Stadtplanung zur Steuerung einer nachhaltigen Stadtentwicklung in der schnell wachsenden Megastadt Ho Chi Minh. Dabei steht neben der Darstellung der Entwicklungsprozesse die Frage integrativer Planung im Vordergrund, sowohl in Bezug auf die Integration sektoraler Belange wie auch in Bezug auf die Möglichkeiten der Beteiligung der Bevölkerung an Planungen und Entscheidungen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2013 Diversität und gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Stadt
Der soziale und gesellschaftliche Zusammenhalt ist in weiten Teilen Europas in eine ernste Krise geraten. Die Ursachen und Symptome sind vielfältig und reichen von einer breiten Individualisierung und Entsolidarisierung über den schwierigen Umgang mit wachsender Vielfalt („diversity management“) bis zur Vertiefung der sozialen Spaltung in vielen Staaten. Besonders betroffen sind die größeren Städte, in denen sich ungeachtet aller Anstrengungen diese negativen Entwicklungen bündeln und sich ihre Symptome am deutlichsten zeigen. Die Krisenerscheinungen der Kohäsion gehen einher mit einem Vertrauensverlust in demokratische Institutionen und Mechanismen. Teile der Stadtgesellschaften sind im sozialen wie im politischen Sinn abgekoppelt.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2014 Zuwanderung aus Südosteuropa – Herausforderung für eine kommunale Vielfaltspolitik
Integration kann nur gelingen, wenn man sie unter ein Leitbild subsumiert, das die Stadtentwicklung interkulturell und soziologisch, städtebaulich und bildungsorientiert als ein Gesamtpaket betrachtet. In Mannheim besteht die Herausforderung darin, trotz objektiv überschaubarer Zahlen der Zuwanderung für die Gesamtstadt einen Ansturm der Zuwanderung in wenige Innenstadtquartiere als eine derartige Belastung zu konstatieren, die die bisherigen Investitionen in verschiedenen städtebaulichen Programmen als hilflose "Projektitis" entlarvt. Dies passiert dann, wenn das Gleichgewicht zwischen Fördern und Fordern verschwindet, wenn die öffentlichen incivilities zunehmen, wenn das subjektive Sicherheitsempfinden beeinträchtigt ist sowie die Leistungsträger und aktiven Bürger, die sich bislang mit ihrem Stadtteil (in Mannheim die Quadrate und Quartiere) identifizieren konnten, buchstäblich das Weite suchen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2017 Vielfalt und Integration

Erschienen in Heft 3/2014 Lokale Bildungslandschaften
Friedhöfe sind besondere städtische Orte. Doch sie unterliegen einem Wandel, der auf demografische Entwicklungen sowie den gesellschaftlichen Wertewandel zurückzuführen ist. Es entstehen Flächenüberhänge, die aufgrund ihrer Lage und Vielfältigkeit bedeutsam für den städtischen Raum sind. Friedhofsentwicklungspläne sollen die ökonomischen Herausforderungen für die Friedhofsträger lösen und ggf. nicht mehr benötigte Friedhofsflächen einer neuen Nutzung zuführen. Die Umnutzungen von Friedhofsüberhangflächen stellen ein neues Aufgabenfeld für die Stadtentwicklung dar. Im Folgenden werden am Beispiel der Stadt Berlin Anforderungen an einen Friedhofsentwicklungsplan analysiert und Nachnutzungsmöglichkeiten diskutiert.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2018 Zivilgesellschaft baut Stadt
Stadtentwicklung findet heute vor allem auf zwei Ebenen statt. Man kann durchaus von einem dualen System der Stadtentwicklung sprechen: Handelt es sich bei der „Entwicklung“ um einen innenstadtnahen Stadtteil, so besteht angesichts der beispiellosen Nachfrage nach großstädtischem Wohnraum die Gefahr eines mehr oder weniger latenten Austauschs der Wohnbevölkerung und – als Folge dessen – der lokalen Ökonomie. Wir müssen nicht erst das G-Wort bemühen, um zu zeigen, dass Stadt heute vor allem als differenzierter Konsumraum funktioniert. Den ungebrochenen Zulauf zahlungskräftiger Hipster-Kleinfamilien auf die Kernstadt sollten wir jedoch nicht mit Urbanisierung verwechseln.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2019 Stadtentwicklung und Klimawandel
Hitzeresilienz ist spätestens seit den heißen Sommern in 2018 und 2019 eine Herausforderung für Städte und Quartiere. Die Verdichtung der Städte, die bislang durchaus mit Nachhaltigkeitszielen konform ging, gerät nun in Zielkonflikte mit der klimaangepassten Stadt. Das BMBF-Forschungsprojekt HeatResilientCity untersucht bewohnerorientierte Klimaanpassungsmaßnahmen an die zunehmende Hitzebelastung. Quartiersbefragungen in den Landeshauptstädten Erfurt und Dresden sowie die Diskussion der Ergebnisse in einem interdisziplinären Expertengremium zeigen Kommunikationsanforderungen und Handlungsbedarfe für künftige Klimaanpassungsprozesse auf. Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, welche Sichtweisen Bewohner in Bezug auf Hitzebelastung urbaner Quartiere haben, wie diese mit Expertenauffassungen korrelieren und welche Folgerungen sich daraus ableiten.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2014 Lokale Bildungslandschaften
"Sie sprechen schlecht deutsch, sind bildungsunwillig und werden von ihren Eltern zu wenig gefördert", so das pauschale Urteil, mit dem die fehlenden Bildungserfolge von jungen Migranten im öffentlichen Diskurs vielfach begründet werden. Auch die Bildungsforschung befasst sich vornehmlich mit der defizitären Bildungspartizipation junger Migranten (vgl. z. B. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2012). In Abgrenzung zu den vorherrschenden defizitorientierten Forschungsansätzen untersucht das Projekt "Bildung, Milieu und Migration" vor allem, welche Chancen und Ressourcen speziell Menschen mit Migrationshintergrund mitbringen – etwa aufgrund ihrer Mehrsprachigkeit, hoher Bildungsambitionen, ausgeprägter Leistungsorientierung oder ihrer Flexibilität und Frustrationstoleranz.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2018 Meinungsbildung vor Ort – Chancen für Stadtentwicklung und lokale Demokratie
Gebietsreformen, so unumgänglich sie auch sein mögen, haben ihre Tücken. Im Zuge großer baulicher Veränderungen war im Umland Berlins in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein für preußische und deutsche Verhältnisse riesiger Ballungsraum mit 3,8 Millionen Einwohnern entstanden. Technischer Fortschritt, Industrialisierung und ein dramatisches Bevölkerungswachstum hatten in wenigen Jahrzehnten neue Wirklichkeiten geschaffen. Anders als im ausgedehnteren Ruhrgebiet grenzten Charlottenburg, Schöneberg und Neukölln nahtlos an Berlin an. Die 1920 beschlossene Fusion sollte Gebietskörperschaften vereinen, die längst eng miteinander verflochten waren. In der Verkehrsplanung zum Beispiel arbeitete man schon gut zusammen.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2020 Ertüchtigung der Agglomerationen

Erschienen in Heft 3/2011 Stadtentwicklung in Klein- und Mittelstädten

Erschienen in Heft 3/2022 Zukunft Landwirtschaft: zwischen konkurrierender Landnutzung und Klimawandel
Die geburtenstarken Jahrgänge scheiden in den nächsten Jahren aus dem Erwerbsleben aus. Bei vielen wird die gesetzliche Rente zur Sicherung des Lebensstandards nicht ausreichen. Ursächlich hierfür sind in hohem Maße hohe Wohnkosten, insbesondere in (Groß-)Städten. Ältere Personen mit kleinen Renten können sich ihre beziehungsweise eine Wohnung in der (Groß-)Stadt nicht mehr leisten. Tatsächlich befinden sie sich nach einem anstrengenden Erwerbsleben mehr oder weniger in einem wirtschaftlichen „Überlebenskampf“. Auf die sozialen Verwerfungen, ausgelöst durch Altersarmut, sei an dieser Stelle hingewiesen.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2023 Kommunale Religionspolitik
33 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung schien die Zeit reif für einen intensiven Blick auf die Stadtentwicklung der Kommunen in den neuen Bundesländern und für eine Art Zwischenbilanz. Grund genug für den vhw, auf seinem diesjährigen Verbandstag unter dem Untertitel „Genutzte Potenziale, engagierte Akteure, erfolgreiche Stadtentwicklung“ den Fokus auf die positiven Ansätze, Projekte und Entwicklungen während der letzten drei Dekaden zu werfen. Der Ort für „großes Kino“ hätte passender nicht sein können: das ehemalige Kino Kosmos in Berlin-Friedrichshain, schon zu DDR-Zeiten ein Kultort und nach der Wende das erste Multiplexkino in den neuen Bundesländern. Gut 170 Interessierte folgten der Einladung des vhw, die Moderation der Veranstaltung übernahm die Journalistin Minou Amir-Sehhi.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2015 Aus- und Weiterbildung in der Stadtentwicklung
Drei Viertel der Menschen in Deutschland leben in Städten und verbringen dort den größten Teil ihrer Zeit in oder wenigstens in der Nähe von Gebäuden. Die gebaute Umwelt prägt jeden Tag unser Leben. Menschen stellen daher zu Recht hohe Ansprüche an ihre Wohnungen, ihr Wohnumfeld und die Städte, in denen sie wohnen, arbeiten, einkaufen und ihre Freizeit verbringen: Die Gebäude sollen jedes für sich und zusätzlich im städtischen Zusammenhang nicht nur zentrale Bedürfnisse wie Schutz oder Wärme befriedigen. Sie sollen dies zudem effizient, also zu möglichst geringen Kosten, tun und dabei bitte schön baukulturell wertvoll und natürlich ökologisch unbedenklich sein. Die Wege in den Städten sollen kurz sein, ohne dabei den Wunsch nach Grünflächen und öffentlichen Plätzen oder das Bedürfnis nach Ruhe zu gefährden.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2018 Gesundheit in der Stadt
Städte und öffentliche Räume bilden den Handlungsrahmen für unser Zusammenleben. In den letzten Jahren haben verschiedene Faktoren zu einem Wandel des Urbanen und öffentlicher Räume beigetragen: Die ästhetische Inszenierung von öffentlichen Plätzen, die zunehmende Verdichtung im Zuge der Innenentwicklung, die Entleerung von Ortskernen in Agglomerationen und Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum zeugen von widersprüchlichen Anforderungen und Bedürfnissen. Der vorliegende Artikel beleuchtet vor diesem Hintergrund Potenziale und Herausforderungen von Freiräumen als Schlüsselfaktoren für Begegnung und Bewegung im Alltag.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2007 Migration – Integration – Bürgergesellschaft
Der Beitrag ist darauf angelegt, zu Fragen der Integration bzw. Desintegration von Menschen, zum Verhältnis zwischen Gruppen und zum Zusammenleben in Sozialräumen sowohl konzeptuelle Überlegungen als auch empirische Hinweise und weiterführende Forschungsnotwendigkeiten aufzuzeigen. Letzteres insbesondere deshalb, weil wir zu zahlreichen präventions- bzw. interventionsrelevanten Fragestellungen bisher keine differenzierten Daten und damit auch keine verlässlichen Analysen haben.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2014 Infrastruktur und soziale Kohäsion
Von einer oder der Stadtgesellschaft zu reden, macht eigentlich nur Sinn, wenn damit gesagt werden soll, dass die Stadtgesellschaft besondere Charakteristika aufweist, die sie als ein spezifisches Governancekollektiv ausweisen. Dies scheint auch sinnvoll zu sein, führt man sich die in der Governance-Forschung durchaus gängige Unterscheidung zwischen „local governance“, „metropolitan governance“ und „regional governance“ vor Augen; offenbar soll damit gesagt werden, dass es jede dieser Governanceebenen mit spezifischen Governanceproblemen zu tun hat, die es von den Governanceproblemen anderer Ebenen unterscheidet. Dieser Beitrag basiert auf dem gleichnamigen Vortrag auf dem vhw-Verbandstag am 13. November 2014 in Berlin.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2017 Mobilität und Stadtentwicklung
Der Beitrag geht der Frage nach, welche Rolle soziale Netzwerke – und die Analyse von sozialen Netzwerkstrukturen – für die Entwicklung einer breit angelegten Strategie inklusiver Bürgerbeteiligung einnehmen können. Darüber hinaus zeigt er exemplarisch anhand eines Fallbeispiels aus der Freien und Hansestadt Hamburg – der Horner Geest Landschaftsachse – die Einsatzmöglichkeiten der Netzwerkanalyse im Dienste einer innovativen Bürgerbeteiligung.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2025 Kommunen zwischen Zukunftsorientierung und Gegenwartsbezug
Hamburgs Innenstadt steht traditionell im Fokus von Politik und Verwaltung – und wie viele Gespräche mit Hamburgerinnen und Hamburgern zeigen: Sie ist das Herz der Stadt. So ist es Ziel der Innenstadtentwicklung, sie als Gemeinschaftsaufgabe zu gestalten und sie mehr noch zur Innenstadt für alle zu machen, als sie ohnehin schon ist. Für diese Aufgabe wurde mit dem Schwerpunkt „Akteurskommunikation“ die Innenstadtkoordination geschaffen, eine Innenstadtkoordinatorin mit ihrem Team.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2024 Zukunft der Innenstädte in Deutschland
Gegründet wurde UpVisit im Mai 2022 von Katharina Aguilar (CEO), Alicia Sophia Hinon (COO) und Baver Acu (CTO). Seit März 2023 sind die Plattform UpVisit und die dazugehörigen iOS- und Android-Apps live. UpVisit steht unter dem Motto: die ultimative Verflechtung von analoger und digitaler Welt. Der Beitrag wurde uns zur Verfügung gestellt von UpVisit.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2019 Digitale Verwaltung
Auf den öffentlichen Sektor wirken zunehmend große Herausforderungen: Digitalisierung, Globalisierung sowie der demografische und der Klimawandel. All diese Entwicklungen erzeugen Handlungsdruck für die öffentliche Verwaltung – neue Herangehensweisen und Innovationen sind gefragt. Innovation Labs (Innovationslabore) sind in den letzten Jahren in vielen Ländern geschaffen worden. Auch in Deutschland entstanden solche Experimentierräume für Innovationen im öffentlichen Sektor. Was ist der Grund für ihre zunehmende Verbreitung und welche Ziele werden mit ihnen verfolgt? Welche Möglichkeiten eröffnen sich Verwaltungen durch Innovation Labs und mit welchen Herausforderungen sind diese selbst konfrontiert?
Beiträge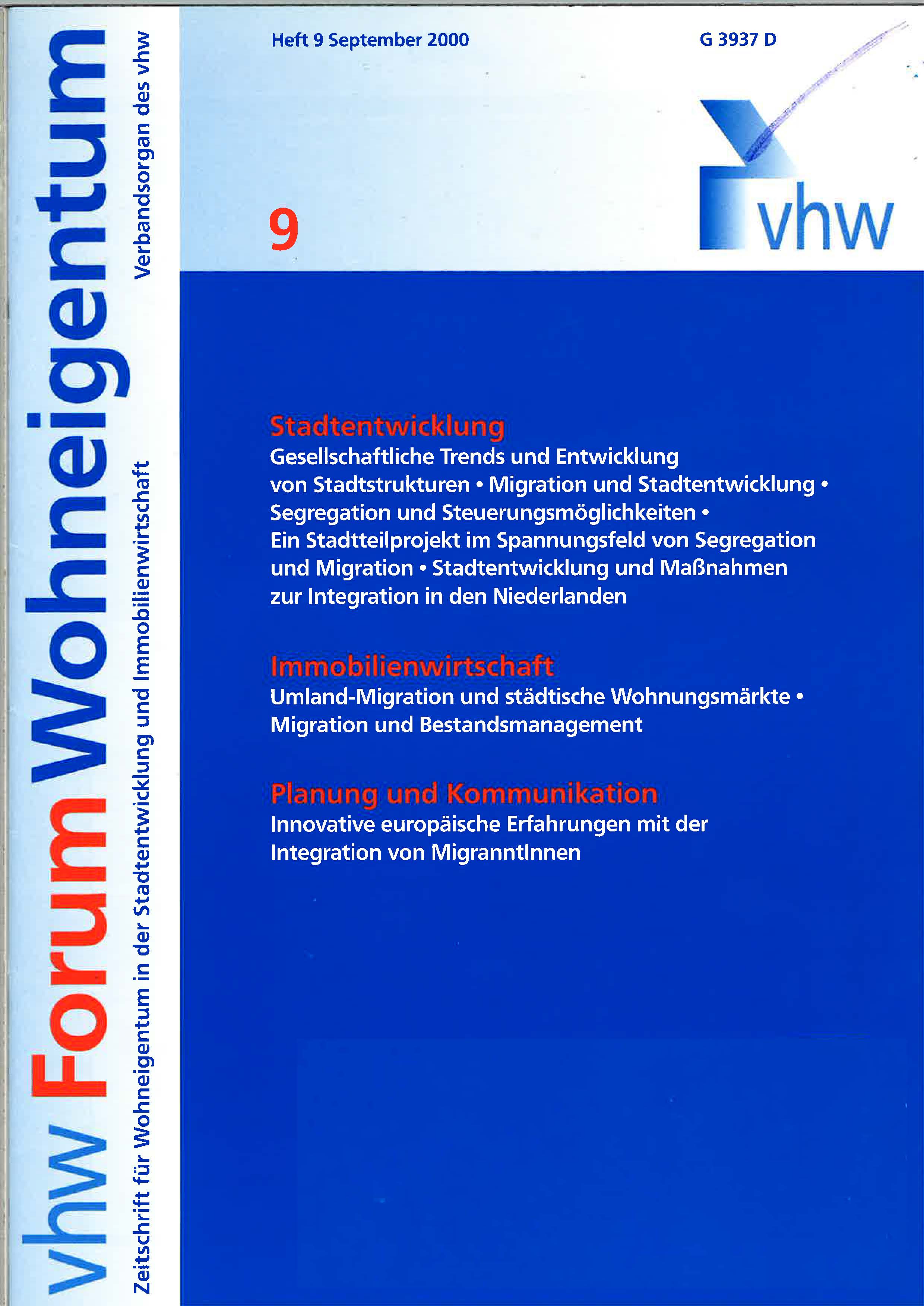
Erschienen in

Erschienen in Heft 5/2012 Nachhaltigkeit und Wohnen
Inmitten des Hamburger Stadtteils Altona stehen seit der Stilllegung des Hamburger Güterbahnhofs große zusammenhängende Flächen frei, die sich in privatem Eigentum befinden und Platz für ein neues Quartier bieten. Eine besondere Herausforderung für die städtebauliche Entwicklung ist die Wärmeversorgung, denn hierfür sollen laut Vorgaben der Stadt Alternativen zur üblichen Versorgung gefunden werden. Die Berliner Ingenieurgesellschaft MegaWATT stellte im Auftrag der Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt einen Vergleich unterschiedlicher zentraler und dezentraler Wärmeversorgungsvarianten für den neuen Stadtteil Mitte Altona an. Das Ziel: die Ermittlung der wirtschaftlichsten und ökologisch sinnvollsten Versorgungsvariante.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2007 Migration – Integration – Bürgergesellschaft

Erschienen in Heft 5/2014 Kommunikationslandschaften
„Achtung, Achtung, halt, Hände hoch oder ich schieße! Feuer, Tod, verboten, verrecken“ – Das waren die ersten deutschen Wörter, die ich in meiner Kindheit und Jugendzeit wahrnahm. Dass ich in den sechziger Jahren das Privileg hatte, in Teheran den Originalklang dieser furchterregenden Ausdrücke zu hören, verdankte ich den amerikanischen Antikriegsfilmen, die ich im Kino oder im Konsulat dieses Landes gesehen hatte; Filme wie Das Schloss in den Ardennen von Regisseur Sydney Pollack, z. B. In diesem Film spielt der charmante Schauspieler Burt Lancaster die Rolle eines amerikanischen Majors, der gegen die deutschen Truppen verlustreich kämpft. Gefesselt verfolgte ich ebenfalls das abenteuerliche Ringen seines Kollegen John Wayne mit den deutschen Nazis im Film The Sea Chase im Wirrwarr des Zweiten Weltkriegs quer über den Pazifik.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2007 Soziale Stadt – Bildung und Integration
Bildung spielt eine Schlüsselrolle für die erfolgreiche Integration von Kindern und Jugendlichen in die Gesellschaft. Sie ist Voraussetzung für die Teilhabe am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben. Bildungsprozesse sind deshalb immer auch Integrationsprozesse. In den Kindergärten und Schulen unseres Landes werden einmalige Chancen für erfolgreiche Integrationsprozesse eröffnet oder verspielt.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2007 vhw Verbandstag 2007: Migration – Integration – Bürgergesellschaft
Das Statistische Bundesamt hat uns jüngst darauf aufmerksam gemacht: Jeder fünfte in Deutschland lebende Mensch ist nach seiner Familienbiografie ein Migrant. Die Bundesrepublik, die zurzeit rund 31 Prozent der europäischen Bevölkerung ausländischer Abstammung beherbergt und mit dieser Quote weit vor Frankreich (14 Prozent), Großbritannien (12 Prozent) und Italien (9 Prozent) liegt, ist das Hauptzuwanderungsland innerhalb Europas. Deutschland ist damit ein Einwanderungsland - und wird es bleiben. Denn nach den Berechnungen und Szenarien des Statistischen Bundesamtes ist bis zum Jahr 2020 von jährlich 200.000 bis 300.000 legalen Netto-Zuwanderungen auszugehen. Deutschland wird damit nach den USA das zweitgrößte Netto-Empfängerland von legalen Migranten sein.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2012 Integration und Partizipation
Partizipation schließt in einem weiten Verständnis alle Formen der gesellschaftlichen Teilhabe ein. In einem engeren Sinne zielt Partizipation auf die Beteiligung an politischen Diskussions- und Entscheidungsprozessen, in denen es um legitime und folgenreiche Entscheidungen über die Belange des Gemeinwesens geht. Dabei gelten für demokratisch verfasste Gesellschaften zwei Grundnormen: politische Gleichheit der Bürger in der Einflussnahme auf die Regierungspraxis und die öffentliche Kontrolle staatlichen Handelns. Die Gleichheitsnorm besagt dabei nicht, dass sich immer alle beteiligen müssen, denn auch die Freiheit, sich nicht zu beteiligen, gehört zum demokratischen Selbstverständnis. Politische Gleichheit wird allerdings immer dann verletzt, wenn bestimmten Bevölkerungsgruppen Beteiligungsrechte systematisch vorenthalten werden – sei es durch Gesetze oder durch andere Barrieren.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2014 Lokale Bildungslandschaften
Für Stadtplanung und Stadtentwicklung ist Bildung, insbesondere Schulbildung, im letzten Jahrzehnt zu einem Schlüsselthema geworden, denn vor Ort werden die Auswirkungen von schwachen oder gescheiterten Schullaufbahnen unmittelbar als soziale Probleme spürbar, und genauso werden leistungsfähige und erfolgreiche Bildungsstrukturen als wertvolle Standortqualitäten gesehen. Diese doppelte kommunale Perspektive hat schon 2007 ihren Niederschlag in der Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt gefunden. Gefordert wird dort für die Städte sowohl eine aktive Bildungs- und Ausbildungspolitik für Kinder und Jugendliche, die in benachteiligten Quartieren "eine Verbesserung der lokalen Bildungs- und Ausbildungssituation in Verbindung mit einer aktivierenden Kinder- und Jugendpolitik" erreicht, wie auch eine aktive Innovations- und Bildungspolitik, die das "Wissenspotenzial einer Stadt optimal nutzt".
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2016 Fluchtort Kommune

Erschienen in Heft 4/2008 Engagementpolitik und Stadtentwicklung – Ein neues Handlungsfeld entsteht
Die Integrationsförderung bei Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte durch bürgerschaftliches Engagement bildete das Thema einer Studie, die das Institut für Stadtteilentwicklung und Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung (ISSAB) der Universität Duisburg-Essen Anfang 2008 für die Ehrenamt Agentur Essen erstellt hat. Ziel war die Erarbeitung von Grundlageninformationen, die für die Entwicklung eines entsprechenden Pilotprojekts in einem benachteiligten Essener Stadtteil genutzt werden können. Die wichtigsten Befunde der Studie, die demnächst bei der Stiftung Mitarbeit erscheinen wird, sind in diesem Beitrag zusammenfassend dargestellt.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2012 Integration und Partizipation
"Der Nachbar, das unbekannte Wesen", "Neues Leben muss ins Quartier fließen" oder "Krimineller Sumpf", so lauten Zeitungsheadlines, mit denen ganz konkret Wohngegenden und Quartiere umschrieben werden. Garniert sind sie mit Fotos von Vandalismusschäden, zerstochenen Reifen, Graffiti an den Häusern und Müll in den Vorgärten. Ein dramatisches Bild von schwierigen Wohn- und Lebenssituationen wird auf diese Weise in die Öffentlichkeit transportiert. Dass es sich dabei nicht nur um bedauerliche Einzelfälle handelt, machen die vielen öffentlichen Diskussionen deutlich, die seit den Unruhen in den Pariser Vorstädten vor zehn Jahren nicht mehr verstummen. Die Vielzahl der Förderprogramme zur Stadtteil- und Quartiersentwicklung zeugen mittlerweile vom breiten Engagement der öffentlichen Hand. Aber auch die Wohnungswirtschaft setzt sich seit zwei Jahrzehnten intensiv mit Quartieren und deren Entwicklung auseinander.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2010 Integration und Stadtentwicklung
Die Stadtgesellschaft ist vielfältiger geworden, ethnisch wie auch soziokulturell. Der Umgang mit dieser Vielfalt ist eine zentrale Herausforderung im Handlungsfeld Stadtentwicklung und Wohnen. Der vhw greift diese Debatte auf und zielt mit seiner Arbeit darauf, den in der Integrationsdebatte angesetzten Perspektivwechsel fortzuführen: "Weg von den Defiziten, hin zu den Potenzialen!" Aufbauend auf den Befunden der vhw-Studien "Soziale Segregation" (2008) und "Migranten-Milieus" (2009) zeichnen sich im Handlungsfeld Stadtentwicklung und Wohnen vier zentrale Befunde ab, auf denen die weitere Arbeit des vhw im Handlungsfeld Integration und Stadtentwicklung aufbauen wird und die im Folgenden kurz skizziert werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2017 Vielfalt und Integration
Seit Juli 2015 bearbeitet das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) das Forschungs-Praxis-Projekt „Vielfalt in den Zentren von Klein- und Mittelstädten – sozialräumliche Integration, städtische Identität und gesellschaftliche Teilhabe“ (siehe auch: www.vielfalt-in-stadt-und-land.de). Im Kern geht es darum, dass Klein- und Mittelstädte mit Maßnahmen zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Integration positive Entwicklungseffekte für die Stabilisierung ihrer Innenstädte/Zentren auslösen. Anders als ein „reines“, grundlagenorientiertes Forschungsprojekt hat dieses Vorhaben eine auf Aktivierung und Austausch angelegte Ausrichtung. Praxispartner des Difu sind neun Projektkommunen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2016 Fluchtort Kommune
Die Integrationsdebatte, die sich aus der starken Flüchtlingszuwanderung im Jahr 2015 entwickelt hat, ist nur die jüngste Variante der seit langem andauernden Diskurse, die u.a. über Urbanität und das Fremde (vgl. Simmel 1903, Siebel 1998), Binnenintegration (z.B. Elwert 1982), soziale Mischung (z.B. Wirth 1964) oder soziale Kohäsion und Sozialkapital (z.B. Forrest und Kearns 2001) geführt werden. Während die Moderne von der bisweilen ideologisch geführten Diskussion darüber geprägt war, inwieweit sich Zuwanderer schnell individuell anpassen (assimilieren) müssten (etwa Esser 2003) oder verschiedene Gruppen mit- und nebeneinander die Gesellschaft prägen könnten („Multikulti“), treten an diese Stelle in der globalisierten Postmoderne neuere Konzepte: Dazu gehören z.B. Ansätze der Inklusion (vgl. Luhmann 1995), der Interkultur (Terkessidis 2010) und die im Kontext neuer internationaler Migration entstehenden transnationalen Identitäten (Pries 2003).
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2008 Migranten-Milieus in Deutschland
Segregation und Ghettobildung, diese Begriffe sind beim Thema Stadtentwicklung in aller Munde. Vielfach geht es dabei auch um die Frage der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Wie stellt sich eine Wohnungsbaugenossenschaft in einem Flächenland diesem Problem? Die Wankendorfer Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein eG berichtet über ihre Erfahrungen im nördlichsten Bundesland.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2016 Fluchtort Kommune
Seit dem 1. Januar 2015 haben ca. 15.400 Menschen auf der Flucht aus ihren Heimatländern in Essen Zuflucht gefunden. Sie sind anerkannt als Asylbewerber, haben subsidiären Schutz zuerkannt bekommen oder befinden sich noch im Asylverfahren. Davon leben zum Stichtag 1.6.2016 ca. 10.000 Menschen in Wohnungen; sie haben eine langfristige Bleibeperspektive oder sind bereits anerkannt. Ca. 5.400 Menschen leben in Unterkünften (davon ca. 2.800 in Zeltstädten). Die größte Gruppe sind syrische Staatsbürger (ca. 8.000), gefolgt von Irak, Iran, Afghanistan. In den letzten Monaten ist vermehrt der Zuzug insbesondere von syrischen Familien aus anderen Kommunen nach Essen festzustellen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2011 Neue Dialogkultur: Wir sprechen uns im Web 2.0
Integration findet immer im konkreten Miteinander statt: vor Ort, in den Städten, Gemeinden und Quartieren. Der Nationale Aktionsplan ist eine Chance, die lokale Ebene von Integrationspolitik zu stärken und Integration als integriertes stadtentwicklungspolitisches Projekt zu konzipieren, über die Logik des Nebeneinanders einzelner Integrationsansätze hinaus. Er ist auch eine Chance, integrationspolitisch an den Potenzialen der Migranten anzusetzen, ihre Rolle als Mitgestalter und Koproduzenten von Stadt zu betonen und ihre Möglichkeiten für Partizipation, Mitbestimmung und Einbeziehung in Entscheidungen zu stärken.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2007 Migration – Integration – Bürgergesellschaft
Dass Deutschland Zuwanderung braucht, das scheint eine allgemein verbreitete Einschätzung unter den Entscheidungsträgern in Wirtschaft, Politik und Verwaltung zu sein. Hierfür sprechen demografische Gründe (Überalterung und Unterjüngung) sowie sozialpolitische (Generationenvertrag, Rentensystem) und wirtschaftliche Notwendigkeiten (bestimmte Qualifikationsbereiche). Zudem, wird betont, haben die Gesellschaften Mitteleuropas immer von der Zuwanderung profitiert, denn mit den Wandernden wurden Informationen, neue Techniken und Technologien, Sprache, Religion und sonstige kulturelle Fähigkeiten vermittelt. Diese positiven Einschätzungen basieren vor allem auf den Fremden, die heute kommen und morgen wieder gehen. Was ist jedoch mit denen, die heute kommen und morgen bleiben (wollen)?
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2015 Quartiersmanagement
Die „Soziale Stadt“ ist das wohl weitreichendste Beispiel für ein sozialräumlich ausgerichtetes, integriertes und ressortübergreifendes Förderprogramm. Durch finanzielle Unterstützung und Mittelbündelung, Managementstrukturen und Empowerment hat es seit seiner Implementierung bemerkenswerte Beiträge für den sozialen Zusammenhalt der Städte geleistet: durch die Verbesserung der Kontextbedingungen in den Quartieren, die Stabilisierung von Lebensbedingungen, die Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements. Eine zentrale Dimension jedoch ist nach wie vor wenig eingelöst: das Mitdenken, Mitmachen und Mitentscheiden der Menschen aus allen sozialen und kulturellen Milieus, auch derer, die nur schwer erreichbar sind.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2010 Integration und Stadtentwicklung
Was im Jahr 2005 mit einem Modellprojekt in Osnabrück begann, hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Das Projekt "Integrationslotsen in Niedersachsen" hat in allen Regionen Niedersachsens Fuß gefasst. Über 1.000 Interessierte wurden zu ehrenamtlichen Integrationslotsen qualifiziert. Nach wie vor nutzen weitere Menschen mit und ohne Migrationshintergrund die von Bildungseinrichtungen und anderen Kursträgern angebotenen Qualifizierungskurse. Ein großer Teil der Integrationslotsen unterstützt inzwischen Zugewanderte im Integrationsprozess oder bringt sich durch andere Aktivitäten in das Integrationsgeschehen vor Ort ein.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2010 Bürgerorientierung in der integrierten Stadtentwicklung
Integrative Planungsmethoden als Grundlage für eine Erfolg versprechende StadtLand-Entwicklung sollten inzwischen selbstverständlich sein. Selbst in der formellen Planung werden Forderungen diesbezüglich aufgetan, ohne dass Strukturen in Verwaltung und Ausbildung von Planern dafür die notwendigen Rahmenbedingungen bieten. Solange wir keine Generalisten ausbilden, die in den Kommunen eine integrative StadtLand-Entwicklungsplanung einführen, steuern und kommunizieren können, werden komplexe Strategien schwer zu finden sein.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2011 Städtenetzwerk Lokale Demokratie
Nach 15 Jahren sinkender Einwohnerzahlen, steigender Schulden und einer weitgehend unwirksamen Verwaltungsdezentralisierung setzt die Stadt Remscheid heute auf die Bündelung von Fachressorts und eine intensive Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern. Auf der Grundlage einer umfangreichen Stärken-Schwächen-Analyse und eines durch den vhw erstellten Wohnraumversorgungkonzeptes wird ein Leitbild für die Zukunft erstellt. Während sich die Bürgerschaft zuvor lediglich einbrachte, um Verwaltungsentscheidungen anzufechten, gilt es nun mit einem ehrlichen Blick auf die äußerst knappen Ressourcen gemeinsam mit allen Akteuren über unerfüllbare Wünsche, aber auch über die Potenziale der Stadt zu diskutieren.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2010 Trend 2010 – gesellschaftliche Entwicklung und Milieus
Die Wirklichkeit unserer Städte und damit auch der Stadtentwicklung wird immer komplexer. Integrierte Stadtentwicklung ist eine Antwort darauf. Damit die Forschung dabei von Nutzen ist, muss sie den Schritt in die integrierte Perspektive mit vollziehen. Um dabei den Überblick zu behalten und sich nicht in Details zu verlieren, muss sie die dafür nötigen Werkzeuge schaffen und benutzen. Anhand einer via sozialer Milieus auf allen Zugriffsebenen gebündelten und dadurch integrierten forscherischen Sicht auf unterschiedliche Themen wird erkennbar, dass hinter der Summe einzelner Daten eine Wirklichkeit liegt, die die Macher und Entscheider in der Stadtentwicklung berücksichtigen müssen, wenn sie nicht scheitern wollen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2020 Kommunales Handeln im europäischen Kontext
Die Entwicklung der Stadt- oder Raumplanungspolitik in den Ländern Mittel- und Osteuropas (MOE), die später in den 2000er Jahren der Europäischen Union beigetreten sind, wurde in den letzten drei Jahrzehnten stark durch die Politik und die entsprechenden Leitlinien der Europäischen Union beeinflusst. Heute ist der Aufbruch zu einer integrierten Stadtentwicklung, wie sie in der Leipzig Charta und der Territorialen Agenda 2020 empfohlen wird, in den meisten dieser Länder weit verbreitet. In den letzten zehn Jahren sind integrierte Stadtentwicklungsstrategien in Ungarn zu einem für alle Städte verbindlichen Bestandteil des Planungssystems geworden, und in einigen Fällen kam die Anwendung integrierter Strategien in Pilotprojekten bereits in den späten 1990er Jahren zum Tragen.
Beiträge