
Erschienen in Heft 1/2025 Urbane Räume im digitalen Wandel
Das Interesse an einer Partnerschaft mit dem vhw ist ungebrochen hoch und lässt die Zahl der Mitglieder seit Jahren kontinuierlich wachsen. So verzeichnete der vhw in den beiden zurückliegenden Jahren 112 Neuzugänge, was die Gesamtzahl der Mitgliedschaften auf 2270 ansteigen ließ. Im Jahr 2024 durfte der vhw nun München als neues Mitglied begrüßen. Die bayerische Landeshauptstadt nutzt schon seit vielen Jahren intensiv das breite Fortbildungsangebot des vhw. Über 2000 Veranstaltungsbuchungen sind so in den zurückliegenden zehn Jahren eingegangen. Künftig werden nun die etwa 43.000 aktiv Beschäftigten Münchens bei der Buchung der praxisorientierten und hochwertigen Fortbildungsveranstaltungen von den ermäßigten Mitgliederpreisen profitieren können. Darüber hinaus unterstützt München mit seiner Mitgliedschaft den vhw bei seiner engagierten Arbeit, mit der er sich für eine nachhaltige Stadtentwicklung und die Leistungsfähigkeit der Kommunen einsetzt. Die Anmeldung zur Mitgliedschaft im vhw war uns Anlass, einmal nachzufragen, was sich im Bereich kommunaler Fortbildung in München gerade verändert und welche Gründe zur Mitgliedschaft im vhw führten. Wir sprachen darüber mit Gregor Jaroschka (G. J.) aus dem Personal- und Organisationsreferat, POR-2/23 SC Personalentwicklung.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2024 Wasser als knappe Ressource
Ein naturnahes Wohnumfeld ist auf kleiner wie großer Fläche möglich, trägt zum Klimaschutz bei und ist ein Gewinn für Mensch und biologische Vielfalt. Wie können Stadtplaner, Akteure der Wohnungswirtschaft und weitere Entscheidungsträger mehr Natur in urbane Räume holen? Der folgende Beitrag stellt Trittsteinbiotope und PikoParks als neue Grünflächentypen vor, die das Naturgartenteam der Stiftung für Mensch und Umwelt in Berlin realisiert. Zudem informiert er über positive Monitoringergebnisse, die für naturnahes Grün sprechen, und er zeigt, wie Sie selbst aktiv werden können.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2024 Zukunft der Innenstädte in Deutschland
Die Innenstadt war und ist die erste Adresse für den Wareneinkauf der Bevölkerung. Die Bedeutung des innerstädtischen Einkaufs hat sich zwar mit zunehmendem Onlineanteil der Gesamtumsätze im Handel verändert, das hat aber an der dominierenden Rolle der Innenstädte als Einkaufsorte Nummer eins nichts geändert. Dennoch sollten die Veränderungen der Parameter in der jüngeren Vergangenheit und der Gegenwart genauer betrachtet werden, weil einige Experten bereits von einem Wandel des innerstädtischen Funktionsmix sprechen und die Multifunktionalität der Innenstädte als neue Zielgröße proklamiert wird.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2025 Kommunen zwischen Zukunftsorientierung und Gegenwartsbezug
Im Rahmen der von der Nationalen Stadtentwicklungspolitik geförderten Vernetzungsinitiative „Gemeinsam für das Quartier“ hat der Deutsche Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V. (DV) gemeinsam mit Prof. Reiner Schmidt (Netzwerk Stadt als Campus) ein Empfehlungspapier vorgelegt. Darin wird die kulturelle Quartiersentwicklung aus Perspektive der Wohnungswirtschaft beleuchtet. Aufbauend auf diesen Ergebnissen fand die Tagung „Kulturelle Stadtentwicklung in Wohnquartieren – Beiträge von Wohnungswirtschaft und Stadtmacher:innen“ des vhw und der Vernetzungsinitiative statt. Sie machte die Vielschichtigkeit und Wirksamkeit kultureller Strukturen und Aktivitäten deutlich. Ziel der gemeinsamen Veranstaltung war es, die wohnungswirtschaftliche Sichtweise mit der Perspektive quartiersbezogener, selbstorganisierter Kultur- und Kreativarbeit durch Stadtmachendenakteure zu verbinden und die beiden Ansätze miteinander in Beziehung zu setzen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2025 Kommunen zwischen Zukunftsorientierung und Gegenwartsbezug
Seit dem 1. März 2025 ist die Blütenstadt Werder (Havel) – bekannt nicht nur durch ihr jährlich stattfindendes Baumblütenfest – Mitglied im vhw. Ruby Moritz-Hell vom vhw befragte Philipp Konopka, Leiter des Fachbereichs 1 der Stadtverwaltung, der unter anderem die Haupt- und die Personalverwaltung umfasst, zu den Fortbildungsbedarfen und den aktuellen Herausforderungen in der Personalplanung in seiner Stadt.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2022 Stadtentwicklung und Hochschulen jenseits der Metropolen
Mit dem Aufkommen des Begriffs der „Schwarmstädte“ gerieten ab 2013 solche Städte in den Fokus der (Fach-) Öffentlichkeit, die vor allem nach 2008 zu einem Magneten für jüngere Erwachsene geworden waren. Dabei handelte es sich vornehmlich um Großstädte, die als Hochschul-, aber auch als Erlebnisstandorte besondere Attraktivität auf die mobilen 18- bis 35-Jährigen ausübten. Weniger Aufmerksamkeit erhielten dagegen mittelgroße Hochschulstandorte außerhalb der Agglomerationen mit ihren teilweise sehr hohen Studierendenquoten. Aktuelle Entwicklungen deuten für diese Orte – oft kleinere Regiopole –auf gemischte Zukunftsperspektiven und einen deutlichen Anpassungsbedarf hin, nicht zuletzt zur Steigerung der Attraktivität für andere Bevölkerungsgruppen angesichts sich anbahnender demografischer Verschiebungen. Näher werden diese Entwicklungen am Beispiel der Universitätsstadt Marburg dargestellt.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2022 Auswirkungen des Klimawandels und die Anforderungen an das kommunale Krisenmanagement
Seit fast zwei Jahren wird die Welt durch die Covid-19-Pandemie in Atem gehalten – eine Krise, die weitreichende Auswirkungen auf alle Lebensbereiche hat und deshalb auch viele Fragen aufwirft, die einen direkten Bezug zur Gestaltung unseres Lebensumfeldes sowie der Stadt- und Raumentwicklung haben. Deutlich ist nach zwei Jahren Stadtentwicklung in der Pandemie, dass diese nicht völlig neue Phänomene hervorbringt, sondern viele bereits existierende Trends besonders zuspitzt oder beschleunigt. Primär zu nennen sind u.a. die digitale Transformation, aber auch die sozio-ökonomische Polarisierung oder der Fachkräftemangel in öffentlichen Verwaltungen und Einrichtungen. Zudem resultieren die Auswirkungen der Pandemie in vielen Fragen in einer besonderen Polarisierung unterschiedlicher Sichtweisen, etwa wenn es in der Diskussion von pandemiesicheren Fortbewegungsmöglichkeiten um die Abwägung zwischen Auto und öffentlichem Nahverkehr geht.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2022 Auswirkungen des Klimawandels und die Anforderungen an das kommunale Krisenmanagement
Die Coronapandemie seit 2020 hat deutlich gemacht, wie verletzlich unsere Gesellschaft trotz allem technischen und medizinischen Fortschritt ist. Angesichts des Klimawandels werden wir künftig noch stärker von Extremwetterereignissen und Klimaschwankungen betroffen sein – mit gravierenden Folgen für unsere Städte. Die demografische Entwicklung wird unsere Städte mit Überalterung und Fachkräftemangel stark verändern. Die Stadtplanung muss hierauf mit präventiven Resilienzstrategien reagieren, und zugleich ihre Leitbilder und Instrumente weiterentwickeln. Die häufig kritisierte Charta von Athen von 1933 ist aus ihrer Zeit heraus zu verstehen, sie enthält Aussagen zur Stadthygiene und gesunden Stadt – auch als Antwort auf Spanische Grippe, Cholera und andere Pandemien. Der Leitbildwechsel zur aufgelockerten Stadt mit größeren Gebäudeabständen, verbesserter Infrastruktur und mehr Freiräumen ist nur vor diesem Hintergrund zu verstehen. „Hygiene“ steht bis heute als städtebaulicher Missstand im Baugesetzbuch (§ 136 BauGB), auch wenn sie nicht mehr als Begründung für Stadterneuerungsmaßnahmen verwendet wird – sie könnte nun eine Renaissance erfahren.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2022 Auswirkungen des Klimawandels und die Anforderungen an das kommunale Krisenmanagement
Es darf inzwischen als zweifelsfrei festgestellt gelten, dass der Klimawandel auch in Deutschland zu Extremwetterereignissen wie der „Jahrhundertflut“ an der Ahr und der Erft im Juli 2021 führt. Zwei Momentaufnahmen illustrieren die Dilemmata, vor denen u.a. Katastrophenschutz, Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Infrastruktur-, Stadt- und Regionalplanung angesichts von Extremwetterereignissen stehen. Beide haben mit Ungleichzeitigkeiten zu tun.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2021 Stadtentwicklung und Vergaberecht
Ideen haben den Reiz, dass mit ihnen das Leichte, das Andere und Noch-nicht-Reale schwingt. Konzepte wiederum sind schon geronnene Ideen. Sie bringen von Zeit zu Zeit neue Anregungen in die Diskussion, was und wie die Stadt denn nun sein kann. Im besten und realisierten Fall werden sie zu Motoren für neue Mischungen in lebendigen Quartieren oder auch zu Exempeln für leistbares Wohnen in ungewöhnlichen Formen und Konstellationen. So in etwa kann man auch das Aufkommen des sogenannten Konzeptverfahrens in der Stadtentwicklung deuten. Die sozialen Fragen des Wohnens, Lebens und Arbeitens haben nicht ohne Grund neue Akteure im städtischen Leben aktiv werden lassen. Nach den Hausbesetzern und Kommunarden kamen die Baugruppen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2021 Stadtentwicklung und Vergaberecht
Der Gesetzgeber schreibt ab einem Schwellenwert von einer 214.000,- Euro-Netto-Honorarsumme, die in der Regel bereits bei einem dreigruppigen Kindergarten erreicht wird, ein Vergabeverfahren nach der Vergabeordnung (VgV) vor. Dies mag zunächst nur als Pflichtübung erscheinen, bei entsprechend kluger Anwendung können jedoch erhebliche Mehrwerte generiert werden, die den vorgegebenen Aufwand auch rechtfertigen. Dabei kommt es insbesondere auf die Haltung an, wie die VgV-Verordnung der Bundesregierung aus dem Jahr 2016 als Rechtsverordnung angewandt und gelebt wird. Ein wertvolles Instrument bei Planungsprozessen in den Bandbreiten vom Haus zur Stadt und von Innenentwicklung zur Landesplanung stellen in diesem Zusammenhang wettbewerbliche Verfahren mit Planungswettbewerb dar. In Verbindung mit Partizipation kann der Mehrwert aus örtlichem Wissen und innovativen Kenntnissen geschöpft werden. Die anstehenden Planungs- und Beteiligungsprozesse werden nicht im Alleingang von Architekten, Stadt- und Fachplanern gestaltet, sondern im Team, im Zusammenspiel aller Beteiligten. Für die Planung dieser Prozesse, für die es keine Patentrezepte gibt, bedarf es der inneren Bereitschaft, ausreichender zeitlicher, finanzieller und personeller Ressourcen sowie über Legislaturperioden hinaus den langen Atem der Politik.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2022 Kooperationen von Kommunen und Zivilgesellschaft
Nach über zehn Jahren Leerstand wird das Areal Haus der Statistik in Berlin gemeinwohlorientiert entwickelt – gemeinsam durch Zivilgesellschaft und öffentliche Hand. Die Koproduktion der Kooperationsgemeinschaft Koop5 dient als Hebel, um gemeinsam Stadt zu gestalten. Alternative Zugänge zu Planungsprozessen durch kreative Formate der Mitwirkung, Selbstorganisation von Pioniernutzungen und gemeinsame Verantwortung für öffentliche Ressourcen durch Public Civic Partnerships sind drei Ausprägungen der koproduzierten Stadt, die im Artikel näher beleuchtet und diskutiert werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2022 Welche Dichte braucht die Stadt?
Verdichtung scheint das neue Leitbild im Städtebau zu sein, und die Vorteile liegen offenbar auf der Hand: in ökonomischer, effizienter, ökologischer und urbaner Hinsicht. Doch was sind die Effekte einer zunehmend dichteren Bauweise, wer profitiert davon, und wer hat am Ende keine andere Wahl? Der vorliegende Beitrag nimmt sich der Frage an, welche Punkte geklärt werden müssen, bevor in die Planung verdichteter Stadtteile eingestiegen wird. Als Eckpunkte dienen die Frage nach der Nachhaltigkeit solcher Projekte auf der einen Seite und das Risiko einer Spaltung der Stadtgesellschaft auf der anderen Seite.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2021 Digitalisierung als Treiber der Stadtentwicklung
Die Coronapandemie hat seit dem Frühjahr 2020 deutliche Spuren in den Innenstädten hinterlassen. Die Auswirkungen fallen unterschiedlich aus, relativ stärker sind sie in den sogenannten A-Städten. Ortszentren kleinerer Kommunen leiden dennoch besonders intensiv: Gemeinsam mit den meisten Randlagen zentraler städtischer Einkaufsbereiche könnten sie es besonders schwer haben, nach der Pandemie wieder belebt zu werden, auch wenn sie im Vergleich zu touristischen Standorten zunächst weniger betroffen waren. Bei aller Vielfalt lokaler Herausforderungen zeigt sich dabei: Ohne neue Wege und langfristige Kooperationen wird es nicht besser.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2021 Digitalisierung als Treiber der Stadtentwicklung
Für eine Kommune bedeutet Digitalisierung nicht nur die Optimierung von Verwaltungsprozessen oder WLAN in der Fußgängerzone. Digitalisierung ist ein Standortfaktor. Durch diese kann die Wahrnehmung einer Stadt als Lebensraum und Gewerbestandort wesentlich beeinflusst werden. In einer aktuellen Umfrage der Bitkom gibt ein Viertel (26 %) der befragten 16- bis 29-Jährigen an, dass "eine zu langsame Digitalisierung am Heimatort ein möglicher Umzugsgrund ist" (Bitkom 2021). Bekanntermaßen zählt auch für Unternehmen eine leistungsfähige digitale Infrastruktur zu den wichtigsten Standortfaktoren. Darauf kann die Kommune nicht nur auf Verwaltungsseite und beim Glasfaserausbau einwirken, sondern auch eine Vision schaffen, in der digitale und innovative Möglichkeiten die Stadt langfristig als Raum zum Leben, Arbeiten und Lernen attraktiver machen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2021 Digitalisierung als Treiber der Stadtentwicklung
Seit den 1980er Jahren geistert das Paradigma der smarten Stadt durch politische, ökonomische und wissenschaftliche Debatten. Getrieben wurden diese Debatten zumeist von Vor- und Nachdenkern kommerzieller Anbieter entsprechender Technologien, Produkte und Anwendungen. So trieb IBM das Konzept mit weltweiten Initiativen an – ganz besonders nach dem Einbruch der Weltwirtschaft in den Jahren 2008 und 2009. Es blieb nicht bei der Theorie und dem Marketing: Weltweit sind Städte und Stadtteile nach dem Muster einer Smart City umgebaut oder sogar neu geschaffen worden. Entscheidend beim klassischen Smart-City-Ansatz bleibt das Produkt, die Technologie. Sie ist nach marktförmigen Gesichtspunkten entwickelt worden und muss nun entsprechend kommerzialisiert werden. Bezahlt wird nicht immer mit Geld, sondern oft auch mit der Privatisierung öffentlichen Raums, mit Daten von Bürgerinnen und Bürgern oder mit Einfluss auf öffentliche Belange.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2020 Quartiersentwicklung und Wohnungswirtschaft
Grün, freundlich und bunt – noch vor einigen Jahren hätte man dieses Bild nicht mit dem Stadtteil Drewitz verbunden. Das Wohngebiet im Potsdamer Südosten ist eine von sieben Großwohnsiedlungen, die den Städtebaustil der DDR in den späten 1980er Jahren repräsentieren. Das Erscheinungsbild war lange Zeit geprägt von den typischen grauen Platten. Der Anteil der sozial und finanziell schwächeren Haushalte verzeichnete über Jahre einen Zuwachs. Es war klar: Die Stadt musste sich des Problems annehmen. Die Idee einer Gartenstadt für das Wohngebiet entstand bereits im Jahr 2003, doch bis zur Entwicklung eines Konzeptes sollte es noch etwas dauern.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2022 Welche Dichte braucht die Stadt?
Die Verdichtung von Wohnsiedlungen muss nicht zum Spagat werden: Zeitgemäße Formen der Partizipation, ökologischer Um- und Ausbau sowie ein qualitätvolles Umfeld können von Beginn an für Einklang sorgen. Mit Bedacht geplant, eingeleitet und durchgeführt, trägt Verdichtung dazu bei, attraktivere und menschengerechtere Städte mit neuem Potenzial zu schaffen und Innovationen Raum zu geben.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2021 Stadtentwicklung und Vergaberecht
Am 8. Juni 2021 fand in der Berliner Urania der vom vhw veranstaltete „Digital-Kongress Lokale Demokratie“ statt. Unter dem Motto „Stadt gemeinsam gestalten“ wurde der Kongress in enger Kooperation mit dem Deutschen Städtetag (DST) und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGb) durchgeführt. Die ursprünglich für das Jahr 2020 vorgesehene Veranstaltung musste aufgrund der Coronapandemie um mehr als ein Jahr verschoben und zuletzt aufgrund der behördlichen Auflagen zu einem digitalen Kongress ohne Livepublikum umgerüstet werden. Die rund vierstündige Veranstaltung, fachkundig moderiert von Nadia Zaboura, wurde in Folge als ein Livestream auf dem YouTube-Kanal der Berliner Urania und auf der Website www.vhw.de öffentlich übertragen. Insgesamt haben ca. 250 Personen ganz oder zeitweise auf den Übertragungsplattformen am Kongress teilgenommen.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2019 Stadtentwicklung und Sport
Die Sportlandschaft in Deutschland, speziell in den Metropolen und Ballungsräumen, hat sich in den letzten Jahrzehnten dynamisch verändert. Längst existieren vielfältige Erscheinungsformen von Sport, die sich in sozialer, zeitlicher und räumlicher Hinsicht aufeinander beziehen, überlagern und auch konkurrenziell begegnen. Aus sportsoziologischer Perspektive werden im Folgenden verschiedene Erscheinungsformen von Sport dargestellt und vor diesem Hintergrund exemplarische Fragestellungen im Hinblick auf Sport- und Bewegungsräume in der modernen Stadtgesellschaft angedeutet.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2019 Digitale Verwaltung
Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen hat Ende des Jahres 2017 beschlossen, Ostwestfalen-Lippe zur digitalen Modellregion zu entwickeln. Da die Stadt Paderborn sich bereits erfolgreich im Wettbewerb "Digitale Stadt" des Deutschen Städte- und Gemeindebundes sowie des Bitkom-Verbands behauptet und ein fundiertes Smart-City-Konzept vorgelegt hat, wurde sie zur ersten Leitkommune einer digitalen Modellregion in Nordrhein-Westfalen ernannt. Anfang des Jahres 2018 bestimmte das Land dann in den vier anderen Regierungsbezirken die Städte Aachen, Gelsenkirchen, Soest und Wuppertal als weitere Leitkommunen.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2019 Digitale Verwaltung
Sie ist als Schlagwort in aller Munde. Für die einen gilt sie als Heilsbringer in einer modernen Gesellschaft, andere begegnen ihr mit Skepsis und Bedenken. Ist sie Fluch oder Segen? Oder vielleicht beides? Sicher ist nur eines: Sie wird nicht mehr weggehen. Sie ist ein Megatrend, der bereits jetzt alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens durchflutet, nachhaltig beeinflusst und verändert. Ludwigsburg leistet bereits heute Pionierarbeit bei der Erforschung und Implementierung digitaler Lösungen in allen Bereichen der Stadtentwicklung. Die beschleunigte Entwicklung städtischer Lebensräume und die Bewältigung besonderer Herausforderungen sind zentrale Aufgaben für die Kommune der Zukunft.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2019 Child in the City
Stadtteilmütter arbeiten seit anderthalb Jahrzehnten erfolgreich in vielen Kommunen der Bundesrepublik. Sie bieten niedrigschwellige Beratungsleistungen von Migrantinnen für Migrantinnen an. Die Projekte stärken die als Stadtteilmütter arbeitenden Frauen, indem Selbstvertrauen aufgebaut und Qualifikationen gefördert werden. Den beratenen Klientinnen wird der Zugang zu Institutionen und zum öffentlichen Leben geebnet. Stadtteilmütterarbeit basiert dabei auf Beziehungsarbeit. Die interpersonelle Wirkung der Projekte ist in bisherigen Untersuchungen allerdings kaum betrachtet worden. Der vhw hat daher die Sozialkapital bildende Wirkung von Stadtteilmütterprojekten in einer nun erscheinenden Studie erstmals systematisch untersuchen lassen.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2019 Child in the City
In diesem Beitrag soll gezeigt werden, dass jegliche „Bildungsinitiative, mit deren Hilfe eine bessere Beziehung zwischen Kind und Stadt“ erreicht werden soll, nicht auf einer „Aufklärung über die Straßenverkehrsregeln“ basieren darf, wie es in vielen Ländern der Welt üblich ist. Vielmehr muss ein kritisches und kreatives Verständnis der urbanen Systeme, in denen Kinder leben, gefördert werden. Wir gehen davon aus, dass Kinder die Hauptopfer einer Stadt sind, von der sie nicht akzeptiert werden. Daher wird es nur zwei Möglichkeiten geben: Entweder sich damit abfinden und aufgeben oder rebellieren und in Frage stellen. Im ersteren Fall will man den Verstand von Kindern „zähmen“, und im letzteren will man sie aufklären und das Potenzial für eine bessere Stadt entfachen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht
Berlin war die Stadt der Freiräume. Verlassene Wohnungen, Hallen, leere Kaufhäuser, alte E-Werke, offene Räume gab es an jeder Ecke. Der Zugang war direkt. Wenn es überhaupt um Miete ging, war sie günstig, die Stadt ein Experimentierfeld für Kreative, Müßiggänger und Hedonisten. Der anarchische Moment zu Beginn der 1990er, der Clubs, Bars, Ausstellungsräume, Galerien, günstiges und umsonst Wohnen und viele andere Inbesitznahmen ermöglichte, legte auch die Basis für das kreative Image der Stadt und wurde 2003 mit Klaus Wowereits Ausspruch „Berlin ist arm, aber sexy“ zum Kern des Berlinmarketings. Kultur war Kapital geworden. Auf der anderen Seite fehlte es der ehemals geteilten Stadt an Wirtschaftskraft.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2022 Welche Dichte braucht die Stadt?
Freiraum, Stadt und Dichte stehen für ein streitbares Dreigespann. Die Aufforderung, die Dichte der Stadt vom Freiraum her zu denken, ist daher eine reizvolle wie tückische Aufgabe. Eine Antwort, was eine angemessene Dichte für die Stadt des 21. Jahrhunderts mit ihren wachsenden sozialen und kulturellen Diversifizierungen und ökologischen Herausforderungen sein kann, ist so einfach nicht zu geben. Begnügt man sich nicht damit, Best-Practice-Beispiele aufzuzählen, bleibt nur der Schritt nach vorne. Die aktuellen Aufgaben zwingen uns, überkommene Trennungen von bebautem und unbebautem Raum zugunsten eines interaktiven, besser noch intraaktiven Zusammenwirkens der beiden Raumkategorien zu
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2022 Welche Dichte braucht die Stadt?
In der gebauten Stadt greifen die Indizien der Urbanität – gefasste Plätze und Straßen, Märkte und Feste – oft ineinander. Das Missverständnis, Urbanität sei allein durch eine kompakte, dichte Baustruktur zu erzeugen, ist dennoch verbreitet. Die von Thomas Sieverts vorgenommene Unterscheidung in „gebaute“ und „gelebte“ Urbanität ist dabei eine hilfreiche Differenzierung, um städtische Räume zu verstehen und zu entwerfen. „In Ermangelung eines solchen dichten und lebendigen Straßenlebens wird die ‚gebaute’ Urbanität von geschlossenen Häuserwänden an Korridorstraßen, von Plätzen und Alleen häufig stellvertretend für die ‚gelebte’ Urbanität gesehen“ (Sieverts 1997 S. 32/33). Auch das städtebauliche Leitbild der 1960er und 1970er Jahre „Urbanität durch Dichte“, das seine räumliche Übersetzung in Form von Großwohnsiedlungen erfahren hat, zeigt, dass Dichte alleine nicht ausreicht, um Urbanität zu erzeugen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2022 Welche Dichte braucht die Stadt?

Erschienen in Heft 4/2022 Soziale Verantwortung und Mitbestimmung in der Wohnungswirtschaft
Wohnen ist eine Zukunftsaufgabe, auch und besonders für Kleinstädte – eine Herausforderung, in der aber auch eine Chance liegt. So gilt es für Kleinstädte in peripheren Lagen, Leerstand zu reaktivieren, dem Bevölkerungsschwund entgegenzuwirken und Fachkräfte zu halten bzw. neue anzuziehen. In zentralen Lagen hingegen stehen Kleinstädte unter hohem Zuwanderungsdruck. Neu- und Umbau stehen ganz oben auf der Tagesordnung – im Übrigen auch, um den angespannten Wohnungsmarkt einer Metropole oder Großstadt in der Nähe zu entlasten. Wer moderne und inklusive Wohnangebote sucht, die auf die unterschiedlichen Bedarfe vor Ort zugeschnitten sind, findet vielfältige Beispiele gerade in Kleinstädten. Sie können zur Bewältigung der Wohnungsfrage und der ambitionierten Neubauziele der Bundesregierung einen wichtigen Beitrag leisten.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2022 Soziale Verantwortung und Mitbestimmung in der Wohnungswirtschaft
Die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Klara Geywitz, hat mit ihrem Amtsantritt das weitreichende politische Ziel des Bundes formuliert, jährlich 400.000 neue Wohnungen, darunter 100.000 Sozialwohnungen, errichten zu wollen. Dieses anspruchsvolle Vorhaben hat den vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung zu einer Fachkonferenz inspiriert, auf der die verschiedenen programmatischen, analytischen und anwendungsbezogenen Perspektiven von Bundespolitik, Wissenschaft und kommunaler Praxis zusammengeführt und zu einem Erfahrungsaustausch miteinander ins Gespräch gebracht werden sollten. Die hybrid gestaltete Fachtagung, vom Fernsehsender ALEX Berlin sowie auf YouTube und der vhw-Website live übertragen, fand am 16. Juni 2022 in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften statt.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2022 Zukunft Landwirtschaft: zwischen konkurrierender Landnutzung und Klimawandel
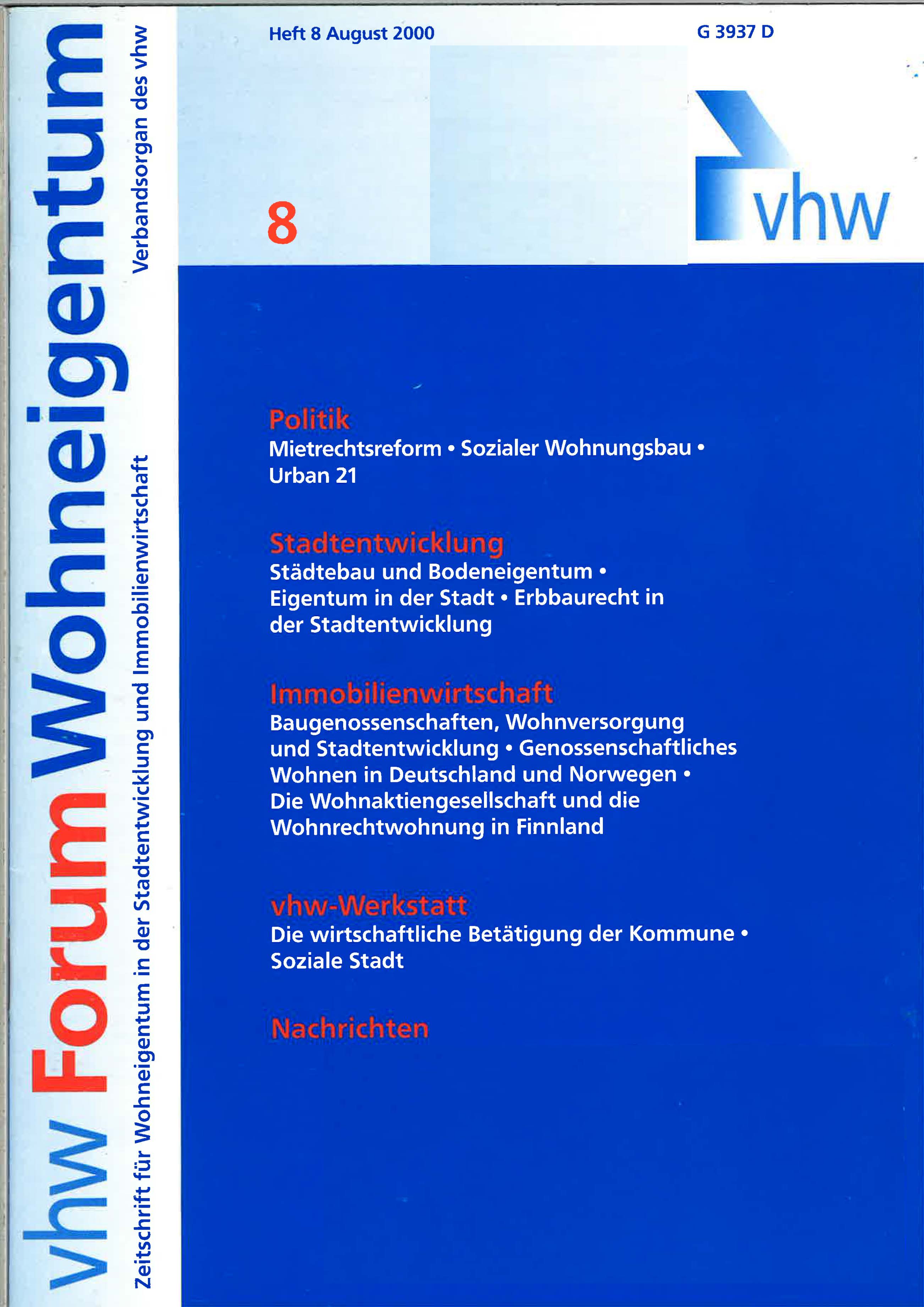
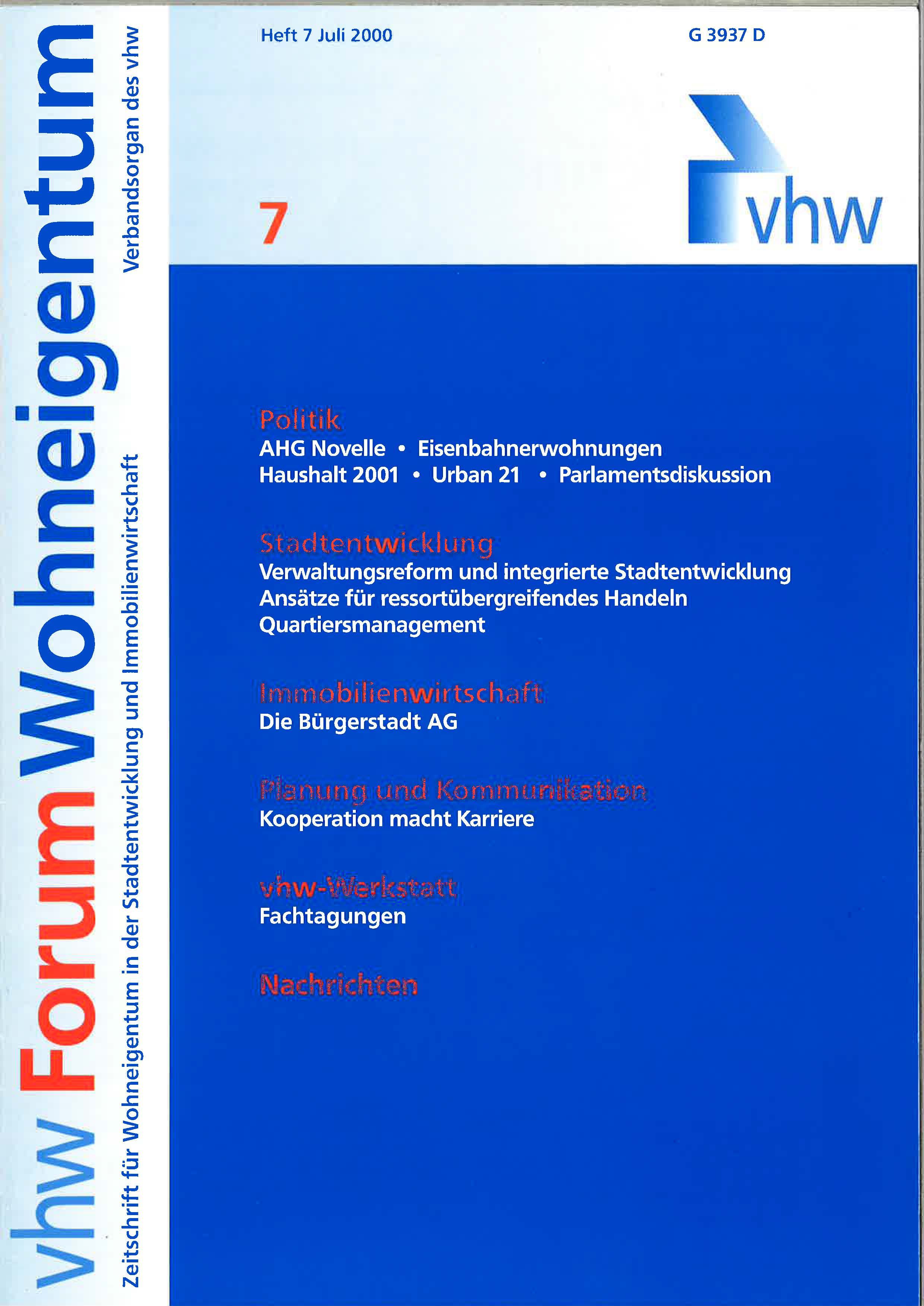
Erschienen in
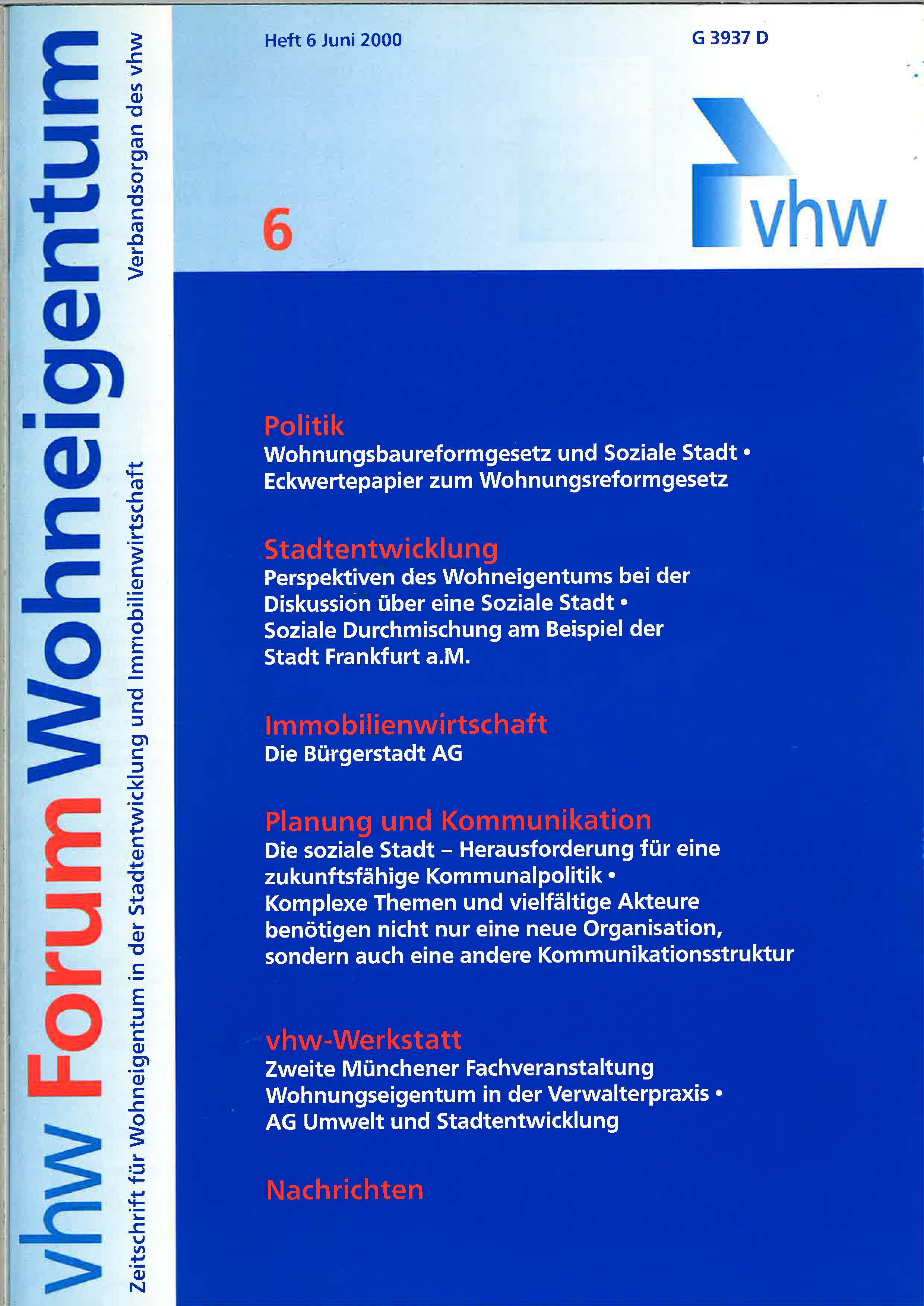
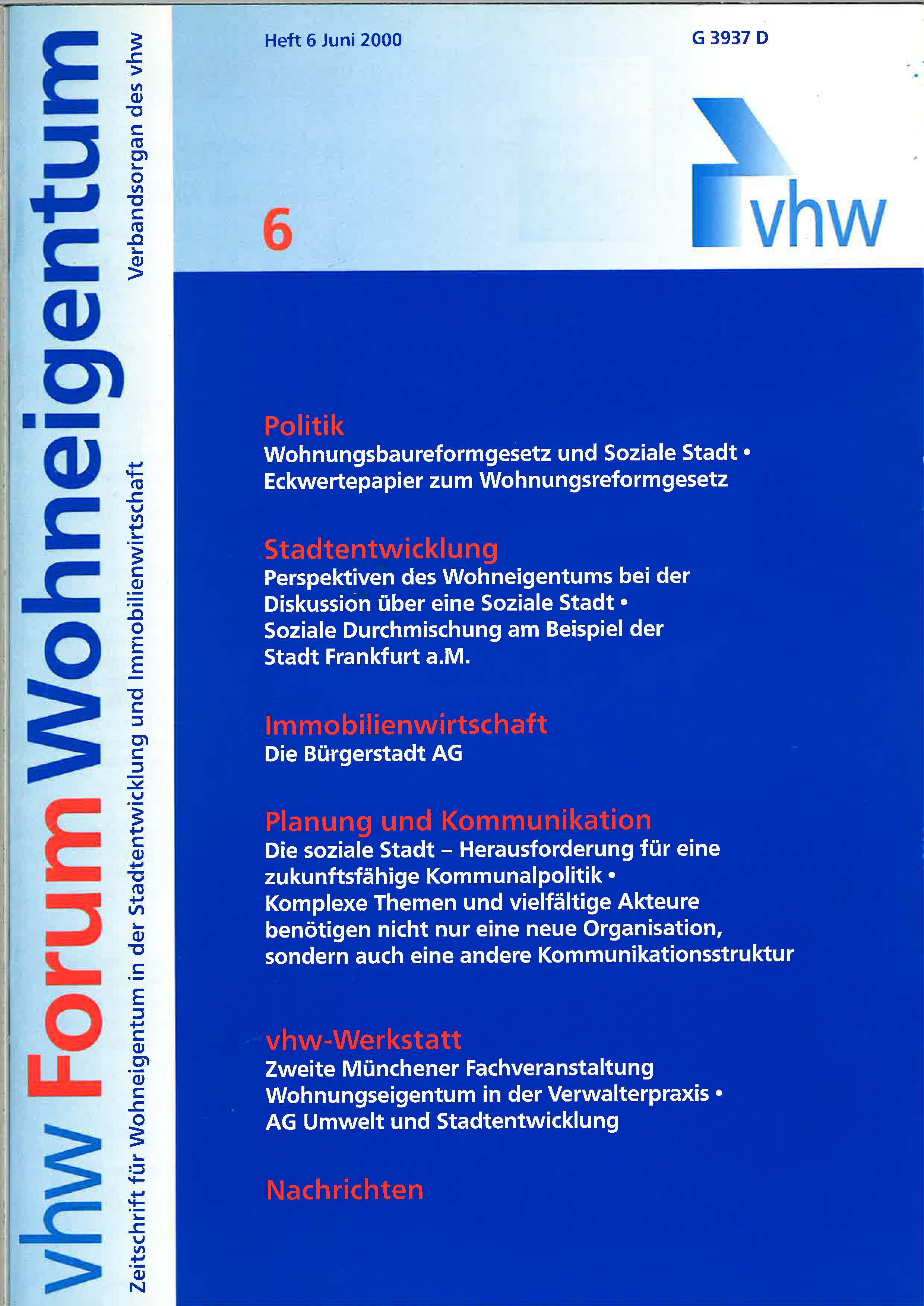
Erschienen in
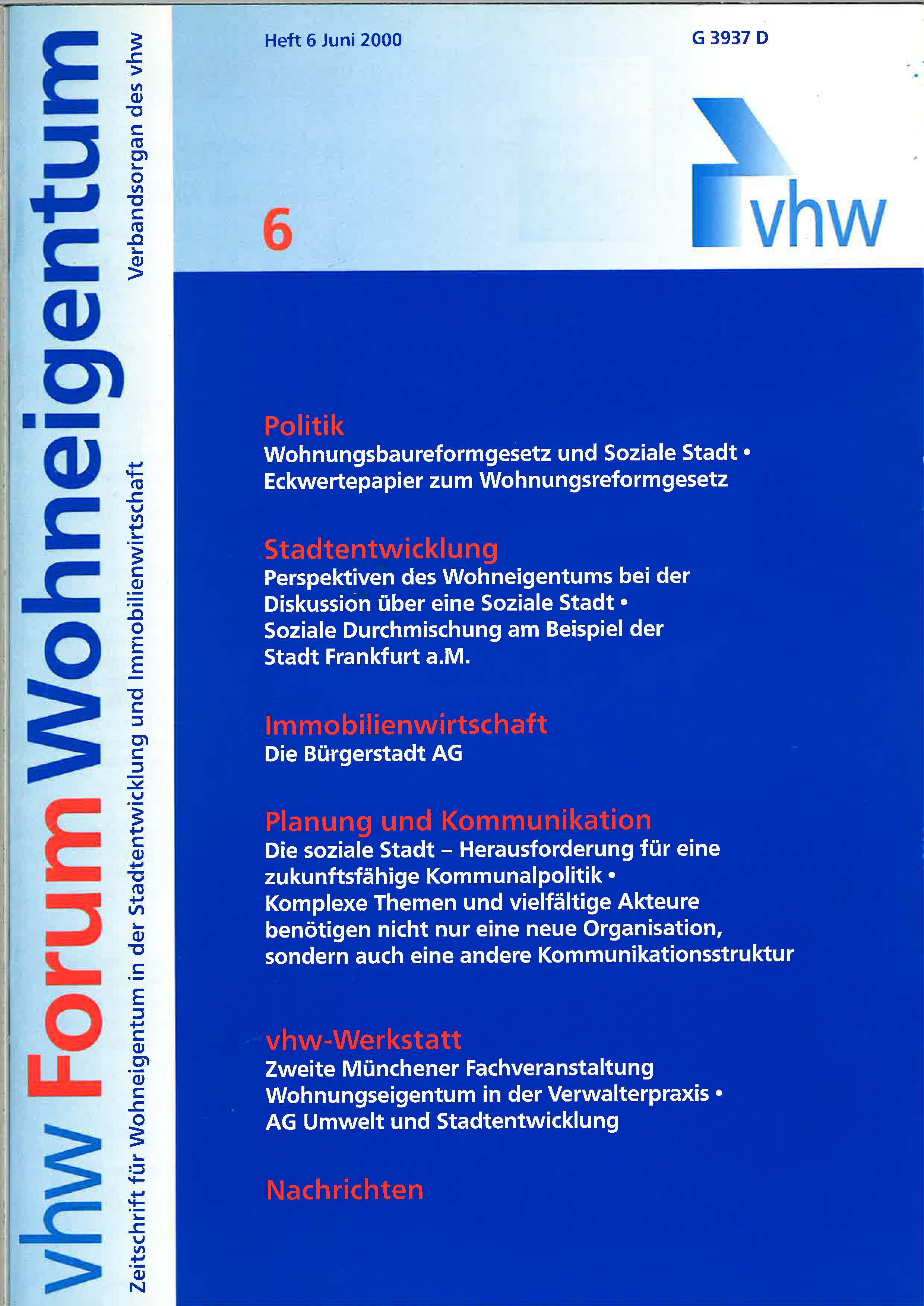
Erschienen in
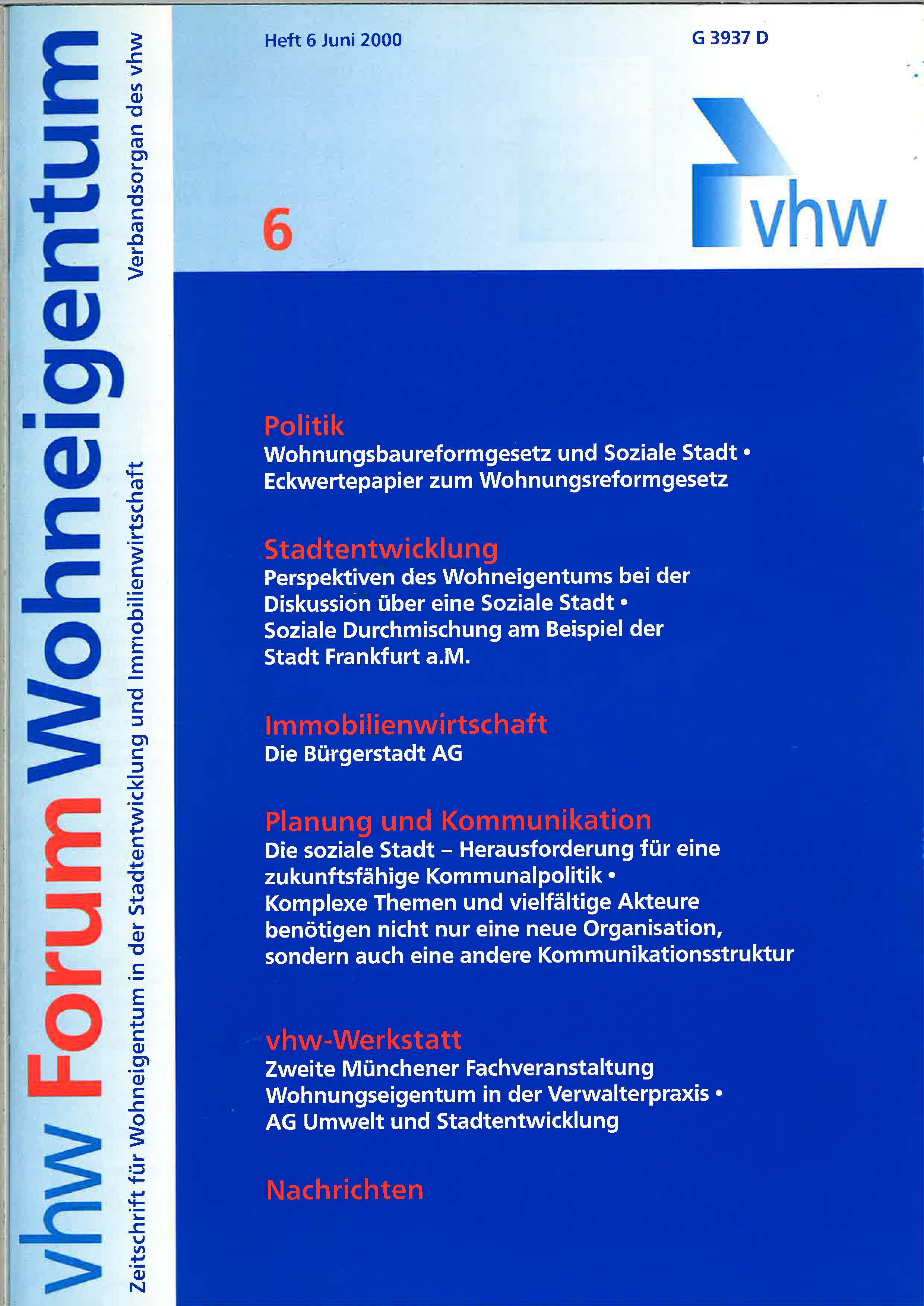

Erschienen in
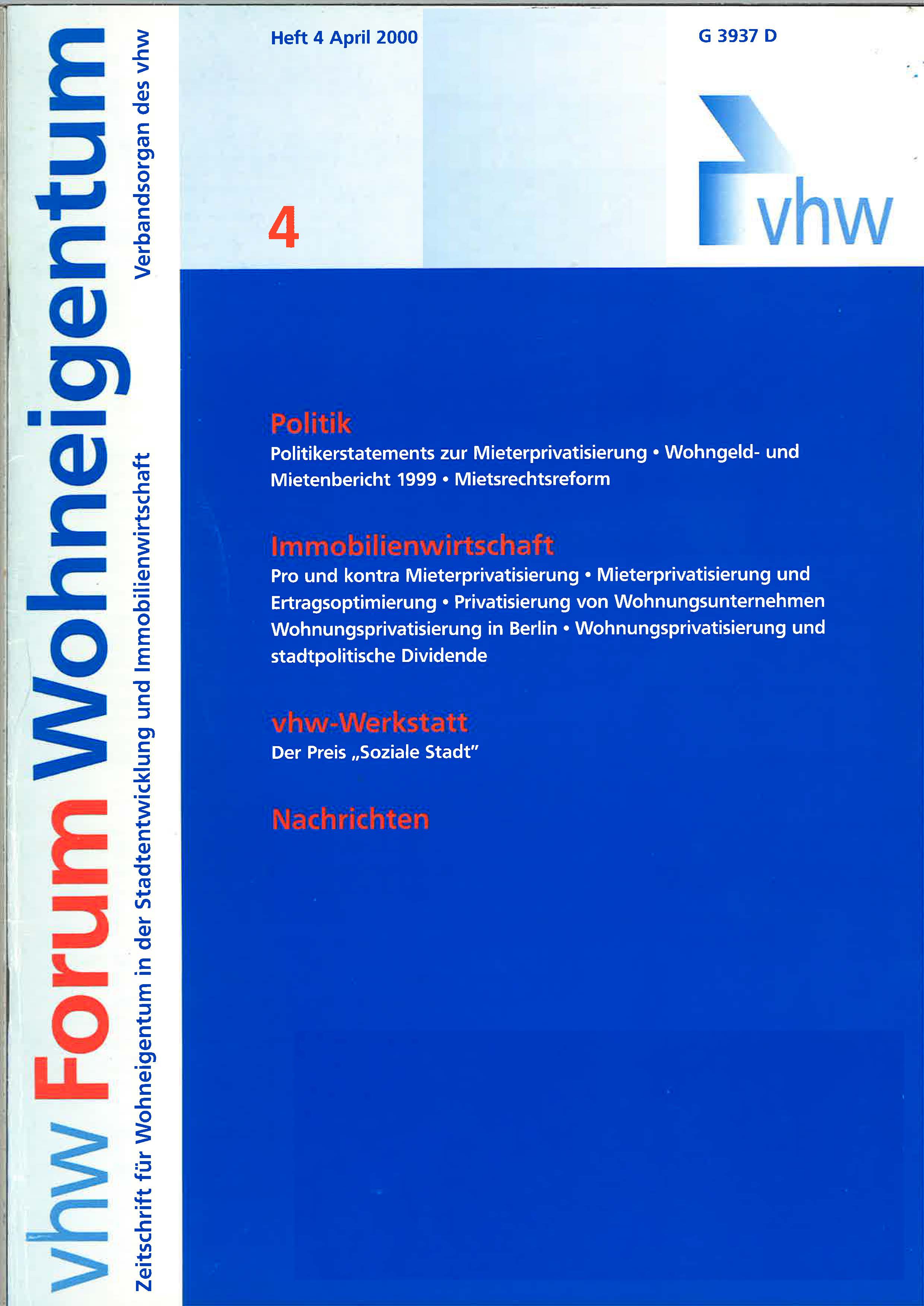
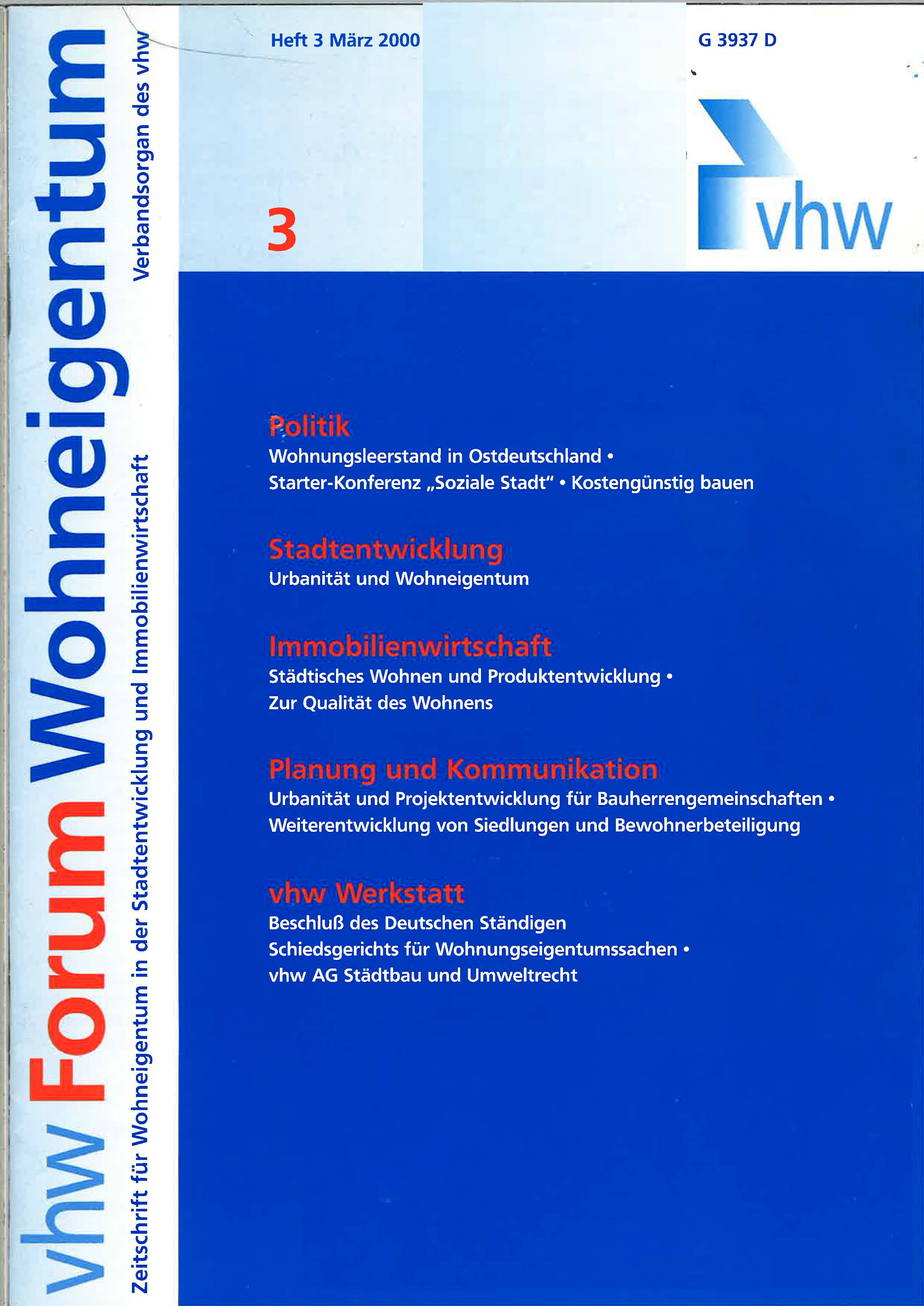
Erschienen in
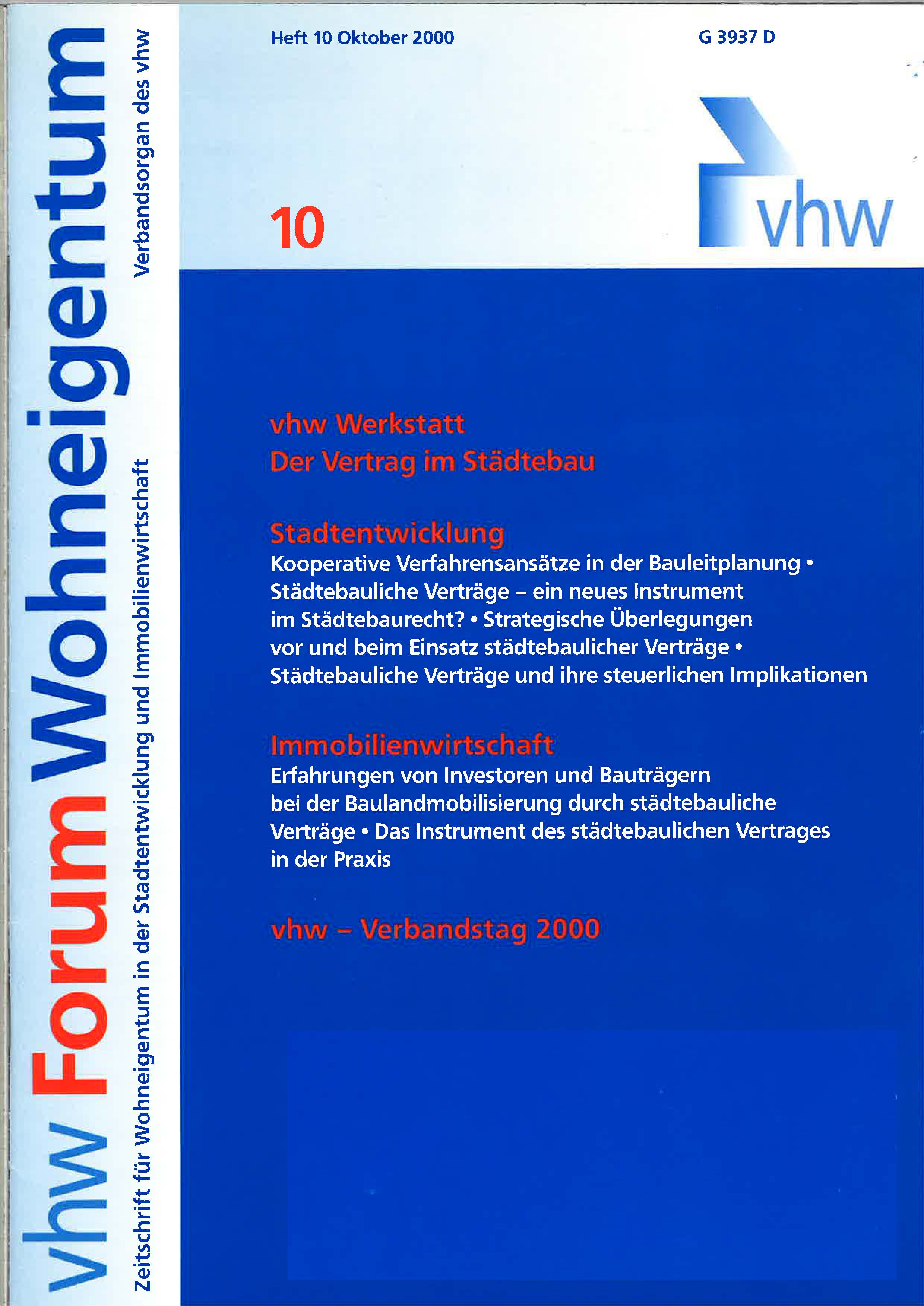
Erschienen in
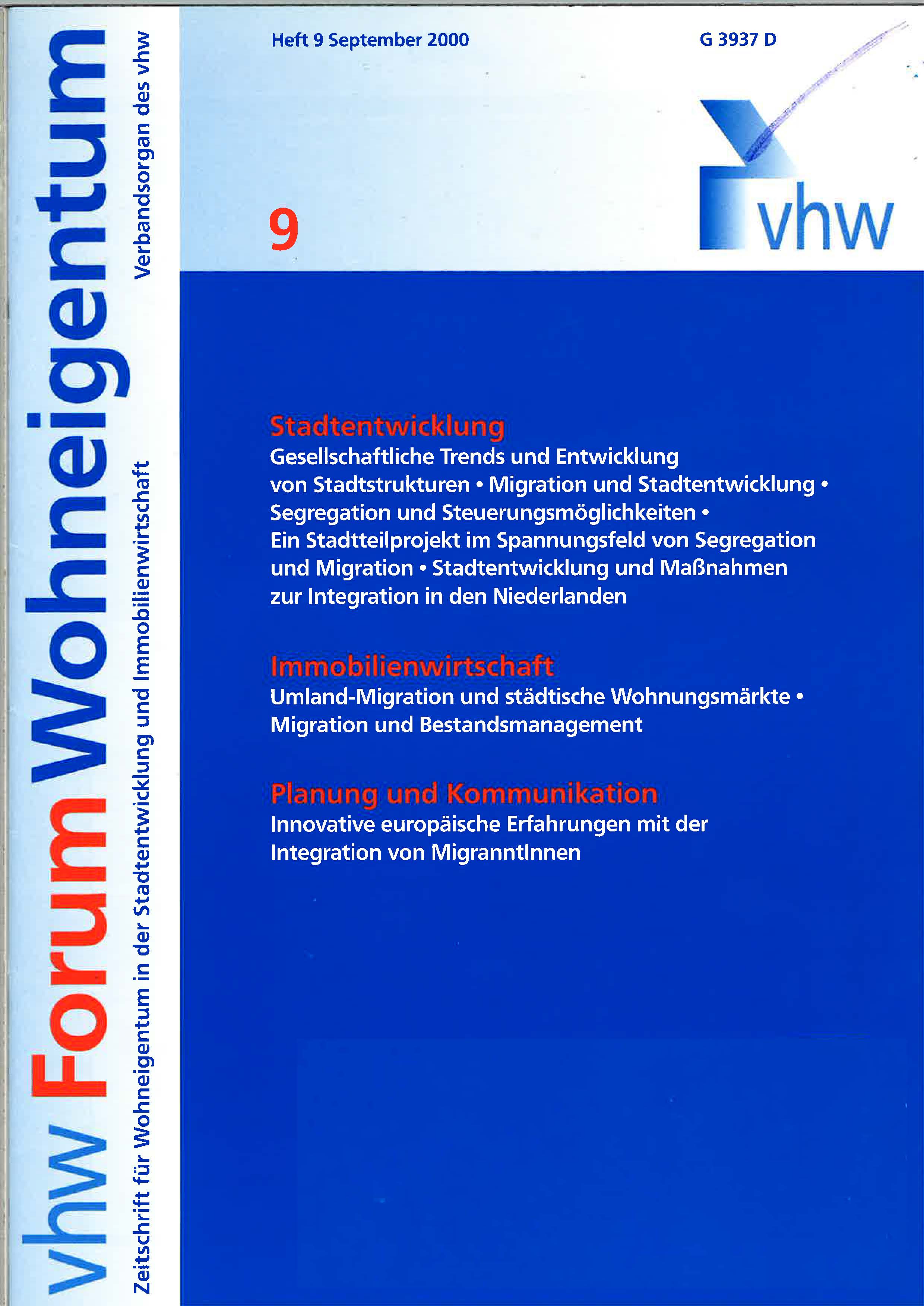
Erschienen in
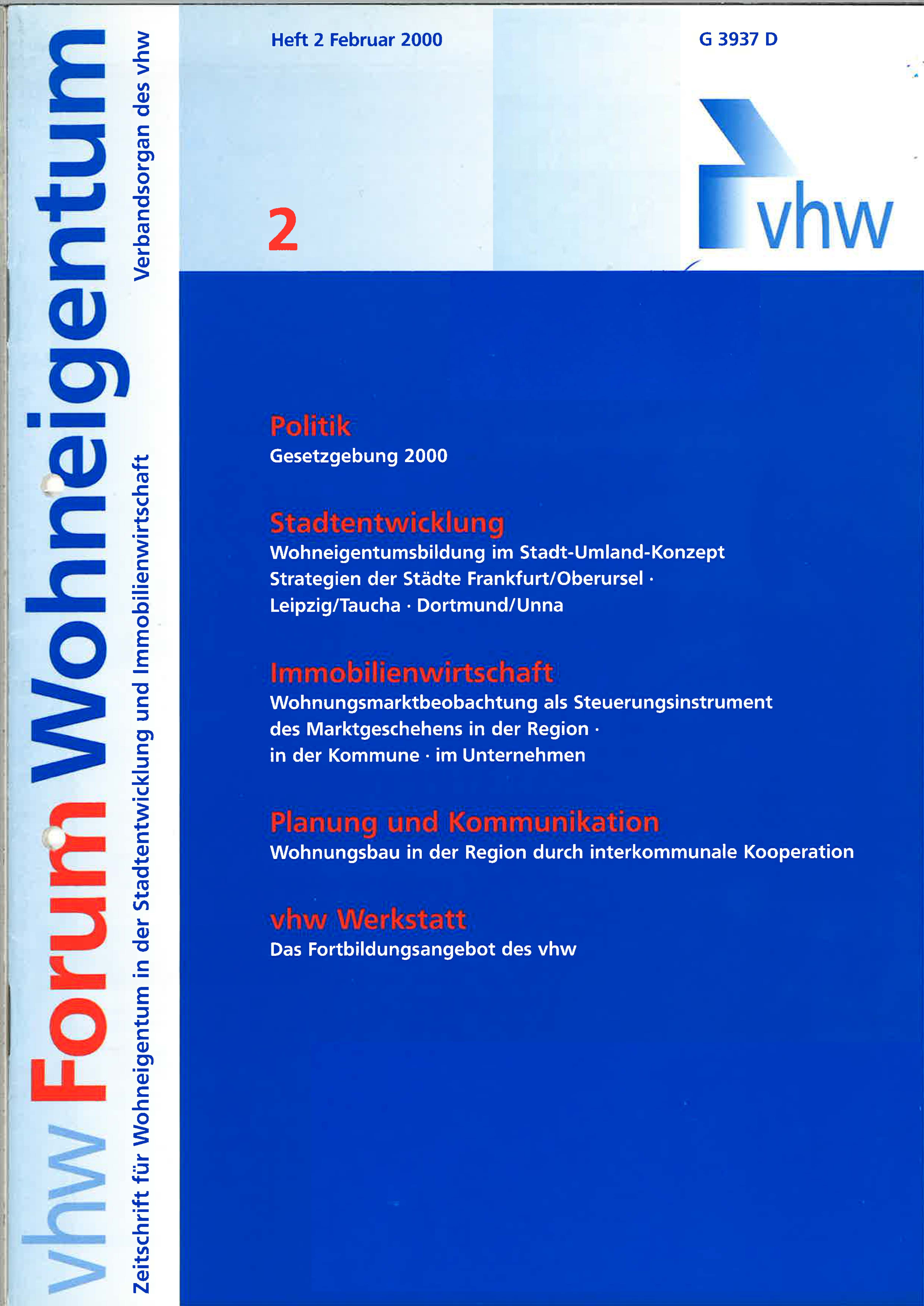
Erschienen in

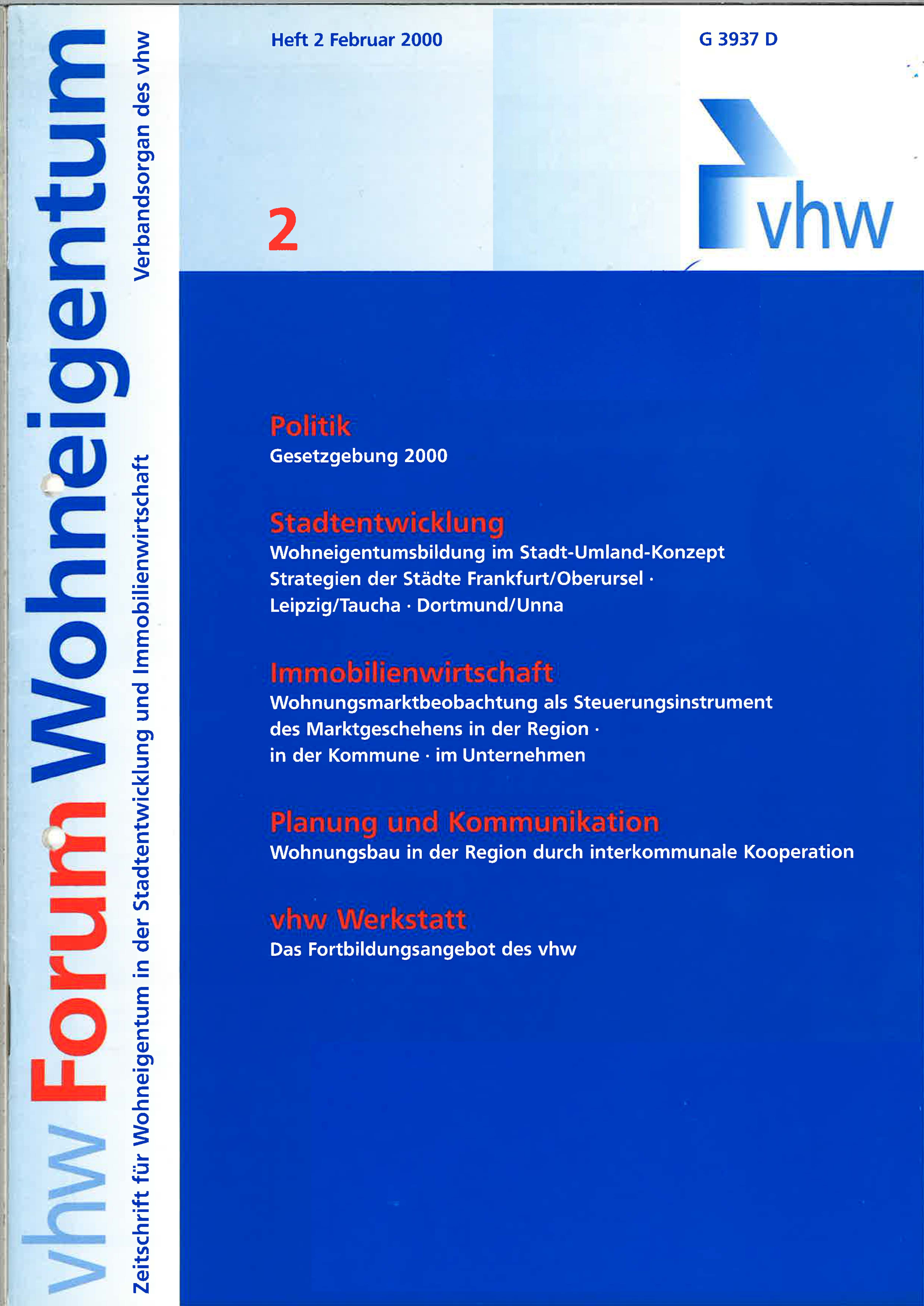
Erschienen in

Erschienen in Heft 2/2022 Stadtentwicklung und Hochschulen jenseits der Metropolen
Auf dem neuen Lukas-Cranach-Campus im Stadtzentrum der bayerischen Kleinstadt Kronach (17.700 Einwohner) sollen sich in den nächsten Jahren Studiengänge und Transferinstitute der Hochschulen Coburg und Hof ansiedeln. Der Umwelt-Campus Birkenfeld ist Fachhochschule und Standort der Universität Trier auf einem ehemaligen US-Militärgelände im ländlichen Rheinland-Pfalz. Das hessische Witzenhausen (15.000 Einwohner) bezeichnet sich als die kleinste Universitätsstadt Deutschlands. Hier befindet sich eine Außenstelle der Universität Kassel für Ökologische Landwirtschaft und Nachhaltige Regionalentwicklung. Gerade in den Klein- und Mittelstädten ländlicher Regionen erhoffen Politik, Verwaltung und Wirtschaft Innovationen und Entwicklungsimpulse sowie die Chance, junge Menschen an Stadt und Region zu binden. Können Hochschulen „Ressource der Stadtentwicklung“ in Klein- und Mittelstädten ländlicher Regionen sein? Und welche Bedingungen müssen dafür erfüllt sein? Dies wird im Folgenden an einem weiteren Beispiel, der Hochschule Neubrandenburg, diskutiert.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2022 Stadtentwicklung und Hochschulen jenseits der Metropolen
Eingebettet in die besondere Kulturlandschaft des Rheingaus, im hessischen Rhein-Main-Gebiet, liegt die Hochschule Geisenheim University. Eine Jahrhunderte alte Wein- und Obstbautradition prägt diese Region. Im Jahre 1872 wurde hier die Königlich-Preußische Lehranstalt für Obst- und Weinbau zu Geisenheim gegründet. Daraus hat sich der Wissenschaftsstandort Geisenheim entwickelt, an dem Studierende und Forschende interdisziplinär Strategien für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft entwickeln. Über exemplarische Projekte wird verdeutlicht, auf welche Weise Geisenheim seine Sonderstellung in der Region als Lehr- und Forschungsstandort für die kommunale Entwicklung nutzt.
Beiträge