
Erschienen in Heft 3/2012 Integrierte Stadtentwicklung und Bildung
Der Wohnungsbau in Deutschland zieht wieder an. Die genehmigten Bauanträge in 2011 liegen bereits über den Genehmigungen für Wohnungsbauvorhaben der beiden Vorjahre 2009 und 2010, so entsprechende Statistiken und eigene Erfahrungen als Erschließungsträger. Die Mehrheit der genehmigten Bauvorhaben liegt, was weiter nicht verwundert, im Segment der Ein- und Zweifamilienhäuser. Damit sind wir wieder bei der dauerhaften Fragestellung, die trotz der viel beschworenen "Renaissance der Innenstädte" Entscheidungsträger von Kommunen, Stadtplaner und Architekten beschäftigt: Spielt das individuelle freistehende Einfamilienhaus in den entsprechenden Siedlungsstrukturen im Hinblick auf die Baukultur eine Rolle und wenn ja, welche?
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2012 Integrierte Stadtentwicklung und Bildung
Die empirischen Daten erlauben keinen Zweifel daran, dass der Demokratie gegenwärtiger Bauart die Menschen davonlaufen: Die Beteiligung an den Wahlen sinkt seit geraumer Zeit dermaßen deutlich, dass man nicht mehr daran vorbeikommt, von einem Trend zu sprechen. Ungeachtet dessen steigt die Zahl der Wechselwähler, die keine eindeutige Bindung zu einer bestimmten Partei mehr besitzen. Aber auch die Zahl der beharrlichen Nichtwähler steigt immer mehr an und wird nur durch gelegentliches Protestwahlverhalten gebremst. Die Mitgliedschaft in den Parteien, die nie sonderlich hoch war, sinkt insgesamt gesehen kontinuierlich weiter ab. Eine Krise der Demokratie abstreiten zu wollen, würde somit offenbar einem Beschwichtigungsversuch gleichkommen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2005 Stadtregional denken – nachfrageorientiert planen

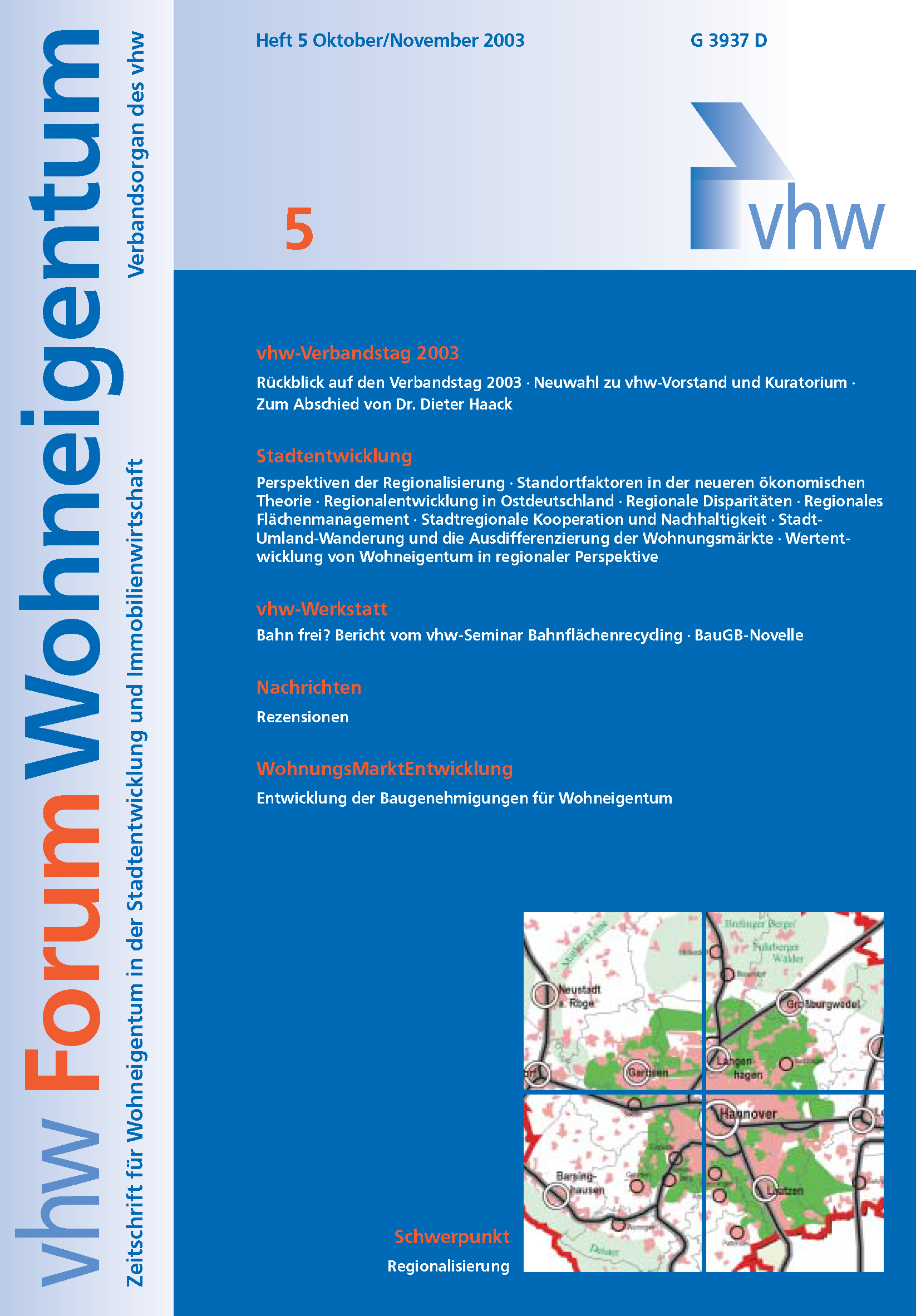
Erschienen in
Wie werden unsere Städte in 30 Jahren regiert und organisiert sein? Wird es sie in der heutigen Form noch geben oder werden wir ganz selbstverständlich in Stadtquartieren leben, die in Stadtregionen zusammengeschlossen sind? Kann diese oder eine möglicherweise ganz andere Zukunft vorausschauend in und von den Städten gestaltet werden und wie sehen die Spielräume und möglichen Entwicklungspfade aus? Keine leichten Überlegungen angesichts der bereits heute kaum lösbaren Probleme, denen Städte und Stadtregionen gegenüberstehen, und dennoch wichtige Fragen, die von den Beteiligten des Forschungsverbundes "Stadt 2030" aufgeworfen und bearbeitet werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2006 Neue Investoren auf dem Wohnungsmarkt und Folgen für die Stadtentwicklung
Der Markt für deutsche Wohnimmobilien hat sich in den letzten Jahren belebt. Ausländische Investoren haben diese Anlageklasse zunehmend für sich entdeckt und kaufen große Wohnportfolios der öffentlichen Hand sowie von privaten Unternehmen. Allein die größten Transaktionen in den Jahren 2004 und 2005 ergeben insgesamt 550.000 deutsche Wohnimmobilien im Gesamtwert von rd. 25 Mrd. Euro. Der Verkauf der WOBA in Dresden mit nahezu 50.000 Wohneinheiten im März 2006 scheint hierbei keineswegs der Schlussakt zu sein. Offensichtlich kommen derzeit Kaufs- und Verkaufsinteressen sehr gut zusammen. Der Beitrag beschreibt den Umfang der neuen Entwicklung auf dem deutschen Wohnungsmarkt und analysiert die Motivation der Investoren, um daraus die Folgen für den deutschen Wohnungsmarkt ableiten zu können.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2011 Mehr wissen – mehr wagen – mehr Dialog
In dem als "Wiege der Demokratie in Deutschland" bekannten Hambacher Schloss wurde das geistige Fundament der deutschen Demokratiebewegung im 19. Jahrhundert gelegt. Bis heute hat dieser Ort nicht an Anziehungskraft für weltoffene Bürger verloren. Das zeigte sich gerade auch beim diesjährigen Vergaberechtsforum des vhw-Südwest speziell für Teilnehmer aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, die die Gelegenheit nutzten, Impulse zu zentralen Fragestellungen des Vergaberechts und seinen praktischen Auswirkungen bei der öffentlichen Hand durch hochkompetente Referenten zu erhalten und mit ihnen zu diskutieren. Nachfolgend werden die Kernaussagen durch die Referenten zusammengefasst und wiedergegeben.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2014 Ländlicher Raum und demografischer Wandel
Erst allmählich rückt der ländliche Raum in die integrationspolitische Betrachtung. Maßgeblichen Einfluss hatte der Diskurs zum Nationalen Integrationsplan der Bundesregierung, der das Thema auch bei den Kommunen im ländlichen Raum stark befördert hat. Gleichzeitig haben der demografische Wandel und der sich abzeichnende Fachkräftemangel den Blick auf Zuwanderung und Integration in den ländlichen Kommunen gelenkt. Vor diesem Hintergrund hat die Schader-Stiftung zusammen mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dem Deutschen Landkreistag und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund das Projekt "Integrationspotenziale in kleinen Städten und Landkreisen" von 2009 bis 2011 durchgeführt. Mit diesem Projekt wurde erstmalig die Situation von Zuwanderern in Klein- und Mittelstädten des ländlichen Raums bundesweit vergleichend untersucht.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2016 Kommunalpolitik zwischen Gestaltung und Moderation
„Kommunalpolitik zwischen Gestaltung und Moderation“, so heißt der Titel dieses Schwerpunktheftes. Wir haben in den Städten Ludwigsburg, Mannheim und Saarbrücken bei den Stadtoberhäuptern nachgefragt, wie es bei den gewählten Bürgervertretern aussieht bei der Suche nach Orientierung zwischen Wählerauftrag und Bürgerwillen und ob der Gestaltungsspielraum in Ratsfraktionen, Fachausschüssen und Stadtverordnetenversammlung zunehmend von Bürgerinitiativen und Beteiligungsformaten eingeschränkt wird.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2016 Kultur und Stadtentwicklung
Meine eigene Profession, die der Kulturarbeiter insbesondere im kommunalen Bereich, würde ich verraten, wenn ich nicht dafür plädieren würde, überall dort, wo Menschen zusammenleben, Orte und Räume vorzuhalten, die eine kulturelle Nutzung ermöglichen: Präsentation von Kunst, dem „harten Kern“ eines kulturellen gesellschaftlichen Lebens, benötigt Räume – nach Möglichkeit geeignete. Und dieses kulturelle Leben macht die Seele eines Gemeinwesens aus. Und doch tue ich dies nicht mehr mit dem gleichen Druck und Nachdruck, mit dem ich viele Jahre lang in meiner „Heimatkommune“, dem Bezirk Neukölln von Berlin, agierte, wo aus dem Nichts Voraussetzungen für zunächst verschüttetes kulturelles Leben zu schaffen waren.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2016 Kultur und Stadtentwicklung
Will man über die nachhaltigen Effekte der Kulturhauptstadt Europas „RUHR.2010 – Essen für das Ruhrgebiet“ nachdenken, führt kein Weg an der Genese dieses einzigartigen kulturellen Festjahres in 53 Städten vorbei. Das Ruhrgebiet als altindustrielle Region, die massiv vom Strukturwandel und den Auswirkungen durch den Wegfall der Stahl- und Kohleindustrie gebeutelt war und ist, bekam durch die IBA Emscher Park unter der Leitung von Prof. Dr. Karl Ganser über einen Zeitraum von zehn Jahren (1989 bis 1999) eine neue Perspektive und vor allem eine neue inhaltliche und räumliche Nutzungsstruktur. Industriehallen wurden zu Orten – Kathedralen – der Kunst und Kultur, Halden wurden zu Landmarks und Ausflugszielen, Industriebrachen zu renaturierenden Parks etc. Vor allem das heutige Welterbe Zollverein erhielt mit dem Masterplan von Rem Koolhaas als Ort für Design, regionale Erinnerungskultur sowie Performing Arts eine zentrale Bedeutung bei den Transformationsprozessen der Region.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2015 Aus- und Weiterbildung in der Stadtentwicklung
Im Rahmen eines selbstbestimmten Projektes am Institut für Stadt- und Regionalplanung (ISR) der TU Berlin wurde 2014 eine umfassende Analyse des Berufsfeldes der Stadt- und Raumplanung durchgeführt. Anlass dafür waren die zahlreichen Diskussionen innerhalb der Planungsschulen im deutschsprachigen Raum über die Anpassung der Ausbildung der Stadt-/Raumplaner. In der Fachwelt wird kontinuierlich versucht, Antworten darauf zu finden, nicht zuletzt auch durch mehrere Positionspapiere zur Stadtentwicklung (zuletzt die „Kölner Erklärung“ der TU Dortmund, die „Aachener Polemik“ der RHTW Aachen sowie die „Erfurter Einladung“ der Bundesfachschaft für Stadt- und Raumplanung). Dabei stellt sich auch die Frage, welche Anforderungen die heutige Berufswelt an Absolventen stellt und wie sich dieses Anforderungsprofil in Zukunft entwickeln wird.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2015 Intermediäre in der Stadtentwicklung

Erschienen in Heft 6/2013 Perspektiven für eine gesellschaftliche Anerkennungskultur
Das Grundverständnis, dass Kommunen sich nur gemeinsam durch alle Beteiligte positiv entwickeln, setzt sich stetig mehr durch. Sichtbar wird dies durch immer vielfältigere und zahlreichere Dialoge und Prozesse in den Kommunen. In Mannheim wird dem Wunsch der Bürgerschaft nach Mitsprache und Mitgestaltung durch eine Methodenvielfalt und zahlreiche Angebote zur formellen und informellen Beteiligung und zum Bürgerschaftlichen Engagement entsprochen. Die Stadt möchte sich gemeinsam im Dialog weiterentwickeln. Die Kompetenz der Bürgerschaft wird für die Entwicklung der Stadt genutzt und durch Teilhabe die politische Willensbildung der Bürger gefördert. Die gemeinsame Verantwortung aller für ihre Stadt bildet die Grundlage für eine weltoffene Metropole, deren lebendiger Charakter das Ergebnis einer aktiven und sozialen Stadtgemeinschaft ist. Ziel ist die Stärkung der lokalen Demokratie.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2013 Perspektiven für eine gesellschaftliche Anerkennungskultur
Bürgerschaftliches Engagement entsteht aus den unterschiedlichsten Motiven heraus, die zwischen persönlicher Sinnfindung, dem Wunsch nach Kontakten und Gemeinschaft, der Weitergabe von individuellen Kompetenzen und Gestaltungswille des eigenen Umfeldes liegen können. Die Weiterentwicklung der Zivilgesellschaft und die Gewinnung von Bürgergruppen aus den verschiedenen Milieus und Lebenslagen heraus erfordern nicht nur die Eröffnung neuer Tätigkeitsfelder für ein bürgerschaftliches Engagement, sondern auch verbesserte Vernetzungsstrukturen und die Herausarbeitung differenzierter Rollenanforderungen. Das Miteinander der verschiedenen Akteure vor Ort drückt sich in nicht unerheblichem Maße durch eine gelebte Anerkennungskultur des bürgerschaftlichen Engagements aus.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2013 Perspektiven für eine gesellschaftliche Anerkennungskultur
Unsere Städte sind zunehmend durch demografischen (graue Gesellschaft, multikulturelle Gesellschaft), sozialen (Individualisierung, Mangel sozialen Kapitals) und ökonomischen Wandel (ökonomische Ungleichheit, Prekarisierung, Armut) geprägt. Die Ungleichheit in städtischen Gesellschaften wächst und macht ein Diversity-Management im Spannungsfeld zwischen kultureller Angleichung oder Förderung von Vielfalt notwendig. Hier setzen Projekte der sozialen Innovation an. Politik und insbesondere lokale Politik ist mit sinkender Wahlbeteiligung und Protest konfrontiert. Auf die Legitimationskrise reagieren Politik und Verwaltung mit neuen politischen Beteiligungschancen und demokratischer Innovation.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2013 Diversität und gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Stadt

Erschienen in Heft 1/2016 E-Commerce und Stadtentwicklung
Die Landeshauptstadt Kiel erprobt veränderte Wege der Bürgerbeteiligung. Im Rahmen des Projektes Städtenetzwerk organisiert die Stadt Kiel im Stadtteil Suchsdorf seit Sommer 2014 mit Unterstützung des vhw einen Beteiligungsprozess, der einen erweiterten Umgang mit Bürgerbeteiligung in der Landeshauptstadt einleitet. Seitens der Bevölkerung ist eine positive Resonanz feststellbar, die auch in andere Stadtteile ausstrahlt und den Wunsch nach mehr Beteiligung weckt. So wurde im Stadtteil Elmschenhagen von den Bewohnern ebenfalls eingefordert, ein Beteiligungsverfahren nach dem Vorbild Suchsdorfs durchzuführen. Innerhalb der Verwaltung wird im Prozess dezernatsübergreifend intensiv zusammengearbeitet und somit integrierte Stadtentwicklung praktiziert. Ein gutes Beispiel einer neuen Beteiligungskultur.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2016 E-Commerce und Stadtentwicklung
Die Steuerung und Genehmigung von Windenergieanlagen (WEA) richtet sich in zahlreichen Bundesländern nicht mehr nach dem Regionalplan, sondern nur noch nach den gesetzlichen Vorgaben des Bauleitplanungsrechts und des Immissionsschutzrechts. Als Konsequenz hieraus sind grundsätzlich im gesamten unbeplanten Außenbereich einer Kommune auf windhöffigen Flächen WEA zulässig, die im Schwarzwald in der Regel als Windfarmen mit bis zu fünf WEA errichtet werden. Der Ausbau der Windenergienutzung ist teilweise mit einem multipolaren Konfliktpotenzial verbunden. Der vorliegende Beitrag zeigt sowohl das Konfliktpotenzial anhand eines aktuellen Beispielfalles auf als auch die Möglichkeit der Konfliktprävention durch den Einsatz der Mediation bei der Planung, Genehmigung und dem Betrieb von Windenergieanlagen.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2015 Quartiersmanagement
Blickt man auf das Quartiersmanagement, so rücken zunächst die positiven Errungenschaften in das Blickfeld. In Quartieren mit multiplen Problemlagen wurden den aufgrund von Ausgrenzung und Desintegration problematischen Lebenslagen der Bewohner begegnet, Akteure und Ressourcen vernetzt, Kooperationen gestärkt, Betreuungsangebote ausgebaut sowie partizipative Ansätze umgesetzt. Aus kritischer Perspektive ist Quartiersmanagement das Resultat einer expertokratischen Politik, die durch den Abbau wohlfahrtsstaatlicher Leistungen jene Lebenslagen verursachte. Räumlich und zeitlich begrenzt, administriert Quartiersmanagement Probleme, deren Ursachen außerhalb des Quartiers liegen und sich dort einer notwendigen politischen Diskussion entziehen.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2015 Quartiersmanagement
Das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ ist ein Erfolgsmodell. Seit 1999 wurde es in 390 deutschen Städten und Gemeinden mit 659 Gesamtmaßnahmen implementiert (Stand 31.12.2014, nach www.staedtebaufoerderung.info). Dass das Programm im Grundsatz funktioniert, zeigen – trotz berechtigter Kritik an Details – die vorliegenden Evaluationen auf Bundes- und Länderebene. Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit das Programm mit anderen Logiken der Stadtentwicklung harmoniert. Der vorliegende Beitrag zeigt Ambivalenzen sozialer Stadtentwicklungspolitik am Beispiel der Bernauer Straße in Berlin auf, wo bis 1990 noch die Mauer stand und die sich heute als eine Art „Sozialäquator“ zwischen Brunnenviertel und Rosenthaler Vorstadt erstreckt.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2016 Renaissance der kommunalen Wohnungswirtschaft
Eines der wesentlichen Ziele des 2002 eingeführten Programms Stadtumbau Ost besteht darin, Kommunen und Wohnungseigentümer bei der Reduzierung von Leerständen zu unterstützen. Neben den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften waren vor allem auch größere genossenschaftlich organisierte Unternehmen bei Programmbeginn mit über 50 % des vorhandenen Wohnungsbestandes die größte Eigentümergruppe. Insofern waren sie, neben den Kommunen selbst, auch die wichtigsten Adressaten des Programms Stadtumbau Ost. Der vorliegende Beitrag reflektiert die Rolle großer Wohnungsunternehmen im Stadtumbau Ost nach mittlerweile vierzehn Jahren Programmumsetzung und zeigt aktuelle Herausforderungen für eine weitere Beteiligung der "organisierten Wohnungswirtschaft" am Stadtumbau in den neuen Ländern auf.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2016 Renaissance der kommunalen Wohnungswirtschaft
Auf vielen (Miet-)Wohnungsmärkten in deutschen Groß- und Universitätsstädten sind insbesondere im Segment des bezahlbaren Wohnraums massive Engpässe festzustellen – die Wohnraumversorgung von Personen mit geringem Einkommen gestaltet sich zunehmend schwieriger. Nicht zuletzt deshalb wird in der aktuellen Debatte um eine "neue soziale Wohnungspolitik" der Ruf nach einem stärkeren Engagement kommunaler und kommunal verbundener Wohnungsunternehmen stetig lauter. Auf der Nachfrageseite liegen die Gründe für die sich zuspitzende Entwicklung vor allem in einem starken Zuzug in die prosperierenden Regionen, in dem steigenden Flächenkonsum pro Kopf sowie in der Zuwanderung aus dem Ausland.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2017 Sozialorientierung in der Wohnungspolitik
Bürgerschaftliche Initiativen übernehmen in immer mehr Stadtteilen Verantwortung für ihre Nachbarschaft. Dort, wo kommunale Infrastruktur, bezahlbarer Wohnraum, Kultur-, Lern- und Begegnungsorte drohen verloren zu gehen oder fehlen, werden Bürgerinnen und Bürger aktiv und entwickeln Immobilien für sich und andere. Doch die Rahmenbedingungen bei der Bodenvergabe, der Finanzierung und der Zusammenarbeit mit Kommunen sind zum Teil schwierig. Aber es gibt viele positive Beispiele und das Netzwerk Immovielien, das diese Rahmenbedingungen verbessern will.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2013 Diversität und gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Stadt
Der soziale und gesellschaftliche Zusammenhalt ist in weiten Teilen Europas in eine ernste Krise geraten. Die Ursachen und Symptome sind vielfältig und reichen von einer breiten Individualisierung und Entsolidarisierung über den schwierigen Umgang mit wachsender Vielfalt („diversity management“) bis zur Vertiefung der sozialen Spaltung in vielen Staaten. Besonders betroffen sind die größeren Städte, in denen sich ungeachtet aller Anstrengungen diese negativen Entwicklungen bündeln und sich ihre Symptome am deutlichsten zeigen. Die Krisenerscheinungen der Kohäsion gehen einher mit einem Vertrauensverlust in demokratische Institutionen und Mechanismen. Teile der Stadtgesellschaften sind im sozialen wie im politischen Sinn abgekoppelt.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2013 Stadtentwicklung anderswo
Stadtentwicklungsplanung als Regelsystem mit zahlreichen Individuen, Interessengruppen, Politikern, Planern und Juristen als Akteuren spiegelt grundsätzlich die gesellschaftliche Akzeptanz von Interventionen in individuellen Grundeigentumsrechten wider. In postsozialistischen Gesellschaften mit der Erfahrung staatlicher Willkürakte unter der Vorgabe von "Planerfüllungen" ist diese Akzeptanz vielleicht unvermeidlicherweise als tendenziell gering einzuschätzen. In Polen etwa besteht bereits eine deutliche Zurückhaltung gegenüber dem Begriff der Planung. Dieser Beitrag beleuchtet aktuelle polnische Tendenzen der Stadtentwicklung zwischen bewirtschaftenden (postsozialistischen) und integrativen (europäisierten) Ansätzen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2014 Kommunikationslandschaften
„Achtung, Achtung, halt, Hände hoch oder ich schieße! Feuer, Tod, verboten, verrecken“ – Das waren die ersten deutschen Wörter, die ich in meiner Kindheit und Jugendzeit wahrnahm. Dass ich in den sechziger Jahren das Privileg hatte, in Teheran den Originalklang dieser furchterregenden Ausdrücke zu hören, verdankte ich den amerikanischen Antikriegsfilmen, die ich im Kino oder im Konsulat dieses Landes gesehen hatte; Filme wie Das Schloss in den Ardennen von Regisseur Sydney Pollack, z. B. In diesem Film spielt der charmante Schauspieler Burt Lancaster die Rolle eines amerikanischen Majors, der gegen die deutschen Truppen verlustreich kämpft. Gefesselt verfolgte ich ebenfalls das abenteuerliche Ringen seines Kollegen John Wayne mit den deutschen Nazis im Film The Sea Chase im Wirrwarr des Zweiten Weltkriegs quer über den Pazifik.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2012 Integration und Partizipation
Beim Planerladen e.V. handelt es sich um einen zivilgesellschaftlichen Akteur, der seit 1982 in der Dortmunder Nordstadt arbeitet. Die verschiedenen Stadtteilläden und -büros sind längst zu einem selbstverständlichen Teil der alltäglichen Infrastruktur geworden. Der Vereinsname ist gleichsam Programm: Mit dem vom Planerladen verfolgten Ansatz eines "Planens aus der Nähe" (Hardt-Waltherr Hämer) war in erster Linie die Erwartung verbunden, durch Ortsnähe und niedrigschwellige Ansprache zusätzliche Kontakt- und Kommunikationschancen zu eröffnen, um damit Beteiligungs- und Gestaltungsmöglichkeiten auch für die weniger mobilen, artikulationsschwächeren Bewohner zu schaffen. Ein wichtiges Markenzeichen der Arbeit ist darüber hinaus das Zusammenwirken von Planungs- und Sozialprofis auf der Basis interkultureller Tandems, was in Reaktion auf die Realitäten der Armutsentwicklung in einem Zuwanderungsstadtteil unvermeidlich ist.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2013 Perspektiven für eine gesellschaftliche Anerkennungskultur
Zum Verbandstag 2013 des vhw unter dem Motto "Vielfalt leben – Welche (Stadtentwicklungs-)Politik brauchen wir?" kamen am 14. November ca. 200 Gäste in die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften am Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte. Hintergrund der Thematik ist der für viele Beobachter unbestrittene Befund, dass zur Überwindung der auseinanderstrebenden Kräfte der Gesellschaft und des Vertrauensverlustes in die Politik eine neue Beteiligungs- und Kommunikationskultur als unverzichtbar gilt. Dies trifft insbesondere für die kommunale Ebene zu, wo sich die gesellschaftlichen Entwicklungen bündeln. So steht die weitere Ausdifferenzierung der Stadtgesellschaften in einem deutlichen Spannungsverhältnis zu den Zielen der sozialen Kohäsion der Gesellschaften – und damit letztlich auch zum Anliegen der Stärkung der lokalen Demokratie in der Stadtentwicklung. Die Veranstaltung wurde moderiert von Barbara Kostolik vom Bayerischen Rundfunk.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2017 Sozialorientierung in der Wohnungspolitik
Welches Bild sozialer Kohäsion erhalten die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt aus den lokalen Medien? Unterscheidet sich dieses Bild nach Stadt und Medium? Diese Fragen standen im Zentrum eines Forschungsprojektes von vhw und Kommunikationswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern der Universität Zürich. Zu diesem Zweck wurden lokale Printmedien in Kiel, Saarbrücken und Essen inhaltsanalytisch auf insgesamt neun Kohäsionsdimensionen untersucht. Zentrales Ergebnis der Studie ist, dass sich trotz unterschiedlicher Voraussetzungen in den Städten das medial erzeugte Bild sozialer Kohäsion kaum unterscheidet, während sich deutliche Unterschiede zwischen lokalen Zeitungen, Anzeigenblättern und dem Lokalteil der Bild-Zeitung aufzeigten. Individuelle Medienrepertoires sind entsprechend zentral für das medial vermittelte Bild gesellschaftlichen Zusammenhalts für die Bürgerinnen und Bürger.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2023 Urbane Daten in der Praxis
Die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung in den Bereichen Stadt-, Verkehrs- und Klimaanpassungsplanung stellen Städte vor große Herausforderungen. Um Antworten auf die damit verbundenen Fragestellungen finden zu können, rücken urbane Daten zunehmend in den Fokus. Für den Begriff der „Smart City“ wurden schon mehrere Konzeptionsversuche unternommen. Die Frage, was eine Stadt zur smarten Stadt macht und wie smart dabei Bürger und Planung sein können und müssen, bleibt bei den aktuell vor allem durch Effizienzgedanken und kommerziellen Interessen geprägten Trends meist unbeleuchtet, so dass diese konzeptionellen Ansätze eher den Marketingabteilungen von Großkonzernen der Informations- und Kommunikationstechnologien entspringen. Eine abschließende und allgemeingültige Erläuterung, was eine Smart City ist, welche Kriterien diese erfüllen muss oder soll, gibt es bis heute noch nicht, und so bleibt Raum zur Entwicklung individueller und maßgeschneiderter Lösungsansätze, die den konkreten Anforderungen der jeweiligen Städte entsprechen.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2006 Partizipation in der Stadtentwicklung; Trendforschung
Aufgabe der Sozialen Stadterneuerung ist es, den als benachteiligt beurteilten Stadtteil zu einem Lebensraum mit einer positiven Zukunftsperspektive werden zu lassen. Bürgerinnen und Bürger sollen wesentlich zur Entwicklung dieser Zukunftsperspektive beitragen, wenn nicht sogar zu zentralen Akteuren in der Stadtteilentwicklung werden. Daraus folgen nicht selten hohe Anforderungen an die Stadtteilbewohner. Der Stadtteiltreff Drispenstedt in Hildesheim wurde aufgebaut, um Bürgerinnen und Bürgern Kommunikations-, Identifikations- und Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten. Zentrale – von den Stadtteilbewohnern gut angenommene Angebote – sind Mittagstische, Sonntagsbrunch und Sonderveranstaltungen wie interkulturelle Abende. Das Essen wird von einer Beschäftigungsinitiative serviert; dabei werden Servicekräfte mit dem Ziel ausgebildet, ihre Beschäftigungsfähigkeit wiederherzustellen. Zur Koordination und Ergänzung dieser Arbeiten stehen dem Stadtteiltreff zahlreiche ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger und eine Personalstelle zur Verfügung. Der Beitrag stellt sich den Fragen, unter welchen Bedingungen der Aufbau bürgerschaftlichen Engagements entwickelt und gefördert werden kann und welche Konzepte einer kooperativen Quartiersentwicklung daraus abzuleiten sind.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2019 Digitale Verwaltung
Der vhw als unabhängiger, transformativer Wissenschaftsakteur engagiert sich durch Fortbildung und Forschung in den Handlungsfeldern Wohnen und Stadtentwicklung. Als Partner für politische Entscheider, die öffentliche Verwaltung in Bund, Länder und Kommunen, für intermediäre Akteure sowie die Wohnungswirtschaft verfügt er über ein weitreichendes Netzwerk. Dennoch zeigt sich bei genauerem Hinsehen: Mit jungen Akteuren der Stadtentwicklung hat der vhw bislang erst wenig Berührungspunkte. Dies soll sich nun ändern. Mit dem Jungen Forum hat der vhw ein neues Format ins Leben gerufen, um eine Schnittstelle zwischen vhw-Forschung und junger Wissenschaft herzustellen. Im November des letzten Jahres hat die erste Veranstaltung stattgefunden.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2019 Digitale Verwaltung
Die Schweizer Stadt Zug bietet seit November 2017 als weltweit erste Gemeinde allen Einwohnern die Möglichkeit, eine digitale Identität zu erhalten. Basierend auf einer Public Blockchain ermöglicht sie einen schnellen und sicheren Zugriff auf alle Dienstleistungen, die eine moderne Stadt ihren Bürgern heute bietet: von Abstimmungen über Gebührenabwicklungen und Parkplatzmanagement bis hin zur Teilnahme am kulturellen Angebot der Stadt. Forum Wohnen und Stadtentwicklung (FWS) sprach mit Marco Berg, Geschäftsführer Deutschland bei ti&m, über digitale Identitäten von Kommunen.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2019 Child in the City
Der für Kinder gebaute und gestaltete Raum hat nachhaltig einen positiven Einfluss auf den frühkindlichen Entwicklungsprozess. Es gibt in der Pädagogik unterschiedliche Konzepte, welche unterschiedliche Raumkonzepte benötigen. Heute orientieren sich viele Pädagoginnen und Pädagogen an reformpädagogischen Ansätzen wie Montessori- oder Reggio-Pädagogik bzw. an modernen pädagogischen Konzepten wie der offenen Arbeit, des situationsorientierten Ansatzes oder des Situationsansatzes, deren Pädagogik sich nicht mehr an einem übergeordneten Menschen- oder Weltbild orientiert, sondern die Vermittlung von Alltags- und Lebenskompetenzen angestrebt wird.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2021 Verkehrswende: Chancen und Hemmnisse
Eine Mobilitäts- und Verkehrswende wird vermehrt in fachpolitischen Programmen postuliert – zumeist ohne Begriffsklärungen, aber überwiegend mit positiven Konnotationen als nachhaltige Mobilitäts- und Verkehrsentwicklung. Derzeit dominieren in diesem Zusammenhang vor allem Ziele des Klimaschutzes und der Reduktion von CO2-Emissionen – allerdings weitgehend ohne die erforderlichen gesamthaften Wirkungsanalysen und Wirkungsabwägungen. So unterbleiben zumeist Gesamtbilanzierungen der Herstellungs-, Betriebs- und Verwertungsprozesse der Elektromotoren und Batterien. Es fehlen Betrachtungen von Gewinnung, Transport und Verwertung von Rohstoffen (z. B. Lithium aus Chile, Bolivien und Peru) oder der Nutzung von Wasserressourcen. Dies gilt auch für die Bereitstellung von öffentlichen ("Schnell-")Ladestationen und deren Einbindung in Mittelspannungsnetze der Städte. Auch der Ausbau regenerativer Energieerzeugung aus Windkraft und Sonnenenergie sowie der Energieumwandlung, -speicherung und -verteilung (Fernnetze, Vernetzung, dezentrale Netze und Speicher) muss zwingend in die Betrachtung aufgenommen werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2021 Verkehrswende: Chancen und Hemmnisse
Mit seinen 1.101 Gemeinden und rund 11 Mio. Einwohnern ist Baden-Württemberg, gemessen an der Einwohnerzahl, das drittgrößte Bundesland in Deutschland und hat es sich zum Ziel gesetzt, Wegbereiter einer modernen und nachhaltigen Mobilität der Zukunft zu werden. Zur Erreichung dieses Ziels und zur Erfüllung der Klimaschutzziele werden dabei die vereinten Kräfte von Land und Kommunen benötigt. Das Land hat sich zu einer Verringerung des CO2-Ausstoßes im Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg verpflichtet, und bis 2050 soll eine weitgehende Klimaneutralität erreicht werden. Um die vereinbarten Klimaziele zu erreichen, muss auch der Verkehrssektor zur Verringerung der Emissionen beitragen, denn im Land stammen rund 34 % der Treibhausgase aus dem Verkehrsbereich, überwiegend aus dem Straßenverkehr.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2021 50 Jahre Städtebauförderung
In diesen Tagen wird – einmal mehr – in der deutschen Öffentlichkeit die Schwerfälligkeit und Uneindeutigkeit der Regierungsführung in Deutschland debattiert. Anlässlich der episodischen Videokonferenzen und Beschlüsse des informellen Gremiums aus Bundeskanzlerin und 16 Ministerpräsidenten zur Coronakrise ist die Rede von „Chaos“, „Durcheinanderreden“, einem Mangel an Demokratie, da die Republik „von einem Siebzehner-Direktorium geleitet“ werde, dessen Entscheidungen in einem „Verantwortungsnebel“ nicht mehr zuzuordnen seien und „die Menschen im Land nicht mehr verstehen“. Man fühlt sich erinnert an die massive Kritik, die in der Krise der späten 1990er Jahre bis zu einflussreichen Verfassungsrichtern an den komplexen Prinzipien einer institutionalisierten Zusammenarbeit von Bund und Ländern in den Bereichen der Legislative und der Exekutive geäußert wurden. Schließlich wurden die einst geteilten Kompetenzen in den Föderalismusreformen der 2000er Jahre deutlich entflochten. In den aktuellen Krisen der Bildungs- und Wohnungspolitik wird nun heute gelegentlich wieder beklagt, dass es so mühsam sei, den Bund wieder ins Boot zu holen.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2021 50 Jahre Städtebauförderung
Wer kennt sie nicht, die Wohnlagen an lauten Hauptverkehrsstraßen mit hoher Feinstaubbelastung und wenig Grün vor der Haustür? Wohnen möchte hier kaum einer! In schrumpfenden Städten stehen diese Wohnungen daher häufig leer. In wachsenden Städten dagegen haben auch diese Wohnlagen aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes ihre Nachfrager. Oft sind dies Haushalte, die sich aufgrund ihres geringen Einkommens Wohnstandorte in besseren Lagen nicht leisten können.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2018 Zivilgesellschaft baut Stadt
Die innere Einstellung vieler Kommunalvertreter und Stadtentwickler ist – frei nach Adenauer: „Engagieren tun sich die Leute eh.“ Diese Haltung reicht jedoch nicht mehr (und tat es vielleicht auch nie) aus, da nachhaltig sich engagierende Bürger nicht einfach vom Himmel fallen. Das Heran- und Ausbilden einer demokratischen Stadtgesellschaft braucht eine strategische und professionelle öffentliche Personalentwicklung (ÖPE). Insbesondere sogenannte Intermediäre sind für das Bilden von ausreichend Sozialkapital für solch eine Bürgergesellschaft entscheidend (vgl. Putnam 1993).
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2020 Quartiersentwicklung und Wohnungswirtschaft
Eine emanzipierte Bürgerschaft betrachtet Stadt- und Quartiersentwicklung nicht ausschließlich als planerische Aufgabe, sondern als offenen Prozess der Aushandlung. Besondere Aufmerksamkeit kam zuletzt gemeinwohlorientierten Initiativen zu, deren Engagement durch immobilienwirtschaftliche Projekte sichtbar und raumwirksam wird. In den vergangenen Jahren haben zahlreiche solcher selbstverwalteten Initiativen begonnen, sich für das Zusammenleben in ihrer Stadt und in ihren Quartieren zu engagieren. Sie übernehmen, erhalten, sanieren und betreiben Orte der sozialen und kulturellen Infrastruktur, der Bildung und Begegnung, des Wohnens und der lokalen Ökonomie. Diese Initiativen werden durch die Immobilienbewirtschaftung sowie ihre Funktion als Plattform und Kristallisationsobjekt für weiteres Engagement zu Akteuren der Quartiersentwicklung.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2019 Vertrauen in der Stadtgesellschaft
Europa, Deutschland und unsere Demokratie befinden sich in der Krise – so liest es sich überall. Der gesellschaftliche Diskurs ist geprägt von Schlagzeilen über das politische Versagen repräsentativer Institutionen und Einzelpersonen. Der Politikwissenschaftler Wolfang Merkel resümiert jedoch, dass insbesondere in Bezug auf Wahlen, politische Rechte und Teilnahmechancen „in keinem ihrer Aspekte dramatische Verschlechterungen der demokratischen Qualität in den letzten drei Jahrzehnten offenbart [würden], die die Thesen der Postdemokratie, Fassadendemokratie oder einer akuten Krise der Demokratie rechtfertigen“. (Merkel 2015, S. 483) Er spricht vielmehr von einer Erosion der Demokratie, die sich besonders in Form politischer Exklusion einzelner gesellschaftlicher Schichten äußert.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2019 Vertrauen in der Stadtgesellschaft
Demokratische Gesellschaften und ihre Institutionen sind auf das Vertrauen der Bevölkerung angewiesen. Parlamente und Regierungen werden durch Wahlen legitimiert. Wählerinnen und Wähler erwarten von den Gewählten, dass sie sich im Sinne des Gemeinwohls engagieren, dabei aber auch die Interessen ihrer Wähler nicht vernachlässigen. Sie schenken ihnen das Vertrauen. Gleichzeitig besteht in repräsentativen Demokratien immer die Gefahr, dass politische Vertreter die Anliegen von Bürgern zu wenig beachten, nicht aufnehmen oder die von ihnen getroffenen Entscheide zu wenig erklären. Bürger wie Politiker sind dabei auf die Vermittlungsleistungen vor allem der Medien angewiesen. Durch Vermittlungsdefizite der Medien kann Misstrauen gegenüber der Politik entstehen.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2019 Vertrauen in der Stadtgesellschaft
Misstrauen hat einen schlechten Ruf. Angeblich befördert es Populismus und die Erosion des Faktischen: In jeder Krise heißt es deshalb sofort, man müsse wieder Vertrauen entwickeln. Misstrauen hat jedoch auch ein kreatives und regulatives Potenzial. Kann sich dieses Potenzial nicht entfalten, verschärft sich Misstrauen und entwickelt sich zu einer Gefahr für Gesellschaft und Staat. Anstatt also in den gegenwärtigen Vertrauenskrisen reflexartig immer sofort Vertrauen in die Institutionen einzufordern, sollte das weltweit wachsende Misstrauen endlich ernstgenommen werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2020 Stadtmachen
Die "selbst gemachte Stadt" hat Konjunktur – und mit ihr die "Stadtmacher". Man redet viel von ihnen. Aber was eigentlich ist gemeint? Selbsterklärend ist der Begriff nur auf den ersten Blick. Betrachtet man ihn etwas länger, entstehen viele Fragen. 15 davon werden hier gestellt. Der französische Philosoph René Descartes hat schon im 17. Jahrhundert den "methodischen Zweifel" zum Ausgangspunkt jedes Erkenntnisfortschritts ausgerufen. Dieses Zweifeln richtet sich nicht an Wirklichkeiten, sondern z.B. an die Bilder und Begriffe, die man sich von ihnen macht. Es ist daher auch nicht "destruktiv" zu verstehen, sondern kann zum Beispiel der Identifikation des begrifflichen Kerns einer noch unscharfen Bezeichnung dienen. Genau das ist Zweck der folgenden Fragezeichen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht
Vor 100 Jahren trat das deutsche Erbbaurechtsgesetz in Kraft. Ziel war es, preisgünstiges Wohnen für breite Bevölkerungsschichten zu ermöglichen. Angesichts der aktuellen Herausforderung, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und auch perspektivisch zu sichern, erfährt das Erbbaurecht eine politische Renaissance. Erbbau-Prinzip ist eine Trennung der Eigentumsverhältnisse von Boden und Gebäude für eine festgelegte Zeitdauer. Der Erbbaurechtsnehmer nutzt das Grundstück des Erbbaurechtsgebers, um zumeist ein Gebäude darauf zu errichten. Dafür zahlt er Erbbauzinsen an den Grundstückseigentümer. Der Inhalt des Erbbaurechts wird in einem Erbbaurechtsvertrag zwischen den Vertragspartnern festgelegt. Dabei können Erbbaurechtsverträge individuell gestaltet werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2019 Stadtentwicklung und Klimawandel
Der prognostizierte Klimawandel wird sich insbesondere in den Städten aufgrund der großflächigen Versiegelung und der damit zusammenhängenden Hochwasser- und Hitzeproblematik gravierend auswirken. In vielen Kommunen ist man bereits mit kommunalen Anpassungsstrategien und -programmen darangegangen, sich diesen Zukunftsaufgaben zu stellen. Allerdings ist der Wissensstand zum Thema Klimaanpassung auf der kommunalen Ebene oft noch unzureichend. Der vhw hat sein Fortbildungsangebot deswegen in diesem Feld ausgeweitet. Im folgenden Artikel sollen die Erfordernisse und Möglichkeiten zur Klimaanpassung skizziert und anhand von zwei Fallbeispielen die entsprechenden Strategien und Programme aus Berlin und Regensburg vorgestellt werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2019 Stadtentwicklung und Klimawandel
Kommunen haben es in der Hand, ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Über das planerische Instrument der Bauleitplanung können sie klimaschutzbezogene Festsetzungen treffen und dadurch die Stadtentwicklung zugunsten des Klimaschutzes verändern. Dabei stehen ihnen nicht nur Bauleitpläne, sondern auch andere Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung, welche aber auch verschiedene rechtliche Hürden aufweisen. Die verschiedenen Klimaschutzdarstellungen und ihre rechtlichen Rahmenbedingungen sind Gegenstand des nachfolgenden Artikels.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2019 Stadtentwicklung und Sport
Karlsruhe als wachsende Stadt verzeichnet aktuell vor allem einen Zuzug von Familien mit Kindern. Die sich auch aufgrund fehlender Neubautätigkeit seit 2000 stetig anspannende Lage am Wohnungsmarkt geht einher mit zunehmenden Bedarfen an Kinderbetreuung, aber auch Sportangeboten für Kinder und Jugendliche in den Sportvereinen. Über 200 Sportvereine, wovon über 100 eigene Vereinsanlagen besitzen, mit 90.000 Mitgliedern bilden eines der Fundamente der "Sozialen Stadt" Karlsruhe, die sich als "Sportstadt" versteht. Eine Grundlage für die Stadtentwicklung Karlsruhes stellt neben der Sozial- und der Sportentwicklungsplanung das "Integrierte Stadtentwicklungskonzept Karlsruhe 2020" dar.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2010 Stadtentwicklung und demografischer Wandel
Menschenleere Landstriche, überalterte Städte, Überforderung der jungen Generation, die die Finanzlast der Alten nicht mehr tragen kann – dies sind Bilder, die immer wieder mit dem demografischen Wandel in Verbindung gebracht werden. In der öffentlichen Diskussion wird die Alterung der Gesellschaft oft als Belastung vor allem für die sozialen Sicherungssysteme gesehen, aber immer mehr werden auch die positiven Seiten des Alter(n)s diskutiert und die Potenziale. In den Diskussionen über den demografischen Wandel wird meist außer Acht gelassen, dass es den demografischen Wandel nicht gibt. Eine Vielzahl unterschiedlicher Entwicklungen stehen hinter diesem Begriff, die eine differenzierte Betrachtung verlangen.
Beiträge