
Erschienen in Heft 6/2020 Klimaanpassung im Stadtquartier

Erschienen in Heft 4/2020 Kommunales Handeln im europäischen Kontext
Bei den Verbrauchern will der Funke nicht überspringen: Sie kaufen lieber Autos mit Verbrennungsmotoren als E-Autos. Und dass, obwohl die öffentliche Hand mit vielen Fördermitteln Elektrofans unter die Arme greift. Größtes Kaufhindernis sind die fehlenden Ladestationen. Zwar fließen auch hier Fördergelder, aber gerade in Großstädten fehlt im öffentlichen Raum der Platz. Ein Nachrüsten von Tiefgaragen ist für Vermieter und Eigentümer sehr teuer; einige rechtliche Fragen sind ungeklärt. Schafft ein Masterplan für mehr Ladestationen Abhilfe?
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2023 Bildung in der Stadtentwicklung
Kinder bringen in die Schule ihre Erfahrungen und Lebensumstände mit, Ganztagsschulen sind Lebensorte für Kinder und Teil ihres Sozialraums. In ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten für Kinder im Grundschulalter arbeiten Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte, sie bringen ihre jeweilige pädagogische Professionalität ein. Im folgenden Artikel wird Sozialraumorientierung als Fachkonzept der Sozialen Arbeit vorgestellt. Es werden die Herausforderungen und Chancen dargestellt, die darin liegen, Sozialraumorientierung zur Grundlage sozialpädagogischen Handelns im Ganztag zu nehmen. Sozialraumorientierung ermöglicht pädagogischen Fachkräften, ihre Haltung und Methoden zu kommunizieren, Ressourcen zu erschließen und Kinder darin zu unterstützen, ihren Lebensort Ganztag zu gestalten.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2014 Infrastruktur und soziale Kohäsion
„Das ist der Untergang“ – unter diesem Titel malt die Süddeutsche Zeitung (13. Nov. 2014) ein tristes Bild der öffentlichen Bäder in Bayern. Ein Drittel der Bäder ist in diesem vergleichsweise wohlhabenden Bundesland sanierungsbedürftig und viele Kommunen prüfen die Schließung ihrer Frei- und Hallenbäder. Eine Folge der Schließungen ist schon heute zu spüren. Nach einer Untersuchung der DLRG kann bereits ein Drittel der Kinder bis zehn Jahren nicht schwimmen. Es ist schon seltsam: Einerseits wird das Leben immer mehr auf Sicherheit getrimmt, dass Kinder nicht mehr klettern dürfen, aber andererseits nicht mehr schwimmen lernen. Die neuen Thermenpaläste und Massagedüsen-Oasen sind dabei kein Ersatz für die Schwimmbäder. Dort wird nicht geschwommen, sondern geplanscht.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2023 Urbane Daten in der Praxis
Unbemannte Luftfahrzeuge – umgangssprachlich auch „Drohnen“ genannt – halten immer stärker Einzug in Forschung, Industrie und das tägliche Leben. Sie bieten oft vollkommen neue Möglichkeiten, Fernerkundungsdaten in sehr hoher Qualität zeitlich und räumlich flexibel zu erheben. Die am Markt verfügbaren Systeme werden immer leistungsfähiger, benutzerfreundlicher und kostengünstiger, so dass in der Folge drohnengestützte Technologien, Anwendungen und Analysen häufiger nachgefragt und in der Praxis angewandt werden. So sind Drohnen beim Planen, Bauen und Betreiben von Immobilien längst keine Ausnahme mehr. Vielmehr gewinnt ihre Technologie bei der Digitalisierung im gesamten Gebäudelebenszyklus mehr und mehr an Bedeutung.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2012 Integration und Partizipation
Vorgestellt wird eine explorative Milieu-Studie über Spätaussiedler und türkeistämmige Deutsche. Gemessen an objektiven Dimensionen sozialer Positionierung (Bildung, Beruf, Einkommen usw.) und an milieuspezifischen Mustern ihrer Verhaltensstrategien zeigt sich, dass die beiden größten Gruppen mit "Migrationshintergrund" sich den sozialen Differenzierungen der autochthonen Gesellschaft längst angeschlossen haben. Dazu gehört ein durchschnittliches bürgerschaftliches Engagement. Weder ethnisierende noch kulturalisierende Selbst- und Fremdwahrnehmungen, sondern Migrationszeitpunkte, Aufenthaltsdauer, Ortseffekte am Wohnort sowie Bildungs- und Berufserfahrungen erweisen sich als die zentralen Dimensionen sozialer Etablierung und gesellschaftlicher Teilhabe.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2012 BürgerMachtStadt – Kommunen als Rettungsanker der Demokratie?

Erschienen in Heft 4/2010 Bürgerorientierung in der integrierten Stadtentwicklung
"Die Verfassung, die wir haben [...] heißt Demokratie, weil der Staat nicht auf wenige Bürger, sondern auf die Mehrheit ausgerichtet ist." So definierte der griechische Staatsmann Perikles (ca. 490 - 429 v. Chr.) die Demokratie. Heute hat sich die Demokratie spätestens seit dem Ende des Ost-West-Konfliktes als erfolgreichste Staatsform etabliert. Dennoch ist sie derzeit mit globalen und demografischen Herausforderungen konfrontiert, die sich sowohl als Gefährdungen wie auch als Chancen auswirken können. Die Prozesse der Globalisierung, neue globale Herausforderungen und die europäische Einigung führen zu einer Verlagerung der politischen Entscheidungskraft auf höhere Ebenen, was wiederum zu Bürgerferne und Legitimitätsverlust führen kann.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2009 Anerkennungskultur im bürgerschaftlichen Engagement
"Sie sind Gold wert." – Unter diesem Motto haben die kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung 2007 die niedersächsische Ehrenamtskarte ins Leben gerufen. Eckpfeiler des gemeinsam entwickelten Konzeptes sind die landesweite Gültigkeit der Karte, ein einheitliches Design und transparente Ausgabemodalitäten.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2009 Nachhaltigkeit im Wohnungs- und Städtebau
Umgerechnet 116,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) gehen nach Angaben des Umweltbundesamts auf das Konto der deutschen Privathaushalte. Das sind ca. 16 Prozent der gesamten CO2-Emissionen, die in Deutschland emittiert werden. Experten zufolge könnte mit entsprechenden Maßnahmen bereits 2010 der umgerechnete CO2-Ausstoß der rund 40 Millionen Haushalte bei 114,5 Millionen Tonnen liegen und bis 2030 – je nach politischer Steuerung – auf 87 bis 36,5 Millionen Tonnen CO2 sinken. Aber auch Verbraucher können einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten, indem sie durch eine größere Nachfrage nach nachhaltigen Produkten ein klares Signal an Hersteller, Handel und Politik senden, dass sie schon längst zu mehr Klimaschutz bereit sind.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2009 Nachhaltigkeit im Wohnungs- und Städtebau
Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB) wurde im Juni 2007 von Organisationen aus der gesamten Bau- und Immobilienwirtschaft gegründet, um nachhaltiges Bauen zu fördern. Ziel war und ist es, das Deutsche Gütesiegel Nachhaltiges Bauen zu etablieren, das umweltschonende, wirtschaftlich effiziente und nutzerfreundliche Gebäude auszeichnet. Die Entwicklung der DGNB und der Zertifizierungssysteme verläuft rasant. Die Zertifizierungssysteme der DGNB werden mittlerweile durch über 320 ehrenamtlich tätige DGNB-Mitglieder, darunter Architekten, Investoren, Projektentwickler, Wissenschaftler, Bauunternehmer und viele andere Experten ehrenamtlich entwickelt. Sie formen mit ihrem breiten Know-how die inhaltliche Basis der Zertifizierungssysteme.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2025 Infrastrukturen in ländlichen Räumen
Sauberes Trinkwasser rund um die Uhr und eine leistungsfähige Abwasserbehandlung sind essenzielle Bestandteile unserer Lebensgrundlage und ein wichtiger Standortfaktor für Kommunen und das gesamte Land. Ohne die öffentliche Wasserwirtschaft gäbe es – sowohl im ländlichen als auch im urbanen Raum – keine Wohngebiete, keine Gewerbegebiete, kein Wachstum, keinen Wohlstand. Der ländliche Raum versorgt die Ballungsgebiete mit Nahrung und Wasser, weshalb es essenziell ist, ihn funktionsfähig zu halten. Die Wasserversorgungsunternehmen stehen dabei vor zentralen Herausforderungen: Mengenmanagement, Wasserqualität und Infrastrukturerhalt sind strategische Kernaufgaben, die angesichts des Klimawandels und der Energiewende immer wichtiger werden. Gleichzeitig erfordert die Sicherung der wasserwirtschaftlichen Daseinsvorsorge erhebliche Anstrengungen – verschärft durch Fachkräftemangel und wachsende bürokratische Anforderungen.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2025 Infrastrukturen in ländlichen Räumen
Seit rund 15 Jahren wird in Deutschland zunehmend intensiv über die Sicherung der ambulanten Gesundheitsversorgung diskutiert. Während die Debatte in besonders ländlichen und peripheren Regionen begann, hat sie längst auch Eingang in urbane Räume und Beachtung in der breiten Gesellschaft gefunden. Denn das Thema Gesundheitsversorgung ist ein besonders sensibles. Wenngleich die Sicherung der ambulanten (vertragsärztlichen) Versorgung im Wesentlichen den Kassenärztlichen Vereinigungen obliegt, wächst in vielen Kommunen der Druck, das Thema auf die Agenda zu setzen. Denn die Kommunen werden von ihren Bürgerinnen und Bürgern nicht nur als erste Ansprechpartnerin, sondern auch in einer grundsätzlichen Zuständigkeit für die Fragen der lokalen Daseinsvorsorge und Lebensqualität wahrgenommen. Vor diesem Hintergrund werden sie mit den vor Ort spürbaren Problemen, wie Praxisschließungen, langen Wartezeiten und größer werdenden Distanzen für den Arztbesuch, konfrontiert. Diese Probleme sind das Ergebnis einiger seit Jahren oder gar Jahrzehnten zu beobachtenden Entwicklungen.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2025 Korruptionsprävention in Kommunen
Die brandenburgische Gemeinde Birkenwerder liegt metropolennah nur etwa 8 Kilometer nördlich von Berlin. Sie hat etwa 8.200 Einwohnerinnen und Einwohner und verfügt über rund 150 Beschäftigte in der Gemeindeverwaltung. Der Ort weist eine gut ausgebaute Infrastruktur mit einer engen Anbindung an Berlin und einen hohen Naherholungswert durch seine Lage im grünen Briesetal auf. Die Kommune ist ein typisches Beispiel für eine kleinstädtisch geprägte Gemeinde im Berliner Umland. Schlagzeilen machte die Gemeinde 2014, als gegen den damaligen Bürgermeister wegen Korruptionsvorwürfen ermittelt, er vom Amt suspendiert und schließlich Ende 2014 als Bürgermeister abgewählt wurde. Seit 2023 ist die Gemeinde Birkenwerder nach einem umfangreichen Aufnahmeverfahren korporatives Mitglied im Kreis kommunaler Mitglieder von Transparency International Deutschland e. V. Mit Bürgermeister Stephan Zimniok sprach Anna-Katharina Zubrod von Transparency International Deutschland.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2023 Im Osten viel Neues: genutzte Potenziale, engagierte Akteure, erfolgreiche Stadtentwicklung

Erschienen in Heft 1/2024 Zukunft der Innenstädte in Deutschland
Es läuft schleppend mit dem Wohnungsbau, denn die prognostizierte Zahl an Fertigstellungen wurde im vergangenen Jahr nicht erreicht. Anstatt 400.000 Einheiten wurden 295.300 errichtet, und in diesem Jahr könnten es noch weniger sein. Die Gründe sind hinlänglich bekannt, aber es gäbe Ansatzpunkte, die Fertigstellungszahlen mittelfristig zu steigern. Bauvorschriften könnten vereinfacht und für alle Bundesländer vereinheitlicht werden. BIM und serielles Bauen tragen ebenfalls zu einer Beschleunigung am Bau bei. Manchmal lohnt auch ein Blick in Nachbarländer, wie die Niederlande. Was darüber hinaus zu tun ist.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2024 Zukunft der Innenstädte in Deutschland
Viele Kommunen sind dem kommunalen Erbbaurecht freundlich gesinnt. Die Gründe hierfür sind einerseits städtebaulicher Art – kann doch der gesamte Nutzungszyklus der Immobilie (inkl. Zwischen- und Nachnutzungen) kontrolliert werden. Zudem ist es seit dem Urteil des BGH vom 08.02.2019 (BGH 2019) klar, dass – im Gegensatz zu Volleigentum – dem Investor Sozialbindungen über die gesamte Laufzeit des Erbbaurechts auferlegt werden können. Insoweit erscheint die Entscheidung Verkauf eines kommunalen Grundstücks vs. Vergabe über Erbbaurecht fast vorgezeichnet. Indessen erklingen im Chor des Lobliedes auf das kommunale Erbbaurecht nicht selten deutliche Misstöne aus der Kämmerei, zumal die Veräußerungserlöse fehlen, mit denen z. B. Altschulden abgetragen werden könnten. Außerdem können keine Veräußerungsgewinne erzielt werden, mit denen das Eigenkapital gestärkt werden könnte. Gegen die Inferiorität des Erbbaurechts aus Sicht der Kommunalfinanzen gibt es allerdings ein interessantes Argument, das nachfolgend ein wenig intensiver unter die Lupe genommen werden soll.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2024 Zukunft der Innenstädte in Deutschland
Gegründet wurde UpVisit im Mai 2022 von Katharina Aguilar (CEO), Alicia Sophia Hinon (COO) und Baver Acu (CTO). Seit März 2023 sind die Plattform UpVisit und die dazugehörigen iOS- und Android-Apps live. UpVisit steht unter dem Motto: die ultimative Verflechtung von analoger und digitaler Welt. Der Beitrag wurde uns zur Verfügung gestellt von UpVisit.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2019 Vertrauen in der Stadtgesellschaft
Kommunale Akteure haben großen Einfluss auf die Lebensqualität der dort wohnenden Menschen. So hängt etwa die Qualität von Wohnraum-, Bildungs-, Freizeit- oder Mobilitätsangeboten unter anderem auch von kommunalpolitischen Entscheidungen ab. Die Angebotsakzeptanz der Menschen hängt wiederum maßgeblich von der Art und Qualität der vorhandenen Angebote sowie den Bedürfnissen der Menschen vor Ort ab. Damit das Angebot zu den Bedürfnissen passt, sollten Bürgerbeteiligungsmethoden genutzt werden, die dann auch vertrauens- und imagebildend wirken. Im Auftrag der Bertelsmann Stiftung hat das Bielefelder Sozialforschungsinstitut SOKO im März 2019 eine repräsentative Bevölkerungsstichprobe zu ausgewählten Aspekten der Kommunalpolitik interviewt.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2019 Vertrauen in der Stadtgesellschaft
Demokratische Gesellschaften und ihre Institutionen sind auf das Vertrauen der Bevölkerung angewiesen. Parlamente und Regierungen werden durch Wahlen legitimiert. Wählerinnen und Wähler erwarten von den Gewählten, dass sie sich im Sinne des Gemeinwohls engagieren, dabei aber auch die Interessen ihrer Wähler nicht vernachlässigen. Sie schenken ihnen das Vertrauen. Gleichzeitig besteht in repräsentativen Demokratien immer die Gefahr, dass politische Vertreter die Anliegen von Bürgern zu wenig beachten, nicht aufnehmen oder die von ihnen getroffenen Entscheide zu wenig erklären. Bürger wie Politiker sind dabei auf die Vermittlungsleistungen vor allem der Medien angewiesen. Durch Vermittlungsdefizite der Medien kann Misstrauen gegenüber der Politik entstehen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2021 Stadtentwicklung und Vergaberecht
Mit dem Klimaschutzgesetz (KSG) wird das Ziel der Treibhausgasminderung als weiterer Aspekt der Beschaffung berücksichtigt. Durch das Inkrafttreten des KSG haben die Themen Klimaneutralität und CO2-neutrale Beschaffung in der öffentlichen Beschaffung stark an Bedeutung gewonnen. Auch in der neuen Auflage des Ressourceneffizienzprogramms (ProgRess III) wird betont, dass Klimaschutz und Ressourcenschutz Hand in Hand gehen und demnach besonders klimarelevante Produkte und Dienstleistungen in den Fokus rücken. Unterstützung dabei leistet die Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung (KNB).
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2021 Stadtentwicklung und Vergaberecht
Für ein erfolgreiches Gelingen der Verkehrswende in Deutschland unter Umwelt- und Klimaschutzgesichtspunkten spielt die öffentliche Hand eine zentrale Rolle. In verschiedenen Bereichen, wie dem öffentlichen Personennahverkehr oder der Abfallbeseitigung, kommen derzeit noch weit überwiegend schwere Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren zum Einsatz. Dies hat auch Auswirkungen im städtebaulichen Kontext und auf die Lebensqualität der Bewohner von Kommunen. Um einen Impuls für mehr Nachhaltigkeit zu setzen, wurde das Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge (SaubFahrzeugBeschG) erlassen und ein neuer Vergaberechtsrahmen für die Beschaffung von (emissionsfreien) sauberen Straßen- und Nutzfahrzeugen geschaffen. Ab dem 2. August 2021 müssen öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber bei der Umsetzung von Beschaffungsvorhaben die neuen Regelungen beachten.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2021 Stadtentwicklung und Vergaberecht
In Deutschland besteht ein großer Nachholbedarf beim Ausbau der öffentlichen Infrastruktur. Nach einer aktuellen Studie der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beläuft sich der Investitionsrückstand allein bei den deutschen Kommunen auf 149 Mrd. Euro. Er ist damit gegenüber dem Vorjahr (147 Mrd. Euro) gewachsen. Nicht nur bei der Sanierung der Verkehrsinfrastruktur, also maroder Straßen, Wege und Brücken, sondern auch beim Ausbau von Kitas, Schulen, Sportstätten und Bädern sowie bei Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Digitalisierung sind massive Investitionen nötig. Gerade infolge der Coronapandemie sind Kommunen dringend nötige Investitionen oft nur mithilfe von Zuwendungen von Bund, Ländern oder der EU möglich. Zuwendungs- und Vergaberecht sind aber grundsätzlich getrennte Rechtsgebiete.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2021 Stadtentwicklung und Vergaberecht
Für viele Entwickler war es lange eine sichere Bank, Eigentumswohnungen zu bauen. Das hat sich teilweise geändert. Warum der Mietwohnungsbau aktuell seine Vorzüge ausspielt und das nur bedingt mit Corona zu tun hat und wie man beide Formen in einem Quartier verknüpfen kann, lesen Sie im vorliegenden Beitrag.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2019 Child in the City
Zu seiner 13. Bundesrichtertagung zum Städtebaurecht konnte der vhw am 26. November 2018 im großen Saal des Kardinal-Schulte-Hauses neben den vier Bundesrichtern wieder 160 Gäste willkommen heißen. Sie waren von nah und fern angereist, um sich in bewährter Weise aus erster Hand über die neuen höchstrichterlichen Entscheidungen zum Städtebaurecht zu unterrichten und diese mit den vier anwesenden Bundesrichtern des 4. Senats des Bundesverwaltungsgerichts zu diskutieren. Den Teilnehmern wurden eine vielseitige Auswahl einschlägiger Leitentscheidungen zum Städtebau-, Planungs- und Umweltrecht vorgestellt und Wege für eine rechtssichere Anwendung dieser immer komplexer werdenden Rechtsgebiete aufgezeigt. Fragen aus dem Kreis der Teilnehmer waren ausdrücklich erwünscht, und die Gäste haben die Gelegenheit hierzu gerne genutzt.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2019 Child in the City
In den letzten Monaten ist in verschiedenen Bundesländern eine lebhafte Diskussion über eine Abschaffung des Straßenbaubeitrags entstanden. In NRW hat die SPD-Fraktion einen Gesetzentwurf dazu in den Landtag eingebracht, in Sachsen-Anhalt hat sie einen entsprechenden Antrag angekündigt; Die Fraktion Die Linke will mit einem Gesetzentwurf die Diskussion im Landtag in Magdeburg anschieben. In Brandenburg hat die Vereinigung BVB/Freie Wähler eine Volksinitiative gestartet. In Thüringen sollen sich die Regierungsfraktionen auf eine Abschaffung schon mit Wirkung zum 1. Januar 2019 geeinigt haben. Auch in Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz sollen die Straßenbaubeiträge vor dem Aus stehen. In Bayern sind sie noch kurz vor der Landtagswahl im Oktober 2018 rückwirkend zum 1. Januar 2018 abgeschafft worden.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2019 Child in the City
Der für Kinder gebaute und gestaltete Raum hat nachhaltig einen positiven Einfluss auf den frühkindlichen Entwicklungsprozess. Es gibt in der Pädagogik unterschiedliche Konzepte, welche unterschiedliche Raumkonzepte benötigen. Heute orientieren sich viele Pädagoginnen und Pädagogen an reformpädagogischen Ansätzen wie Montessori- oder Reggio-Pädagogik bzw. an modernen pädagogischen Konzepten wie der offenen Arbeit, des situationsorientierten Ansatzes oder des Situationsansatzes, deren Pädagogik sich nicht mehr an einem übergeordneten Menschen- oder Weltbild orientiert, sondern die Vermittlung von Alltags- und Lebenskompetenzen angestrebt wird.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2019 Vertrauen in der Stadtgesellschaft

Erschienen in
PPP-Modelle haben Hochkonjunktur. Dieser Eindruck drängt sich jedenfalls auf, wenn man nicht nur die Tagespresse verfolgt, sondern auch die einschlägige Fachpresse beobachtet. Gelegentlich drängt sich gar der Eindruck auf, PPP (Public Private Partnership - also öffentlich-private Partnerschaften)sei das Allheilmittel für kommunale, insbesondere finanzielle Probleme. Auch der Titel dieses Beitrages impliziert, dass sich PPP-Modelle für die Anwender rechnen. Alleine der Umstand, PPP-Modelle auf den Tatbestand des "Sich-rechnens" zu konzentrieren, erscheint jedoch dem Anliegen dieser recht komplizierten Konstruktionen keinesfalls gerecht zu werden. Denn außer finanziellen Aspekten ergeben sich durchaus weitere Aspekte, die allerdings vor dem Hintergrund der kommunalen Finanznot doch eher in den Hintergrund gedrängt zu werden scheinen. Ohne bereits zu stark die Detaildarstellung vorwegzunehmen, sei jedoch auf einen Grundsatz hingewiesen, der sich nach der Erfahrung des Autors recht häufig bewahrheitet hat: Effizienz und Effektivität der Erfüllung kommunaler Aufgaben sind nicht nur und in erster Linie eine Frage der Rechtsform, sondern sehr wohl auch von der Qualifikation und dem Einsatzwillen der handelnden Personen abhängig. Darauf ist auch die gelegentlich getroffene Feststellung zurückzuführen, es ergäben sich bei privaten Modellen "Einsparungen" bis zu 15 Prozent. Dabei drängt sich allerdings die Frage nach dem Bezugspunkt auf.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2021 Digitalisierung als Treiber der Stadtentwicklung

Erschienen in Heft 3/2021 Verkehrswende: Chancen und Hemmnisse
Seit Beginn der Coronaepidemie hat sich die Verkehrsmittelnutzung stark verändert. Öffentliche Verkehrsmittel werden zunehmend gemieden, der Pkw-Verkehr und die Nutzung des Fahrrades haben dagegen zugenommen. Vor diesem Hintergrund wurden in einigen Städten kurzfristig sogenannte "Pop-up-Radwege" installiert, um der stark zugenommenen Nachfrage nach Flächen für den Fahrradverkehr zu entsprechen. Wie diese Maßnahmen in Berlin umgesetzt wurden und werden, erfuhr Dr. Frank Jost in einem Gespräch mit Olaf Rabe, Leiter Fachbereich Straßen im Straßen- und Grünflächenamt des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2016 Renaissance der kommunalen Wohnungswirtschaft
Wohnungsunternehmen von Städten, Kreisen oder Bundesländern stehen in der jüngsten Zeit auf Wunsch ihrer Gesellschafter vor der Aufgabe, sich vorrangig um die Wohnungsversorgung von besonders am Wohnungsmarkt benachteiligten Haushalten zu kümmern. Mit dem Bindungsauflauf von immer mehr Sozialwohnungen fehlen in vielen Städten preiswerte Mietwohnungen. Die Verkäufe öffentlichen Wohnungsbestands und das fast völlige Ende des sozialen Wohnungsbaus haben eine dramatische Wohnungsmarktlage zur Folge, die durch den aktuellen zusätzlichen Wohnraumbedarf der Geflüchteten nur noch deutlicher geworden ist.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2020 Quartiersentwicklung und Wohnungswirtschaft
Es ist schon zur guten Tradition im Ländle geworden, dass sich die Baurechtler Baden-Württembergs in der zweiten Septemberhälfte aufmachen, um sich bei den vhw-Baurechtstagen zu versammeln und sich dort auszutauschen und gemeinsam um "das Recht zu ringen". Nach Ulm und Stuttgart in den Vorjahren blieb der Veranstalter auch im Jahr 2019 entlang der A 8 und lud zu den – alsbald voll belegten und demnach "ausverkauften" – 9. Baurechtstagen am 18. und 19. September in Karlsruhe ein. Das dortige Akademiehotel ist so etwas wie die "gute Stube" des vhw und bietet die gewohnt guten Tagungsbedingungen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2018 Meinungsbildung vor Ort – Chancen für Stadtentwicklung und lokale Demokratie
"Europa ist in der Krise" ist allerorten zu vernehmen. Vermutlich hat dieser Umstand vhw-Geschäftsführer Rainer Floren dazu bewogen, die 8. Baurechtstage Baden-Württemberg im Stuttgarter Europa-Viertel anzusiedeln. Jedenfalls erreichte den Unterzeichner bereits vier Wochen vor der Tagung der Hinweis aus der Geschäftsstelle, die Tagung sei bis auf den letzten Platz ausgebucht. Europa lebt! Die am Pariser Platz gelegene Sparkassen-Akademie entpuppte sich denn auch schnell als der ideale Tagungsort. Helle, ansprechende Tagungsräume, eine perfekte Saaltechnik und eine optimale kulinarische Versorgung setzten perfekte Rahmenbedingungen für die 8. Baurechtstage.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2008 Engagementpolitik und Stadtentwicklung – Ein neues Handlungsfeld entsteht
Das mir gestellte Thema der "Neuen Verantwortungsteilung" oder – polyglotter – des "New Interplay between the State, Business and Civil Society" möchte ich in drei Schritten behandeln. Zunächst soll ein kurzer Blick auf die aktuelle Diskussion über den Wandel von Staatlichkeit geworfen werden; in einem zweiten Schritt geht es darum, das Leitbild des Gewährleistungsstaates in diesen Kontext der "Wandeldiskussion" zu stellen, um in einem dritten Schritt ganz konkret nach denjenigen Governancestrukturen zu fragen, die eine neue Verantwortungsteilung umsetzen und auch juristisch handhabbar machen.
Beiträge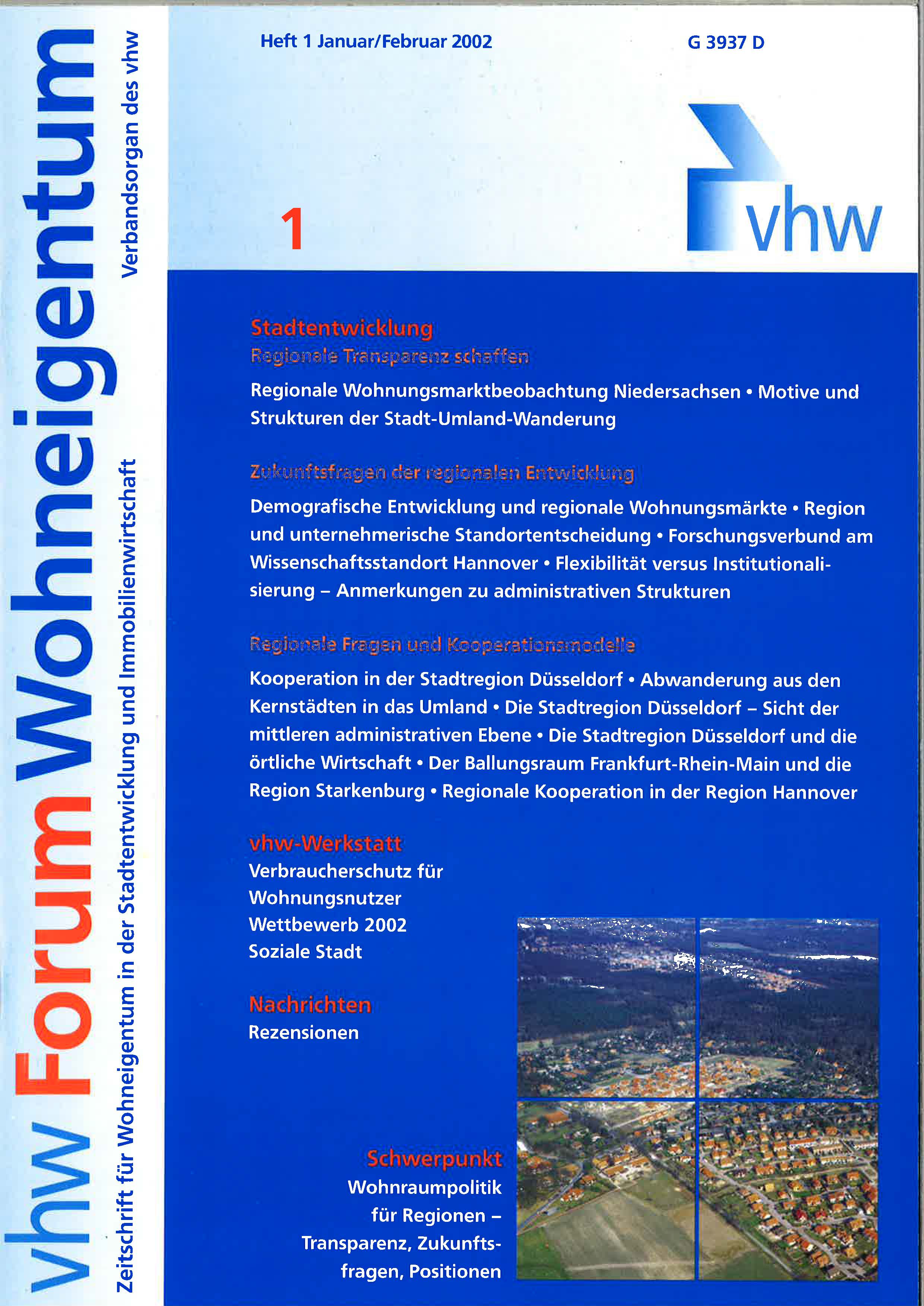

Erschienen in Heft 4/2016 Fluchtort Kommune
Wenige Themen dominieren seit dem Sommer 2015 den öffentlichen Diskurs in Deutschland im Allgemeinen und auch speziell die Diskussion an den Schulen und Hochschulen des Landes wie die Aspekte Flucht und Vertreibung. Gemeinsam ist das Bewusstsein, dass die Integration einer so hohen Zahl an geflüchteten Menschen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellt, bei der auch und insbesondere dem Bildungssektor im Sinne des lebenslangen Lernens eine essenzielle Rolle zukommt. Viele Hochschulen haben schnell auf die Situation reagiert, entsprechende Anlaufstellen geschaffen und Programme und Maßnahmen initiiert (im Überblick z.B. Schamman/Younso 2016).
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2009 Corporate Citizenship in Wohnungswirtschaft und Stadtentwicklung
Noch bis in die 1990er Jahre hinein schien, zumindest in Deutschland, eigentlich alles ganz einfach. Der Staat erließ und vollzog Gesetze, legte die Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Gesellschaft fest und kümmerte sich im Übrigen um den Schutz der Schwachen und die gerechtere Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Die Zivilgesellschaft organisierte und artikulierte sich in Vereinen und karitativen Organisationen, in Bürgerinitiativen und Selbsthilfegruppen, in sozialen Bewegungen und Nichtregierungsorganisationen, mischte sich auf ihre eigene, oft originelle und mitunter auch unbequeme Weise ins öffentliche Leben ein und setzte Themen wie Ökologie und Nachhaltigkeit, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit im globalen Maßstab auf die Tagesordnung.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2017 Sozialorientierung in der Wohnungspolitik
Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) und der vhw haben gemeinsam ein Plädoyer für eine soziale und resiliente Wohnungspolitik vorgelegt, das sich als Anstoß für eine wohnungspolitische Debatte mit Blick auf die Bundestagswahl im Herbst 2017 versteht. Auf der Grundlage dieses Plädoyers haben Difu und vhw zu einer Podiumsdiskussion zum Thema „Wohnungspolitik neu positionieren?“ mit den wohnungs- und baupolitischen Sprechern der Bundestagsfraktionen sowie Anke Brummer-Kohler vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit am 24. Januar 2017 in die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften am Berliner Gendarmenmarkt eingeladen. Wir fassen in diesem Beitrag die Aussagen zum Thema „Neue Gemeinnützigkeit“ als Auszug aus der Diskussionsrunde zusammen.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2011 Städtenetzwerk Lokale Demokratie
Die Gesellschaft in Deutschland wird vielfältiger, älter, gebildeter. Mit dieser Entwicklung geht eine größere Interessenvielfalt und ein höherer Anspruch der Bürger einher, an der politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung auf kommunaler, regionaler und auch bundesweiter Ebene mitwirken zu wollen. Nicht erst seit Stuttgart 21 setzt sich vielerorts die Erkenntnis durch, dass sich diese Interessenvielfalt nicht mehr nach dem klassischen Muster mit einer Unterscheidung zwischen Arm und Reich oder Arbeiter- und Bürgertum abbilden lässt. Gleichzeitig setzt das bestehende Parteien- und Gremiensystem dem Anspruch der Bürger Grenzen, ihre vielfältigen Interessen und Ansprüche einbringen zu können.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2011 Soziale Kohäsion in den Städten

Erschienen in Heft 1/2014 Ländlicher Raum und demografischer Wandel
Der seit über zwei Jahrzehnten eingeleitete Paradigmenwechsel der Förderpolitik für ländliche Regionen hin zu einer akteursorientierten kooperativen Regionalentwicklung wird heute kaum noch bestritten. Ausgehend von Beobachtungen in erfolgreichen Regionen wird dabei angenommen, dass die Existenz spezialisierter und innovativer Netzwerke einen wesentlichen Grund günstiger Entwicklung darstellt. Es wird vermutet, dass in Netzwerken Informations-, Kommunikations- und Vertrauensbildungsprozesse stattfinden, die die Entstehung von regionalen Innovationen fördern. Dies betrifft auch den Umgang mit dem demografischen Wandel. Haben aber diese geförderten Vernetzungsaktivitäten überhaupt messbare Auswirkungen auf die Regionalentwicklung?
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2011 Neue Dialogkultur: Wir sprechen uns im Web 2.0
Menschen vermehrt in die politische Willensbildung einzubeziehen, ist eine der künftigen Herausforderungen, denen sich Politiker vor dem Hintergrund der kontinuierlich sinkenden Wahlbeteiligungen und einem steigenden Desinteresse der Bürger an politischen Themen stellen müssen. Ein oft genannter Aspekt der Politikverdrossenheit sind fehlende oder zu spät bekannt gemachte Informationen. Mit der schnell steigenden Verbreitung von Smartphones wird der Trend verstärkt, das Internet als zentrales Informations- und Kommunikationsmedium zu nutzen. Social-Media-Plattformen ermöglichen es einerseits, die Reichweite erheblich zu erhöhen, aber auch mit Hilfe verschiedener Social-Media-Elemente eine neue Form des Dialogs anzubieten.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2012 Integrierte Stadtentwicklung und Bildung
Der Begriff "Interregionales Lernen" beinhaltet bereits die beiden wesentlichen Grundbestandteile: Regionen, die nicht zwangsläufig aneinander grenzen, lernen voneinander. Nicht nur in der wissenschaftlichen Literatur stoßen diese Lernprozesse zwischen Regionen auf großes Interesse, sie finden vermehrt im praktischen Alltag der Regionalentwickler innerhalb der Europäischen Union statt. Die Themen dieser Lernprozesse können verschieden sein – von der Ausgestaltung regionaler Transportnetzwerke über Wohnungsmarktpolitik bis zu gemeinsamen Herausforderungen des demografischen Wandels. Das durch EU-Strukturfonds geförderte INTERREG IVC Projekt "Know-Man – Knowledge Network Management in Technology Parks" widmet sich regionalen Innovationsstrategien in sechs Regionen.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2013 Stadtentwicklung anderswo
Protestbewegungen wie Stuttgart 21 haben die Diskussion um eine Weiterentwicklung der repräsentativen Demokratie in Deutschland beflügelt. Dabei kann der Blick über Ländergrenzen wichtige Denkanstöße geben, obgleich Partizipations- und Engagementformen und Motivationen oft nur auf den ersten Blick dieselben sind. Erfahrungen aus dem Projekt "Grenzen-Los!" zeigen am Beispiel des freiwilligen Engagements und des Austauschs darüber exemplarisch auf, dass grenzüberschreitendes Lernen nur vor dem Hintergrund der Kenntnis der Unterschiede möglich ist. Zudem zeigen Erfahrungen im Projekt, dass für die Gestaltung einer Beteiligungskultur der Begriff der politischen Partizipation um zivilgesellschaftliche Elemente des Engagements erweitert werden könnte.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2020 Kommunales Handeln im europäischen Kontext

Erschienen in Heft 6/2020 Klimaanpassung im Stadtquartier
Das Europaparlament hat Ende September 2020 das EU-Klimaziel für 2030 noch einmal drastisch gesteigert. Im Kampf gegen den Klimawandel müsse der Ausstoß an Treibhausgasen bis 2030 um 60 % gegenüber den Werten von 1990 gesenkt werden. Bislang waren zunächst 40, später dann 55 % gefordert. Die Maßnahme soll dazu beitragen, das Pariser Klimaschutzabkommen mit seinem Kleiner-Zwei-Grad-Ziel einzuhalten. Diese neuerliche Entscheidung setzt die Akteure der deutschen Wohnungswirtschaft noch stärker unter Druck: Bis spätestens 2050 muss der gesamte Gebäudebestand in Deutschland komplett klimaneutral sein.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2023 Bildung in der Stadtentwicklung
Bildung ist das wichtigste Gut einer Gesellschaft. Der Zugang zu Bildung und das kontinuierliche Lernen entlang des persönlichen Lebensweges ermöglichen Teilhabe an der Gestaltung der Gesellschaft und individuelle Entwicklung jedes Menschen. Vorrangig findet diese Entwicklung vor Ort im kommunalen Raum statt. Für diese ganzheitliche persönlichkeitsprägende Bildung sind die zivilgesellschaftlichen Organisationen und Engagierten unverzichtbar. Für eine Gesellschaft, die sich zunehmend globalen Einflüssen ausgesetzt sieht, die sie nicht mehr selbst steuern kann, ist das Zusammenwachsen einer lokalen Gemeinschaft essenziell. Bildung ist dafür der Weg.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2020 Kommunales Handeln im europäischen Kontext
Unterschiede in Kompetenzen und Entscheidungsbefugnissen sowie im Zeitmanagement und den Kommunikationsformen sind wesentliche Herausforderungen beim Management europäischer Projekte. Da die Projektpartner aus ihren eigenen Systemen mit jeweils unterschiedlichen Funktionslogiken heraus handeln, müssen für eine erfolgreiche Kooperation gemeinsame Ziele definiert und Regeln der Zusammenarbeit und Kommunikation definiert werden. Neben den Chancen und Potenzialen beim Finden neuer Lösungsansätze ist aber auch eine Reihe interkultureller Herausforderungen zu meistern.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2017 Mobilität und Stadtentwicklung