
Erschienen in Heft 2/2020 Quartiersentwicklung und Wohnungswirtschaft
Die Weiterentwicklung von Wohnungsbeständen und die Nachverdichtung von Quartieren sowohl mit Blick auf den demografischen Wandel, neue Zielgruppenanforderungen, Fragen von Klimaschutz und Klimaanpassung als auch der Deckung der quantitativ hohen Wohnungsnachfrage sind zentrale Herausforderungen, mit denen Wohnungsunternehmen derzeit in besonderem Maße konfrontiert sind. (Portfolio-)Entscheidungen über Wohnungsbestände und deren Erweiterung sind für Wohnungsunternehmen von grundlegendem Charakter. Sie haben eine große wirtschaftliche Bedeutung und Tragweite. Angesichts der Heterogenität der Nachfrage wird es immer wichtiger, ausgehend vom pauschalen Maßstab – "eine Zwei-Raum-Wohnung vermietet sich immer" – differenzierter zu denken.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2021 50 Jahre Städtebauförderung
Konrad Adenauer hat einmal gesagt: "Ein Blick in die Vergangenheit hat nur Sinn, wenn er auch der Zukunft dient." Das gilt auch für das 50-jährige Jubiläum der Städtebauförderung. Die Städtebauförderung wird von Bund, Ländern und Kommunen seit dem Jahre 1971 gemeinsam finanziert und getragen. Städte und Gemeinden setzen die Städtebauförderungsmittel nach dem Motto "Tue Gutes und rede darüber" in konkrete Projekte um. Dies erfolgt unter enger Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger. Die Städtebauförderung und die jeweiligen Projekte werden den sich wandelnden Herausforderungen, etwa beim Klimaschutz, stets angeglichen. Die Städtebauförderung trägt so dazu bei, die Gegenwarts- und Zukunftsaufgaben in der Stadtentwicklung zu bewältigen.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2021 Religion und Stadt
Moderne Gesellschaften sind durch einen hohen Grad kultureller und religiöser Pluralität gekennzeichnet. Globalisierung und transnationale Migration steigern diese Vielfalt noch. Man kann daher heute den Umgang mit kulturellen und religiösen Minderheiten als das zentrale Governance-Problem säkularer Gesellschaften bezeichnen. Der vorliegende Beitrag ist ein Auszug aus dem Buch des Verfassers mit dem Titel "Governance of Diversity. Zum Umgang mit kultureller und religiöser Pluralität in säkularen Gesellschaften", das 2017 im Campus Verlag erschienen ist – an dieser Stelle ein Dankeschön an den Verlag für die Abdruckgenehmigung.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2021 Religion und Stadt
Der Zuzug von religiösen Migranten in Orte jenseits der Großstadt ist in der Forschung unterbelichtet und bildet doch einen spannenden Vergleichspunkt zu Religion und Migration in urbanen Räumen. In diesem Beitrag zeigen wir auf, warum eine Beschäftigung mit religiöser Pluralisierung in Klein- und Mittelstädten überfällig und spannend ist. Schlaglichtartig werfen wir einen Blick auf die wenige bisherige Forschung religiöser Pluralisierung jenseits der Großstadt, einschließlich einer kurzen Reflexion der Stadt-Land-Dichotomie. Abschließend formulieren wir erste Hypothesen zur Gestaltung religiöser Pluralisierung in Klein- und Mittelstädten.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2022 Auswirkungen des Klimawandels und die Anforderungen an das kommunale Krisenmanagement
Die Coronapandemie seit 2020 hat deutlich gemacht, wie verletzlich unsere Gesellschaft trotz allem technischen und medizinischen Fortschritt ist. Angesichts des Klimawandels werden wir künftig noch stärker von Extremwetterereignissen und Klimaschwankungen betroffen sein – mit gravierenden Folgen für unsere Städte. Die demografische Entwicklung wird unsere Städte mit Überalterung und Fachkräftemangel stark verändern. Die Stadtplanung muss hierauf mit präventiven Resilienzstrategien reagieren, und zugleich ihre Leitbilder und Instrumente weiterentwickeln. Die häufig kritisierte Charta von Athen von 1933 ist aus ihrer Zeit heraus zu verstehen, sie enthält Aussagen zur Stadthygiene und gesunden Stadt – auch als Antwort auf Spanische Grippe, Cholera und andere Pandemien. Der Leitbildwechsel zur aufgelockerten Stadt mit größeren Gebäudeabständen, verbesserter Infrastruktur und mehr Freiräumen ist nur vor diesem Hintergrund zu verstehen. „Hygiene“ steht bis heute als städtebaulicher Missstand im Baugesetzbuch (§ 136 BauGB), auch wenn sie nicht mehr als Begründung für Stadterneuerungsmaßnahmen verwendet wird – sie könnte nun eine Renaissance erfahren.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2021 Stadtentwicklung und Vergaberecht
Was sind die besten Lösungen für das Dorf und die Kleinstadt? Was ist die beste Lösung für die Metropole oder die Metropolregion? Und wie können Stadt und Umland besser miteinander vernetzt werden? Eines ist klar: Die Lösungen von gestern können nicht die Lösungen für heute und morgen sein. Für alle Bereiche der Architektur, dem Hochbau, der Innenarchitektur, natürlich der Landschaftsarchitektur, aber eben insbesondere auch in der Stadtplanung, sind neue Konzepte, neue Materialien, neue und frische Ideen gefragt. Wobei wir als Architekten- und Stadtplanerschaft insgesamt für uns in Anspruch nehmen, schon immer für die Zukunft geplant zu haben und Vordenker für nachhaltige und zugleich „schöne“ Lösungen zu sein.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2022 Zukunft Landwirtschaft: zwischen konkurrierender Landnutzung und Klimawandel
Landwirtschaft ist systemrelevant. Sie ist die grundlegende wirtschaftliche Tätigkeit des Menschen. Sie hat arbeitsteilige, städte- und staatsbildende Gesellschaften erst ermöglicht und ist somit auch die Grundlage jeder Zivilisation. Gleichzeitig gestaltet die Land- und Forstwirtschaft über 80 Prozent der Oberfläche unseres Landes. Zwangsläufig übt sie damit entscheidenden Einfluss auf Umwelt und Natur aus, auf Böden, Tiere, Gewässer und biologische Vielfalt – und auf das Erscheinungsbild Deutschlands. Mit stetigen Produktionssteigerungen hat die Landwirtschaft ein starkes Wachstum der Bevölkerung ermöglicht. Gleichzeitig hat sie die Versorgung dieser Bevölkerung mit Nahrung immer zuverlässiger und für die Haushalte immer günstiger gemacht. Daraus resultiert zu großen Teilen das, was heute allgemein als Wohlstand wahrgenommen wird: Große Teile der Ausgaben des Staates, der Wirtschaft und der Haushalte sind für andere als Ernährungszwecke verfügbar.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2014 Infrastruktur und soziale Kohäsion
Wenn im Kontext von Stadt- und Quartiersentwicklung von Partizipation die Rede ist, geht es meist um zeitliche, räumliche und im Teilnehmerkreis begrenzte Verfahren zur Formulierung und Umsetzung von Maßnahmen und Projekten. Das können anlassbezogene Veranstaltungen (Charettes, Zukunftswerkstätten, Workshops etc.) sein oder auch regelmäßig tagende Beiräte oder Jurys, zum Beispiel zur Vergabe von Geldern aus Quartiersfonds und -budgets. Die Erwartungen an diese Verfahren sind hoch. Über die frühzeitige Einbeziehung von Bewohnern, so ein häufig formulierter Anspruch, erhöhe sich die Legitimation der Entscheidungen, die Qualität und schließlich auch die Akzeptanz der betreffenden Maßnahmen; zudem trage Beteiligung zur Stärkung des sozialen Kapitals und des Zusammenhalts in einem Quartier bei.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2014 Infrastruktur und soziale Kohäsion
Von einer oder der Stadtgesellschaft zu reden, macht eigentlich nur Sinn, wenn damit gesagt werden soll, dass die Stadtgesellschaft besondere Charakteristika aufweist, die sie als ein spezifisches Governancekollektiv ausweisen. Dies scheint auch sinnvoll zu sein, führt man sich die in der Governance-Forschung durchaus gängige Unterscheidung zwischen „local governance“, „metropolitan governance“ und „regional governance“ vor Augen; offenbar soll damit gesagt werden, dass es jede dieser Governanceebenen mit spezifischen Governanceproblemen zu tun hat, die es von den Governanceproblemen anderer Ebenen unterscheidet. Dieser Beitrag basiert auf dem gleichnamigen Vortrag auf dem vhw-Verbandstag am 13. November 2014 in Berlin.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2014 Infrastruktur und soziale Kohäsion

Erschienen in Heft 4/2023 Bildung in der Stadtentwicklung
Bildung ist das wichtigste Gut einer Gesellschaft. Der Zugang zu Bildung und das kontinuierliche Lernen entlang des persönlichen Lebensweges ermöglichen Teilhabe an der Gestaltung der Gesellschaft und individuelle Entwicklung jedes Menschen. Vorrangig findet diese Entwicklung vor Ort im kommunalen Raum statt. Für diese ganzheitliche persönlichkeitsprägende Bildung sind die zivilgesellschaftlichen Organisationen und Engagierten unverzichtbar. Für eine Gesellschaft, die sich zunehmend globalen Einflüssen ausgesetzt sieht, die sie nicht mehr selbst steuern kann, ist das Zusammenwachsen einer lokalen Gemeinschaft essenziell. Bildung ist dafür der Weg.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2023 Urbane Transformation als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
Erkenntnisse aus mindestens zwei Jahrzehnten Transformationsforschung zeigen auf, welche Fähigkeiten wir als Gesellschaft entwickeln müssen, um urbane Transformationsprozesse gestalten zu können. Die kommunale Planung ist dabei nur ein Akteur unter vielen, der Potenzial besitzt, unsere transformativen Kapazitäten zu erhöhen. Der Beitrag beleuchtet verschiedene, aber längst nicht alle Schnittstellen zwischen Anforderungen transformativen Wandels und kommunaler Planung.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2020 Kommunales Handeln im europäischen Kontext
Entstanden aus einer losen Interessengemeinschaft von Kaufleuten, beherrschte die Hanse an ihrer Blütezeit vom 13. bis 15. Jahrhundert den Handel in Nord- und Ostsee und entwickelte sich zu einer der einflussreichsten Wirtschaftsmächte Europas. Manche sehen die Hanse gar als Vorläufer der Europäischen Union: Auch, wenn die Hanse nie in eine feste politische Struktur eingebunden war, so handelte die Gemeinschaft der Hansestädte in gewissem Rahmen doch durchaus europäisch: Der Städtebund vertrat seine Handelsinteressen über Stadt- und Ländergrenzen hinaus, verschaffte seinen Mitgliedern Handelsprivilegien und entschied Streitigkeiten durch eine eigene Gerichtsbarkeit, die von den Ältesten, den sogenannten Oldermännern, ausgeübt wurde.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2013 Gentrifizierung: Mehr als ein Markphänomen
Die Antwort auf die im Titel gestellte Frage lautet: wenig. Wenig sozialer Zusammenhalt, wenn man die moderne Großstadt vergleicht mit dem dichten Geflecht sozialer Beziehungen im vormodernen Dorf. Und wenig soziale Konflikte, wenn man deutsche Städte vergleicht etwa mit der französischen Banlieue oder nordamerikanischen Städten. Im ersten Teil meines Beitrags soll erklärt werden, weshalb Nachbarschaft heute in den Städten nur noch eine geringe Rolle spielt und für welche Menschen sie auch heute noch wichtig ist. Im zweiten Teil wird versucht zu erklären, weshalb es hier vergleichsweise wenig soziale Konflikte gibt. Im dritten Teil wird dann auf Tendenzen hingewiesen, wonach sich die sozialen Probleme auch in deutschen Großstädten verschärfen werden. Am Schluss stehen Überlegungen, um solchen Tendenzen entgegenzuwirken.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2020 Ertüchtigung der Agglomerationen
Benachteiligte oder marginalisierte Quartiere gibt es, seit es Städte gibt. Sie sind Manifestationen von gesellschaftlichen Prozessen und Strukturen und als solche Ausdruck sozialer bzw. sozialräumlicher Ungleichheit. Erste sozialwissenschaftliche Forschungen über räumliche soziale Ungleichheit finden sich ab dem 19. Jahrhundert etwa bei Friedrich Engels "Lage der arbeitenden Klasse in England" (1845) oder den Werken der Chicagoer Stadtsoziologie. Parallel dazu bilden sich zu dieser Zeit auch sozialreformerische Ansätze heraus mit dem Ziel, die Folgen der räumlichen und sozialen Ungleichheit zu lindern. Hierzu kann beispielweise auf die Settlement-Bewegung hingewiesen werden, die ausgehend von London und später den USA auch in vielen europäischen Ländern Nachahmung fand.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2020 Ertüchtigung der Agglomerationen
Die deutschen Agglomerationen stehen vor großen Herausforderungen. Wohnungsnot, Klimakrise, soziale Spaltung, Luftbelastung und Verkehrsinfarkt reichen als Stichworte aus, um die Breite und Dringlichkeit der stadtregionalen Handlungserfordernisse deutlich zu machen. Dabei sind die Agglomerationen institutionell, d. h. in ihren Entscheidungs- und Handlungsstrukturen, unterschiedlich gut auf die Bewältigung der zahlreichen Aufgaben vorbereitet und bei den planungs- und bodenrechtlichen Instrumenten auf bundes- und landesrechtliche Vorgaben angewiesen. Aus dem großen Katalog der Problemstellungen sollen nachfolgend die Möglichkeiten zur Stärkung der räumlichen Planung und der regionalen Organisation in den Agglomerationen näher betrachtet werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2012 BürgerMachtStadt – Kommunen als Rettungsanker der Demokratie?
Die Frage im Titel dieses Beitrags hat angesichts der weithin diagnostizierten Legitimationskrise des repräsentativ-demokratisch verfassten Nationalstaates und der Legitimationsdefizite internationaler governance-Arrangements an Relevanz gewonnen. Während die Steuerungsfähigkeit und demokratische Qualität nationalstaatlicher Politik angesichts von Globalisierung und Europäisierung angezweifelt wird, verbinden sich mit der lokalen Ebene Hoffnungen: Eine Erneuerung demokratischen Regierens erscheint am ehesten in Städten und Gemeinden denkbar. Damit würden diese zu Rettungs- und Legitimationsankern demokratischer Mehrebenenpolitik in der postnationalen Konstellation (Habermas 1998). Doch was bedeutet die Rede von der Legitimität politischer Systeme überhaupt und was macht Kommunen, ihre Institutionen und Akteure, Verfahren und Entscheidungen in einem empirischen Sinne legitim?
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2015 Einfamilienhäuser der fünfziger bis siebziger Jahre
Einfamilienhäusern und Einfamilienhausgebieten wird seit einiger Zeit keine gute Zukunft prognostiziert, denn – so wird gesagt – die Nachfrage nach ihnen gehe zurück. Die existierenden Einfamilienhäuser seien im beginnenden 21. Jahrhundert zunehmend die falschen Objekte am falschen Ort. Das Interesse an vorstädtischen, suburbanen, kleinstädtischen oder dörflichen Einfamilienhausgebieten sinke angesichts der quantitativen und qualitativen Veränderungen auf der Nachfrageseite. Die empirische Befundlage ist allerdings noch dünn. Es gibt bisher keine großen systematischen Studien, die Veränderungen in Einfamilienhausgebieten mit ihrer kleinteiligen Eigentumsstruktur dokumentieren. Und dort, wo es erste Leerstände oder einen Preisverfall gibt, wird auch nicht viel darüber gesprochen, denn der Markt soll nicht schlecht geredet werden. Insofern muss die Diskussion zunächst mit kleinen Fallstudien unterfüttert werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2025 Infrastrukturen in ländlichen Räumen
Mobilität ist ein entscheidender Faktor für die Zukunftsfähigkeit der ländlichen Räume. Doch der demografische Wandel sowie veränderte Lebens- und Arbeitsgewohnheiten stellen den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in ländlichen Regionen immer wieder vor große Herausforderungen. Klassische Bedienformen sind oft nur schwer in einer angemessenen Dichte aufrechtzuerhalten, meist dominiert der Individualverkehr, und insbesondere ältere Menschen haben aufgrund von Mobilitätseinschränkung zunehmend Schwierigkeiten, die Haltestellen des ÖPNV zu erreichen. Das Bürgerbusprojekt setzt genau dort an und verbessert nicht nur die Mobilität im ländlichen Raum. Darüber hinaus fördert es das bürgerschaftliche Engagement und stärkt den Zusammenhalt vor Ort.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2010 Stadtentwicklung und demografischer Wandel
Menschenleere Landstriche, überalterte Städte, Überforderung der jungen Generation, die die Finanzlast der Alten nicht mehr tragen kann – dies sind Bilder, die immer wieder mit dem demografischen Wandel in Verbindung gebracht werden. In der öffentlichen Diskussion wird die Alterung der Gesellschaft oft als Belastung vor allem für die sozialen Sicherungssysteme gesehen, aber immer mehr werden auch die positiven Seiten des Alter(n)s diskutiert und die Potenziale. In den Diskussionen über den demografischen Wandel wird meist außer Acht gelassen, dass es den demografischen Wandel nicht gibt. Eine Vielzahl unterschiedlicher Entwicklungen stehen hinter diesem Begriff, die eine differenzierte Betrachtung verlangen.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2009 Anerkennungskultur im bürgerschaftlichen Engagement

Erschienen in Heft 3/2009 Lernlandschaften in der Stadtentwicklung
Der möglichst weitgehende Schutz des Klimas zählt zu den zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Neben der Bundesregierung haben inzwischen viele Kommunen, teilweise im EU-Rahmen, ehrgeizige Ziele bei der Reduzierung der für den Treibhauseffekt hauptverantwortlichen CO²-Emissionen formuliert, Deren erfolgreiche Umsetzung hängt jedoch nicht zuletzt von der lebensnahen Berücksichtigung von Einstellungs- und Verhaltensmustern sowie der aktiven Mitwirkung des Bürgers ab.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2012 Nachhaltigkeit und Wohnen
Nein, Günther Jauch war nicht da – aber der Gasometer in Berlin-Schöneberg strahlte auch ohne den prominenten Moderator ein besonderes Flair aus. Der vhw hatte sich diesmal als Veranstaltungsort für seinen jährlichen Verbandstag ein Industriedenkmal und Fernsehstudio gleichermaßen ausgesucht. Aber rasch wurden sowohl die Anordnung als auch die Dimensionen von Bühnenbereich und Zuschauerrängen von Referenten und Teilnehmern angeeignet. "BürgerMachtStadt – Kommunen als Rettungsanker der Demokratie?!" – so hieß das Thema des vhw-Verbandstages 2012, und über 200 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung sind der Einladung des Verbandes gefolgt. Die Rolle Günther Jauchs übernahm – wie schon beim Verbandstag 2011 – Elke Frauns aus Münster.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2018 Tourismus und Stadtentwicklung

Erschienen in Heft 6/2018 Kooperationen im ländlichen Raum
Die nachhaltige Entwicklung einer Kommune ist heute Konsens, doch wie steht es um die organisationelle Nachhaltigkeit der Verwaltung, die diesen diffizilen Prozess vorantreiben soll? Das Arbeiten an sich selbst durch das laufende Entwickeln der eigenen Kapazitäten und Kompetenzen, kommt oft zu kurz. Wie kann also die organisationelle Nachhaltigkeit, sprich, die eigene Fähigkeit auch langfristig und umfassend seinen Auftrag unter unsicheren Bedingungen zu erfüllen, entwickelt und gesteigert werden? An zwei Fallbeispielen, der Organisationsentwicklung eines Stadtteil-NGOs aus Indien und dem integrativen Stadt- und Kompetenzentwicklungsprozess einer deutschen Kommune, soll dies hier erläutert werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2024 Urbane Resilienz
Resilienz ist im ländlichen Raum, gerade in Transformationsregionen wie der Lausitz, ein wichtiges Konzept der räumlichen Entwicklung. Der demografische Wandel geht hier mit großen Herausforderungen einher. Resilienz im ländlichen Raum bedeutet, etablierte Denkweisen zu hinterfragen – insbesondere das oft dominierende Wachstumsparadigma der Stadtentwicklung. Im Mittelpunkt steht das Lernen von Rückkehrenden, die als „Change Maker“ innovative Impulse setzen können. Zudem wird die Bedeutung von Multitasking und Automatisierung sowie die Optimierung von Verwaltungsstrukturen betont. Ländliche Regionen besitzen das Potenzial, als Experimentierfelder für eine Postwachstumsgesellschaft zu dienen.
Beiträge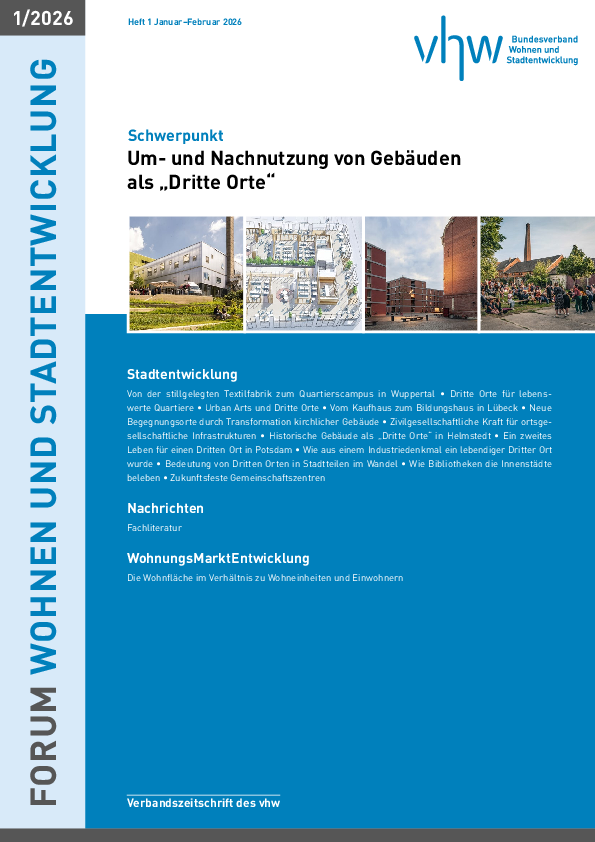
Erschienen in Heft 1/2026 Um- und Nachnutzung von Gebäuden als "Dritte Orte"
Als 2020 das Karstadt-Sport-Gebäude im Herzen der Lübecker Altstadt schloss, wurde sichtbar, was viele Innenstädte bundesweit erleben: Die gewohnten Funktionen des Zentrums geraten ins Wanken, der Einzelhandel verliert an Bedeutung und Leerstände nehmen zu. Zugleich wächst der Wunsch nach Orten, die Begegnung und Gemeinschaft ermöglichen. Für Lübeck kam eine zusätzliche Herausforderung hinzu: Die vier Altstadtgymnasien benötigen dringend mehr Raum. Die Schließung des Kaufhauses bedeutete daher nicht nur einen Verlust, sondern öffnete eine seltene strategische Chance, ein großes innerstädtisches Bestandsgebäude neu zu denken – und damit auch die Rolle der Innenstadt selbst weiterzuentwickeln. Die Hansestadt entschied sich für einen ungewöhnlichen Weg und kaufte das Gebäude. Statt einen jahrelangen Leerstand in Kauf zu nehmen oder auf eine rein kommerzielle Nachnutzung zu setzen, wurde das Warenhaus bewusst als städtische Ressource verstanden: erst als Reallabor im Rahmen des ÜBERGANGSHAUSES, später als künftiger Standort für ein neues Bildungshaus.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2023 Im Osten viel Neues: genutzte Potenziale, engagierte Akteure, erfolgreiche Stadtentwicklung
Neubrandenburg: Investoren, die sich zu Beginn der 1990er Jahre aufmachten, um den unbekannten Osten, seine Industrie- und Gewerbelandschaft zu entdecken, landeten schon mal in Brandenburg an der Havel. Es war keine Seltenheit, dass Neubrandenburg mit der rund 200 Kilometer südwestlich gelegenen Stadt verwechselt oder gar mit Brandenburg als Bundesland in Bezug gesetzt wurde. Und obwohl auch Neubrandenburg auf eine Geschichte zurückblickt, die sie als Stadt mit einer Vielzahl ostdeutscher Kommunen teilt, ist die Lage der Vier-Tore-Stadt im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte genau so einzigartig wie die Projekte, die die Neubrandenburger in ihrer Stadt verwirklichen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2023 Im Osten viel Neues: genutzte Potenziale, engagierte Akteure, erfolgreiche Stadtentwicklung
Im vorliegenden Beitrag werden die besonderen Rahmenbedingung in Thüringen als einem ostdeutschen Flächenstaat bei der Gestaltung von Stadtentwicklung reflektiert: Hierzu zählen die kleinteilige Siedlungsstruktur des Landes, der demografische Wandel, finanzschwache Kommunen und anhaltender Strukturwandel sowie die spezifischen Bedingungen postsozialistischer Transformation. Anhand von fünf Beispielen wird sodann beispielhaft gezeigt, mit welchen Strategien, Instrumenten und kooperativen Formaten Stadtentwicklung in den verschiedenartigen räumlichen Kontexten des Freistaats produktiv und erfolgreich gestaltet werden kann.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2018 Kooperationen im ländlichen Raum
Im Jahr 2004 kritisierte der damalige Bundespräsident Horst Köhler, sicher den damals dominanten Zeitgeist angemessen ausdrückend, dass nur „den Subventionsstaat zementiert“, wer gleichwertige Lebensverhältnisse anstrebe. Zwar gab es damals durchaus Widerspruch aus einigen Bundesländern und der Fachwelt (vgl. ARL 2006), eine breitenwirksame Diskussion entstand aber nicht. Seit zwei, drei Jahren ist es vollkommen anders: „Gleichwertigkeit“ gilt im Zusammenhang mit der Diskussion über soziale Gerechtigkeit als wesentliche Zielvorstellung und ist Thema zahlloser Veranstaltungen, Kommissionen und Veröffentlichungen. Auch das seit einigen Jahren unübersehbar zunehmende Interesse an „Heimat“ kann in diesen Kontext eingeordnet werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2024 Zukunft der Innenstädte in Deutschland
Der Nutzungswandel in den Innenstadtzentren und die Schließung und Umnutzung früherer Warenhäuser sind kein rein deutsches Phänomen, sondern betreffen auch andere, in den Einkaufsgewohnheiten und Einzelhandelsstrukturen ähnliche, europäische Nationen, insbesondere Großbritannien und die Niederlande. Dieser Beitrag fokussiert die Entwicklung in den Niederlanden. Nach einem Überblick über den Status quo werden drei ausgewählte Transformationsvorhaben vorgestellt und abschließend reflektiert.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2025 Nachhaltige Stadt- und Sportentwicklung
Klima im Wandel: Die globale Durchschnittstemperatur lag 2024 1,6 °C über dem vorindustriellen Niveau (1850–1900) und war das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1850 (Copernicus 2025). Das im Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 formulierte Ziel einer Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 °C bis 2050 wurde damit erstmals überschritten. Auch in Deutschland war 2024 das bisher wärmste Jahr. Im Vergleich zu den ersten 30 Jahren der systematischen Auswertungen (1881–1910) lag hier die Durchschnittstemperatur 2024 sogar um circa 1,9 °C höher (DWD 2025). Diese Entwicklung wird sich fortsetzen. Für den Zeitraum 2030–2060 prognostiziert das Umweltbundesamt je nach Emissionsszenario eine Erhöhung von bis zu knapp über 3 °C gegenüber dem Zeitraum 1881–1910, wobei die Erwärmung im Süden Deutschlands stärker ausgeprägt sein wird als im Norden (UBA 2023). Die Ursache der starken Erwärmung – darin ist sich die Wissenschaft einig – ist der von menschlichen Einflüssen verursachte Ausstoß von Treibhausgasen, insbesondere Kohlendioxid (IPCC 2024).
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2025 Kommunen zwischen Zukunftsorientierung und Gegenwartsbezug
Städte und Gemeinden spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit. Im Gegensatz zu den übergeordneten staatlichen Ebenen sind die Rathäuser nah an der Lebenswirklichkeit der Menschen. Dadurch haben sie die Chance, durch eine integrierte und nachhaltige Kommunalentwicklung den aktuellen Transformationsprozess im Sinne der Daseinsvorsorge zu gestalten. Ziel ist es, unsere gemeinwohlorientierten Kommunen resilienter zu machen und so in ihrer Funktion zu sichern. Die Verwaltungsmenschen der Zukunft werden vor diesem Hintergrund eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung einer lernenden, effizienten, transparenten, bürgernahen und dem Gemeinwohl dienenden Verwaltung spielen.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2012 Stadtentwicklung und Sport
Die proletarische Vergangenheit des Fußballsports in Deutschland ist der wohl weitestverbreitete und beliebteste fußballgeschichtliche Kommunikationsinhalt im Zeitalter des professionellen Showsports. In erster Linie kennzeichnet sie die oftmals romantisch verklärende, teilweise auch mystifizierende Darstellungsweise des traditionellen Fußballs in den Medien. Zugleich ist sie fester Bestandteil sowohl des kulturellen Fankapitals der meisten Fußballanhänger als auch des ökonomisch verwertbaren Vereinskapitals vieler Fußballvereine, die ihre proletarische Herkunft marketingstrategisch gezielt zur Identitätsbildung und Stärkung der Fanbindung einsetzen. Und nicht zuletzt prägt sie auch das Selbstverständnis vieler Fangruppen und sogar die Selbstwahrnehmung ganzer Regionen.
Beiträge
Erschienen in
Seit den 1970er Jahren sind die Städte in Westdeutschland einem tief greifenden ökonomischen Strukturwandel unterworfen, mit dem ein drastischer Abbau von Arbeitsplätzen im produzierenden Gewerbe verbunden ist. Als Folge dieses Wandels hat sich insbesondere in den altindustriellen Städten eine ausgeprägte strukturelle Arbeitslosigkeit und damit verbunden, eine fortschreitende Einkommensarmut herausgebildet. Neben dem ökonomischen Wandel findet in fast allen Städten aufgrund sinkender Geburtenzahlen und zunehmender Wanderungsverluste ein starker Bevölkerungsrückgang statt. Hierdurch werden Prozesse der räumlichen Polarisierung zwischen Arm und Reich zusätzlich verstärkt. Der Beitrag beschreibt den Zusammenhang zwischen Bevölkerungsrückgang und sozialer Segregation, fragt nach deren sozialen Folgen und umreißt die Reichweite der Interventionen im Rahmen von Stadtteilentwicklungsprogrammen.
Beiträge

Erschienen in Heft 5/2011 Mehr wissen – mehr wagen – mehr Dialog
Es ist inzwischen umfassend thematisiert, mit welchen Legitimations- und Steuerungsschwierigkeiten sich das politische System – und damit auch die Kommunen –derzeit auseinanderzusetzen haben. Es sind dies "Probleme der Kommunen", die allerdings in einer demokratischen und sich demokratisch verstehenden Gesellschaft unmittelbar von den Bürgern "gespiegelt" werden: Bürgerinnen und Bürger nehmen die Probleme, die die lokale Politik prägen, zugleich auch als ihre eigenen Probleme wahr – als Probleme, die die Kommune mit ihnen selbst, aber zugleich auch als Probleme, die sie selbst mit den Kommunen und den kommunalen Akteuren haben. Anders ausgedrückt: Die Steuerungs- und Organisationsprobleme der Kommunen in unseren modernen und komplexen Lebenswelten entwickeln sich unmittelbar zu Legitimations- und Akzeptanzproblemen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2011 Mehr wissen – mehr wagen – mehr Dialog
In zwei Kongressvorträgen hatten Peter Rohland (vhw) und Prof. Dr. Hans J. Lietzmann (Bergische Universität Wuppertal) die ausgearbeiteten Ansätze des vhw zu den Dialogen im Städtenetzwerk vorgestellt. Nachfolgend boten fünf Dialogforen die Gelegenheit, zentrale Aspekte dieser Ansätze anhand der folgenden Leitfragen zu diskutieren: Wie kann man mittels Dialog "auf Augenhöhe" mehr lokale Demokratie wagen?Wer kann wie kommunalpolitische Themen auf die Tagesordnung setzen?Wie erreicht man alle Bürger und wie sollte man mit ihnen dauerhaft erfolgreich kommunizieren?Was bedeutet Kommunalpolitik mit "der Kraft des besseren Arguments"?Wie kommt man über den Dialog zu effizienten und legitimen Entscheidungen
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2011 Von der sozialen Stadt zur solidarischen Stadt
"Politische Kommunikation in der Bürgergesellschaft", bei diesem Thema geht es um Überlegungen zu Aufbau und Pflege einer neuen Kommunikations- und Beteiligungskultur. Gemeint ist damit nicht, woran reflexartig gedacht wird, wenn von Kultur die Rede ist: Kultur im Gegensatz zu Zivilisation. Kommunikations- und Beteiligungskultur meint nichts Harmonisierendes, keine Gemeinschaftstümelei, zielt nicht primär auf Einhegung und Konfliktkanalisierung. Kommunikations- und Beteiligungskultur ist verortet im Kontext von politischer Kultur. Im Gegensatz zum normativen Verständnis bezeichnen die Sozialwissenschaften politische Kultur als das Gesamt politisch relevanter Einstellungen, Werthaltungen und Verhaltensweisen in einem Gemeinwesen.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2012 Integrierte Stadtentwicklung und Bildung
Die empirischen Daten erlauben keinen Zweifel daran, dass der Demokratie gegenwärtiger Bauart die Menschen davonlaufen: Die Beteiligung an den Wahlen sinkt seit geraumer Zeit dermaßen deutlich, dass man nicht mehr daran vorbeikommt, von einem Trend zu sprechen. Ungeachtet dessen steigt die Zahl der Wechselwähler, die keine eindeutige Bindung zu einer bestimmten Partei mehr besitzen. Aber auch die Zahl der beharrlichen Nichtwähler steigt immer mehr an und wird nur durch gelegentliches Protestwahlverhalten gebremst. Die Mitgliedschaft in den Parteien, die nie sonderlich hoch war, sinkt insgesamt gesehen kontinuierlich weiter ab. Eine Krise der Demokratie abstreiten zu wollen, würde somit offenbar einem Beschwichtigungsversuch gleichkommen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2011 Neue Dialogkultur: Wir sprechen uns im Web 2.0
Mit neuen Technologien verbinden sich nicht selten hochfliegende Erwartungen ebenso wie kulturkritische Untergangsszenarien. Das gilt auch für das Internet und vor allem für das Web 2.0. Sehen darin die einen die vorläufig letzte Stufe der Entfremdung des Menschen, so erhoffen sich die anderen einen technologischen Quantensprung für die Beteiligung des Menschen am gesellschaftlichen und politischen Leben. Der Beitrag refl ektiert die Chancen und Probleme des Web 2.0 als sogenanntes Mitmachmedium. Er verweist auf die Kommunikations- und Interaktionspotenziale und skizziert bisherige Erfahrungen in der Nutzung des Web 2.0 in Deutschland und darüber hinaus.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2011 Städtenetzwerk Lokale Demokratie
Die Werk-Stadt "Integration und Wohnen – unterwegs zur geteilten Stadt" im Rahmen des ersten Kongresses zum Städtenetzwerk fand mit rund 130 Teilnehmern aus Politik und Verwaltung, Wohnungswirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft statt. Moderiert wurde die Werk-Stadt von Elke Frauns vom büro frauns kommunikation, planung, marketing aus Münster. Referenten der Werk-Stadt waren die Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid, Beate Wilding, Bernd Hallenberg, Bereichsleiter Forschung beim vhw, Prof. Jens Dangschat von der Technischen Universität Wien und Hendrik Jellema, Vorstand der GEWOBAG Wohnungsbaugesellschaft Berlin.
Beiträge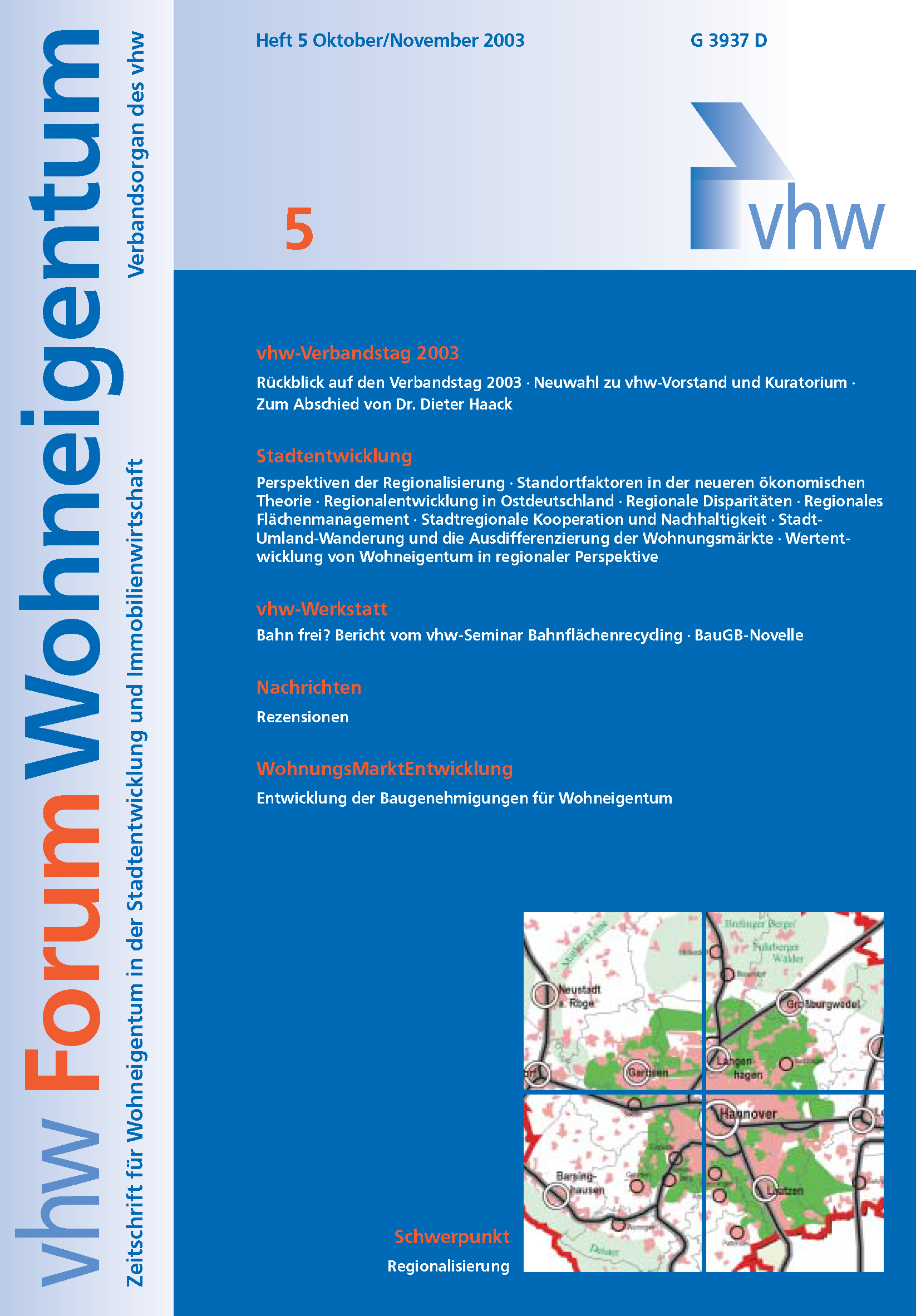
Erschienen in
Mit dem Ende des Wohnungsbaubooms der frühen 1990er Jahre sind die Wohnungsmärkte nicht nur in einen konjunkturellen Abschwung sondern auch in eine neue strukturelle Phase getreten. Unter den Bedingungen des demographischen Wandels bildet sich vielerorts ein Nachfragermarkt heraus. In diesem Markt wird die durch Wirtschaftsentwicklung und Suburbanisierung angestoßene räumliche Dynamik zu einer wichtigen Triebkraft der Entwicklung der Wohnungsmärkte und zum Motor der Neubautätigkeit werden.
Beiträge
Erschienen in
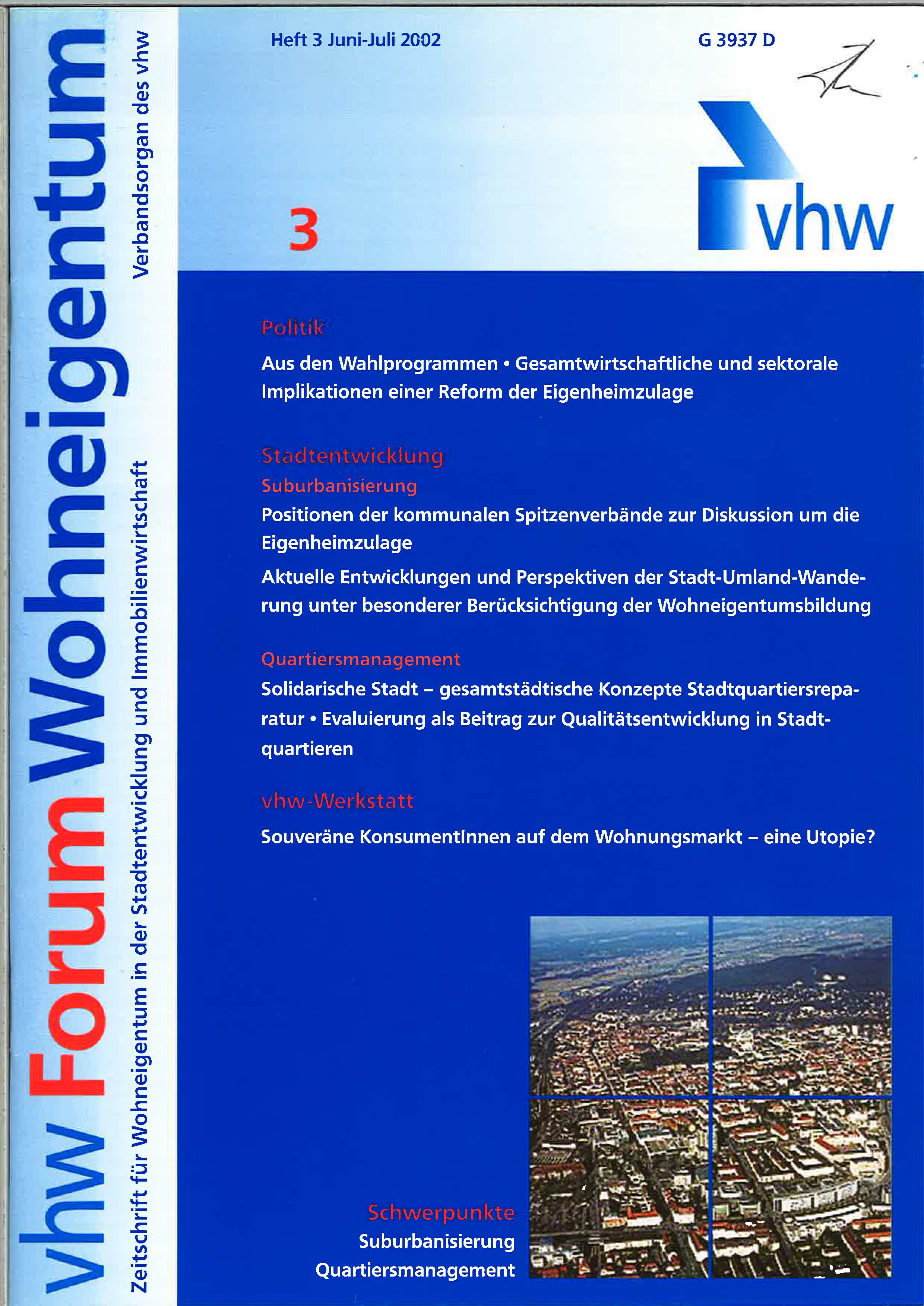
Erschienen in
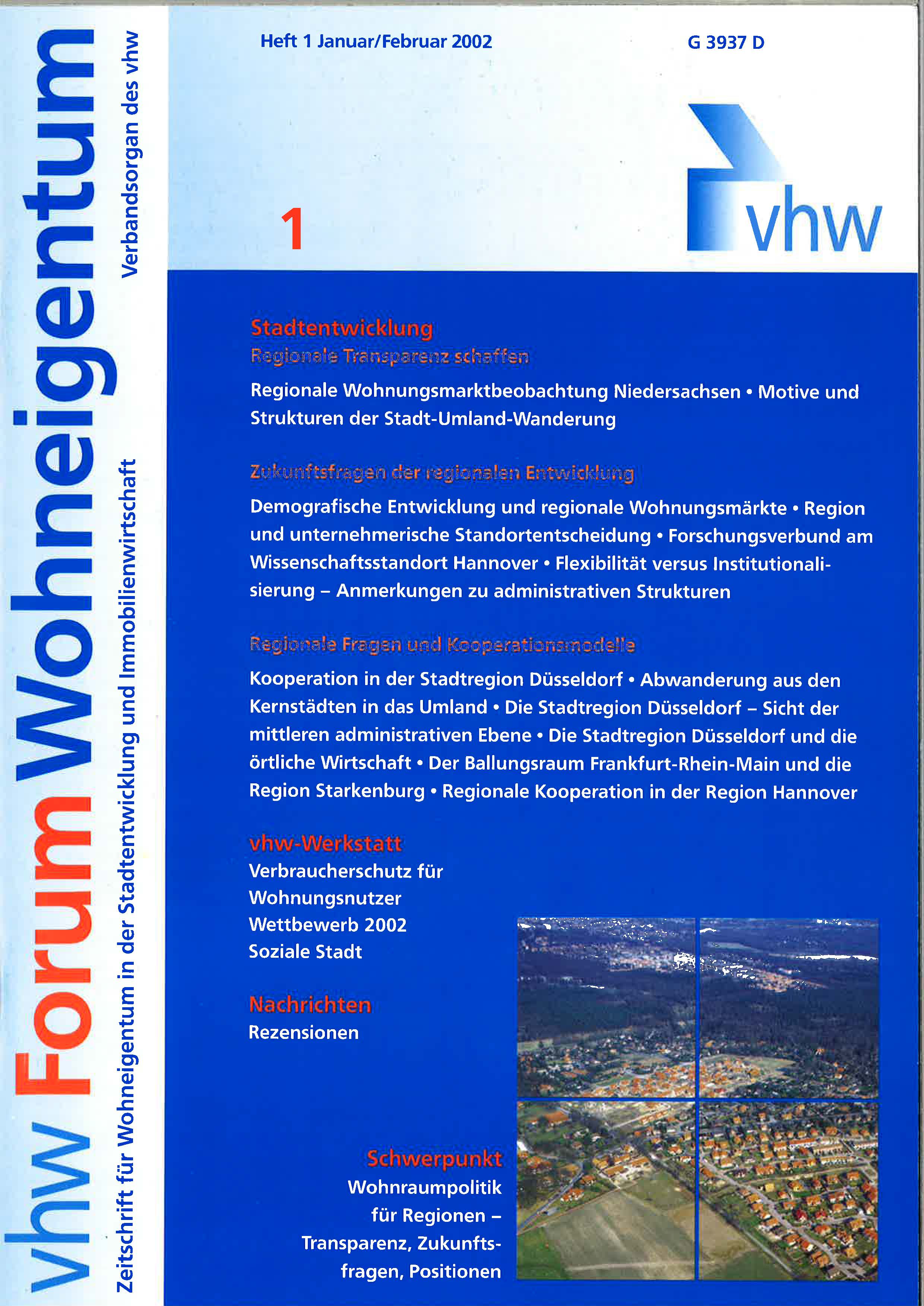
Erschienen in

Erschienen in Heft 2/2007 Public Real Estate Management (PREM)
Die Haushaltsmisere von Bund, Ländern und Kommunen beeinträchtigt die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Jüngste Verbesserungen durch höhere Steuereinnahmen dürfen über tiefer gehende strukturelle Probleme nicht hinweg täuschen. Eingeschlagene Wege wie die Verwaltungsmodernisierung und begonnene Optimierungsmaßnahmen müssen gerade jetzt stringent weiterverfolgt werden. Insbesondere gilt dies, wenn sie so aussichtsreich sind wie im Bereich des Immobilienmanagements. Hier existiert ein enormes Optimierungs-, Rationalisierungs- und Einsparpotenzial.Die Herausforderungen des Liegenschaftswesens der öffentlichen Hand umfassen Themen wie unzureichendes betriebswirtschaftliches Management-Know-how, fehlende Ziele und Strategien, ineffiziente Organisation, mangelnde erfolgsorientierte Führungs-, Steuerungsmethoden und Anreizsysteme, geringe immobilienwirtschaftliche Datentransparenz sowie Defizite des kameralistischen Rechnungswesens. Seit den neunziger Jahren werden sowohl auf Bundes-, Landes- wie kommunaler Ebene Optimierungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen hin zu einem professionellen Public Real Estate Management durchgeführt.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2006 Urban Governance
In den Städten und Gemeinden werden vielfältige neue Governance-Strukturen entwickelt, weil Strukturwandel, Verwaltungsmodernisierung und fiskalische Nöte neue Problemlösungen erfordern. Dabei ist die Schwierigkeit der Wissenschaft, den Governance-Begriff hinreichend scharf zu definieren, der Vielfalt der realen Lösungsansätze geschuldet. Für die Praxis ist es allein entscheidend, ob neue Lösungsansätze kostengünstig, schneller und zielführender als traditionelle Wege sind. Sind in diesem Sinne effiziente Governance-Strukturen einmal gefunden, gilt es, diese Erfolge wiederholen zu können – also möglichst dauerhafte Governance-Strukturen für ähnliche Aufgabenbereiche zu implementieren. Mit der Online-Arbeitshilfe www.3stadt2.de steht ein hilfreiches Tool für die Praxis zur Verfügung.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2007 Bürgergesellschaft und Nationale Stadtentwicklungspolitik
Der Diskussion über den Klimawandel verdanken wir die Unterscheidung zwischen zwei möglichen Strategien, mit großen gesellschaftlichen Problemen umzugehen, der Adaptation und der Mitigation. Eine dieser Strategien ist die der Anpassung an die einzelnen Folgen solcher Probleme. Im Falle des Klimaschutzes betrifft dies etwa den Anbau von Saatsorten, die den veränderten klimatischen Bedingungen besser angepasst sind, im Siedlungswesen dem Bau von Dämmen oder das wirksame Verbot, in Überschwemmungsgebieten zu bauen. Diese Strategie, die Adaptation, ist sehr wichtig, ja unverzichtbar. Adaptation ist allerdings eine Strategie, die den Problemkomplex nicht kausal angeht, sondern das Leben mit ihm erträglicher gemacht, bis nächste Verschlechterungen weitere Anpassungsmaßnahmen zur Folge haben. Die Mitigation bezeichnet dagegen die Bekämpfung der Ursachen. Im Falle der Diskussion über den Klimawandel meint dies in erster Linie die Verringerung der Emissionen, die ja die wichtigste antropogene Ursache für die Erwärmung der Erde sind.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2007 Bürgergesellschaft und Nationale Stadtentwicklungspolitik
Gemeinwohlorientierte Organisationen und Verbände, die zugleich die Interessen bestimmter Bevölkerungsgruppen vertreten, wie etwa der Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e. V., der sich für die Ziele des selbstgenutzten Wohneigentums in einer nachhaltigen Stadtentwicklung einsetzt, sind stets gehalten, ihre Rolle in einer sich wandelnden Gesellschaft und angesichts sich wandelnder Auffassungen von der Rolle des Staates neu zu überdenken. Mit dieser ständig neuen Vergewisserung über den eigenen öffentlichen Auftrag nehmen sie Teil an der allgemeineren Diskussion, wie der "Öffentliche Auftrag" von Gemeinwohlakteuren – seien dies der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder ein Idealverband wie der vhw – eigentlich bestimmt werden kann.
Beiträge