
Erschienen in Heft 5/2011 Mehr wissen – mehr wagen – mehr Dialog
In dem als "Wiege der Demokratie in Deutschland" bekannten Hambacher Schloss wurde das geistige Fundament der deutschen Demokratiebewegung im 19. Jahrhundert gelegt. Bis heute hat dieser Ort nicht an Anziehungskraft für weltoffene Bürger verloren. Das zeigte sich gerade auch beim diesjährigen Vergaberechtsforum des vhw-Südwest speziell für Teilnehmer aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, die die Gelegenheit nutzten, Impulse zu zentralen Fragestellungen des Vergaberechts und seinen praktischen Auswirkungen bei der öffentlichen Hand durch hochkompetente Referenten zu erhalten und mit ihnen zu diskutieren. Nachfolgend werden die Kernaussagen durch die Referenten zusammengefasst und wiedergegeben.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2011 Mehr wissen – mehr wagen – mehr Dialog
Nie wurde so viel beteiligt wie heute, aber nie schien der Unmut der Bevölkerung über Planung so groß zu sein. Offensichtlich kann die wachsende Zahl von Dialogangeboten das gestiegene Mitsprachebedürfnis der Bürger nicht stillen. Im Gegenteil: Es scheint, je stärker um Mitwirkung geworben wird, um so unzufriedener werden die Bürger. Aus Unmut wird immer häufiger offener Protest, nicht nur in Stuttgart, teils nachvollziehbar und sachbezogen, teils nur noch als blinder Reflex auf jedwede öffentliche Maßnahme. An manchen Orten konkurrieren mitunter gleich mehrere Dialogangebote gleichzeitig um Aufmerksamkeit, ohne aufeinander abgestimmt zu sein. Dabei werden oft wichtige grundsätzliche Fragen nicht geklärt. Bis wohin einladen? Wann mit welchem Ziel beteiligen?
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2011 Mehr wissen – mehr wagen – mehr Dialog
"Auch das Musiktheater will Bürgernähe", so die Schlagzeile zum Auftakt der Opernsaison in der Stuttgarter Zeitung am Montag, 19. September 2011. Spätestens jetzt wird dem interessierten Betrachter klar, dass die inflationäre Verwendung des Begriffs "Bürgernähe" immer seltsamere Blüten treibt. Dies gilt sicher nicht nur für die Region Stuttgart, wo Stuttgart 21 geradezu als Mahnmal misslungener Bürgerbeteiligung allgegenwärtig ist. Nein, die ganze Republik wetteifert um Bürgerpartizipation, Bürgerbeteiligung und Bürgernähe. Dabei ist unser Selbstvertrauen so gering, dass Heiner Geissler, Schlichter im Stuttgart-21-Prozess mahnte, doch in die Nachbarstaaten Schweiz und Österreich zu blicken, um Bürgerpartizipation zu lernen. Sicher gibt es dort auch gute Beispiele. Er übersieht dabei aber, dass es auch in Deutschland eine Vielzahl von richtungsweisenden Prozessen der Bürgerbeteiligung gibt. So auch in der nur 20 Kilometer von Stuttgart entfernten Stadt Ludwigsburg.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2011 Mehr wissen – mehr wagen – mehr Dialog
"Ich werde die Eindrücke in den Arbeitsalltag mitnehmen und Bürgerbeteiligung mehr realisieren!" – eines von vielen Abschluss-Statements nach einem Verwaltungsworkshop der Stadt Essen zum Thema "Standards zur Bürgerbeteiligung" im Oktober 2009. Ein Ergebnis dieses Workshops mit 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 24 Fachbereichen und städtischen Gesellschaften sind die "Grundsätze der Bürgerbeteiligung für die Stadt Essen", die im Juni 2010 vom Verwaltungsvorstand beschlossen wurden. Ein anderes Ergebnis ist eine aktive, wachsende Verwaltung-Arbeitsgruppe, die u.a. Arbeitshilfen für die Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen bei Bürgerbeteiligungsverfahren zusammenstellt.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2011 Mehr wissen – mehr wagen – mehr Dialog
Der Impuls, sich politisch in der lebendigen Demokratie zu engagieren, erfolgt sicherlich aus sehr unterschiedlichen Motivationen heraus. Aber der gemeinsame Nenner ist doch, teilzunehmen, Subjekt und nicht Objekt zu sein, Gutes zu bewirken. Dieser Impuls und diese Motivation muss in jedem und jeder stark sein, wenn man sich über einen längeren Zeitraum in diesem politischen und immer öffentlichen Umfeld bewegt. Und das natürlich gerade deswegen, weil man doch relativ schnell lernen muss, dass der "Fortschritt eine Schnecke ist" wie wir alle bei Günter Grass nachlesen konnten.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2011 Mehr wissen – mehr wagen – mehr Dialog
Vor vier Jahren hat der vhw durch die Neujustierung seiner Verbandsziele in dem von ihm wahrgenommenen Handlungsfeld Stadtentwicklung die Zivilgesellschaft in den Mittelpunkt seiner Bemühungen gestellt. Stadtentwicklungspolitischen Nutzen stiften heißt seither für den Verband, die Emanzipation der Bürgerinnen und Bürger im stadtentwicklungspolitischen Diskurs voranzubringen. Das Ziel seiner Arbeit ist ein neues Arrangement zwischen den Akteuren der Stadt, das den Bürger auf Augenhöhe mit den professionellen Akteuren der Stadtentwicklung bringt. Für den vhw ist eine erfolgreiche Umsetzung dieser Arbeit zugleich eine wesentliche Gelingensbedingung für ein zentrales Anliegen des Verbandes: die Stärkung der lokalen Demokratie.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2011 Mehr wissen – mehr wagen – mehr Dialog
In zwei Kongressvorträgen hatten Peter Rohland (vhw) und Prof. Dr. Hans J. Lietzmann (Bergische Universität Wuppertal) die ausgearbeiteten Ansätze des vhw zu den Dialogen im Städtenetzwerk vorgestellt. Nachfolgend boten fünf Dialogforen die Gelegenheit, zentrale Aspekte dieser Ansätze anhand der folgenden Leitfragen zu diskutieren: Wie kann man mittels Dialog "auf Augenhöhe" mehr lokale Demokratie wagen?Wer kann wie kommunalpolitische Themen auf die Tagesordnung setzen?Wie erreicht man alle Bürger und wie sollte man mit ihnen dauerhaft erfolgreich kommunizieren?Was bedeutet Kommunalpolitik mit "der Kraft des besseren Arguments"?Wie kommt man über den Dialog zu effizienten und legitimen Entscheidungen
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2011 Von der sozialen Stadt zur solidarischen Stadt
"Politische Kommunikation in der Bürgergesellschaft", bei diesem Thema geht es um Überlegungen zu Aufbau und Pflege einer neuen Kommunikations- und Beteiligungskultur. Gemeint ist damit nicht, woran reflexartig gedacht wird, wenn von Kultur die Rede ist: Kultur im Gegensatz zu Zivilisation. Kommunikations- und Beteiligungskultur meint nichts Harmonisierendes, keine Gemeinschaftstümelei, zielt nicht primär auf Einhegung und Konfliktkanalisierung. Kommunikations- und Beteiligungskultur ist verortet im Kontext von politischer Kultur. Im Gegensatz zum normativen Verständnis bezeichnen die Sozialwissenschaften politische Kultur als das Gesamt politisch relevanter Einstellungen, Werthaltungen und Verhaltensweisen in einem Gemeinwesen.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2012 Integrierte Stadtentwicklung und Bildung

Erschienen in Heft 3/2012 Integrierte Stadtentwicklung und Bildung
Kommunen stehen – mit unterschiedlichen Ausprägungen und Handlungsnotwendigkeiten – vor einer Reihe von Herausforderungen im Bildungsbereich. So sind beispielsweise die Infrastruktur an die demografische Entwicklung anzupassen, Hürden an Übergängen (Kita – Grundschule – weiterführende Schule – Ausbildung) zu bewältigen und Inklusion umzusetzen. Dabei sind die Rahmenbedingungen, wie beispielsweise die Überschuldung der öffentlichen Haushalte, sehr ähnlich. Für die Bewältigung dieser Aufgaben müssen neue Wege und Lösungen sowie neue veränderte Steuerungsansätze gefunden werden. Hierfür ist eine stimmige Vernetzung der vorhandenen Einrichtungen/Institutionen notwendig, Bildungsprozesse müssen über den gesamten Lebenslauf hinweg betrachtet und die notwendigen Bildungsangebote zur Verfügung gestellt werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2011 Neue Dialogkultur: Wir sprechen uns im Web 2.0
Das Internet ist in seiner Multimedialität die mächtigste Kommunikationsinfrastruktur, die die Menschheit jemals entwickelt und genutzt hat. E-Mail, Blogs und Soziale Netzwerke multiplizieren und beschleunigen unsere Kommunikation. In der Netzwerksgesellschaft (Castells 1996) verändern sich Kommunikation, Interaktion und Kollaboration, und es entstehen neue Herausforderungen für Partizipation, Planung und Politik. Das Netzwerk für urbane Kultur Urbanophil e.V. ist ein Netzwerk von jungen Stadtplanern, die sich über das Internet vernetzen, organisieren und agieren. Damit sind sie ein Teil einer neuen Öffentlichkeit, die Wegbereiter für neue Formen von Partizipation und Stadtentwicklung ist – die "digitalen Urbanisten". An drei Beispielen soll gezeigt werden, welche Auswirkungen dies für Stadtentwicklung zukünftig hat.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2011 Neue Dialogkultur: Wir sprechen uns im Web 2.0
Mit neuen Technologien verbinden sich nicht selten hochfliegende Erwartungen ebenso wie kulturkritische Untergangsszenarien. Das gilt auch für das Internet und vor allem für das Web 2.0. Sehen darin die einen die vorläufig letzte Stufe der Entfremdung des Menschen, so erhoffen sich die anderen einen technologischen Quantensprung für die Beteiligung des Menschen am gesellschaftlichen und politischen Leben. Der Beitrag refl ektiert die Chancen und Probleme des Web 2.0 als sogenanntes Mitmachmedium. Er verweist auf die Kommunikations- und Interaktionspotenziale und skizziert bisherige Erfahrungen in der Nutzung des Web 2.0 in Deutschland und darüber hinaus.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2011 Städtenetzwerk Lokale Demokratie
Muss man in Zeiten von Stuttgart 21 eigentlich noch erklären, warum man sich mit der Frage der Einbeziehung von Bürgern in politische Debatten und Entscheidungen beschäftigt? Wir denken ja – denn Stuttgart 21, die Hamburger Schulreform und was darüber hinaus an aktuellen Beispielen durch die Medien geht, sind alles Symptome und Anzeichen für einen tiefgehenden Prozess in unserer Gesellschaft. Die Rahmenbedingungen für unsere Demokratie haben sich ebenso verändert wie die Erwartungen der Bürger an politische Teilhabe. Immer weniger Menschen beteiligen sich an Wahlen oder sind bereit, sich in Parteien und Verbänden zu engagieren. Zur gleichen Zeit zeigen aber auch gerade diese Auseinandersetzungen, dass die Bürger Interesse an Politik haben und sie sich an politischen Entscheidungen beteiligen wollen. Unsere repräsentative Demokratie ist durch unterschiedliche Entwicklungen in den vergangenen Jahren unter Druck geraten – Entwicklungen, die eine Vitalisierung der Demokratie in Deutschland, eine Reaktion auf die veränderten Rahmenbedingungen, erforderlich machen.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2011 Von der sozialen Stadt zur solidarischen Stadt

Erschienen in Heft 4/2011 Neue Dialogkultur: Wir sprechen uns im Web 2.0

Erschienen in Heft 4/2011 Neue Dialogkultur: Wir sprechen uns im Web 2.0
Integration findet immer im konkreten Miteinander statt: vor Ort, in den Städten, Gemeinden und Quartieren. Der Nationale Aktionsplan ist eine Chance, die lokale Ebene von Integrationspolitik zu stärken und Integration als integriertes stadtentwicklungspolitisches Projekt zu konzipieren, über die Logik des Nebeneinanders einzelner Integrationsansätze hinaus. Er ist auch eine Chance, integrationspolitisch an den Potenzialen der Migranten anzusetzen, ihre Rolle als Mitgestalter und Koproduzenten von Stadt zu betonen und ihre Möglichkeiten für Partizipation, Mitbestimmung und Einbeziehung in Entscheidungen zu stärken.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2011 Städtenetzwerk Lokale Demokratie
Die Gesellschaft in Deutschland wird vielfältiger, älter, gebildeter. Mit dieser Entwicklung geht eine größere Interessenvielfalt und ein höherer Anspruch der Bürger einher, an der politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung auf kommunaler, regionaler und auch bundesweiter Ebene mitwirken zu wollen. Nicht erst seit Stuttgart 21 setzt sich vielerorts die Erkenntnis durch, dass sich diese Interessenvielfalt nicht mehr nach dem klassischen Muster mit einer Unterscheidung zwischen Arm und Reich oder Arbeiter- und Bürgertum abbilden lässt. Gleichzeitig setzt das bestehende Parteien- und Gremiensystem dem Anspruch der Bürger Grenzen, ihre vielfältigen Interessen und Ansprüche einbringen zu können.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2011 Städtenetzwerk Lokale Demokratie
Wie kommt ein Verband wie der vhw dazu, ein Städtenetzwerk zu initiieren, das mit seiner Arbeit einer bürgerorientierten integrierten Stadtentwicklung einen Beitrag zur Stärkung der lokalen Demokratie leisten will? Diese Frage lässt sich unschwer beantworten, wenn man das Handlungsfeld kennt, dem der vhw qua Satzung verpflichtet ist. Denn wer sich – wie der vhw – mit der Stadtentwicklung befasst, arbeitet in einem Handlungsraum, in dem der Diskurs über den vorgefundenen und erwünschten Zustand des Gemeinwesens idealiter geführt wird bzw. zu führen ist. Wer dann auch noch – wie der vhw – in der Diskussion über die Zukunft unserer Städte in der Emanzipation des Bürgers den erwünschten Zustand des Gemeinwesens sieht, für den heißt stadtentwicklungspolitischen Nutzen stiften, die Stadtgesellschaft in den Mittelpunkt seiner Bemühungen zu stellen.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2012 Stadtentwicklung und Sport
Die positiven Auswirkungen der Olympischen Sommerspiele auf die Stadtentwicklung Londons, die Auszeichnung mehrerer sportbezogener Wettbewerbsbeiträge im Rahmen des Nationalen Preises für integrierte Stadtentwicklung und Baukultur 2012 und die "sportlichen" Schwerpunkte der Internationalen Gartenschau 2013 in Hamburg sowie viele weitere Anlässe haben in der jüngeren Vergangenheit eine "neue" Sicht auf das Handlungsfeld Sport und die Sportvereine eröffnet. Sportvereine sind nicht mehr nur Deutschlands Sportanbieter Nr. 1, sondern bringen in vielen Handlungsfeldern der Stadtentwicklung ihre Potenziale zur Gestaltung politischer Herausforderungen aktiv ein.
Beiträge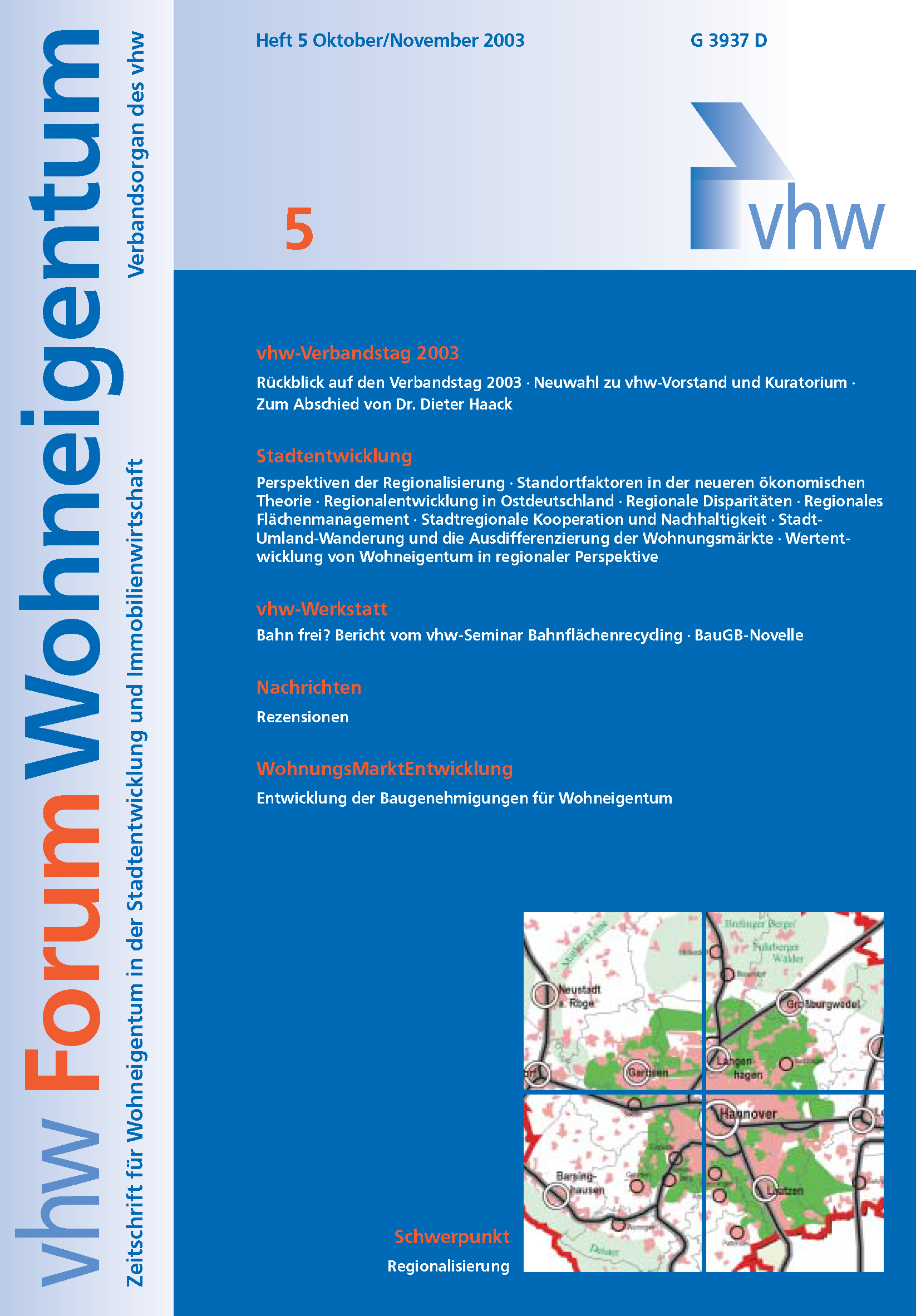
Erschienen in
Wie werden unsere Städte in 30 Jahren regiert und organisiert sein? Wird es sie in der heutigen Form noch geben oder werden wir ganz selbstverständlich in Stadtquartieren leben, die in Stadtregionen zusammengeschlossen sind? Kann diese oder eine möglicherweise ganz andere Zukunft vorausschauend in und von den Städten gestaltet werden und wie sehen die Spielräume und möglichen Entwicklungspfade aus? Keine leichten Überlegungen angesichts der bereits heute kaum lösbaren Probleme, denen Städte und Stadtregionen gegenüberstehen, und dennoch wichtige Fragen, die von den Beteiligten des Forschungsverbundes "Stadt 2030" aufgeworfen und bearbeitet werden.
Beiträge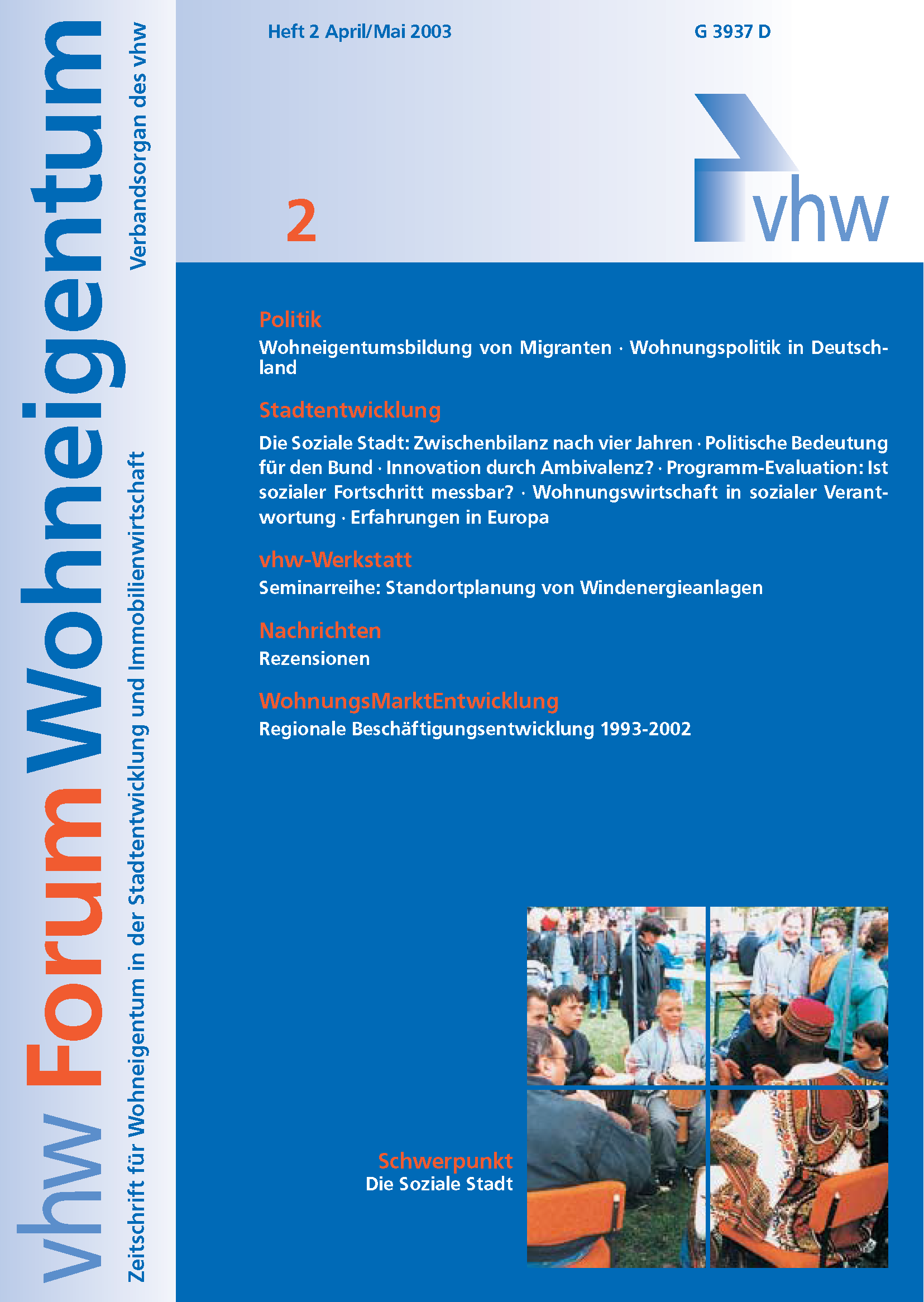
Erschienen in

Erschienen in Heft 1/2007 Soziale Stadt – Bildung und Integration

Erschienen in Heft 5/2006 vhw Verbandstag 2006; BauGB-Novelle

Erschienen in Heft 5/2015 Intermediäre in der Stadtentwicklung
Ist aktuell von Großstadtentwicklung die Rede, so wird meist erwähnt, dass seit ein paar Jahren weltweit die Hälfte aller Menschen in Städten leben würde. Doch hat dies mit Europa zu tun, wo der Urbanisierungsgrad bereits seit geraumer Weile zwischen 70% und 80% beträgt? Indirekt schon, weil den Herausforderungen des städtischen Wachstums erneut über den technologischen Wandel begegnet werden soll – und hier winken Wachstumsmärkte in der ‚green economy‘. Neben den Strategien des forcierten Wettbewerbs zwischen den urbanen Regionen wird dieses mit Bildern von gigantischen Hochhaus-Skylines, mit sechs- bis achtspurigen Stadtautobahnen, aber auch begrünten Fahrrad-Highways gezeigt. Wer Bilder der „Stadt der Zukunft“ sehen will, muss auf die Homepages von Audi, Siemens oder SAP schauen, während die Zukunft der Automobilität von Google und Apple bestimmt werden wird.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2014 Ländlicher Raum und demografischer Wandel
Kurz nach seinem Amtsantritt hat sich der neue Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) bereits zum Thema Landarztmangel geäußert. Er regt eine bevorzugt Studienplatzvergabe für junge Leute an, die sich bereit erklären, später eine Landarzttätigkeit auszuüben. Dies ist bei Weitem nicht die erste Initiative zur Sicherung der Hausarztversorgung auf dem Land. Vielfältige Initiativen und Maßnahmen wurden in den letzten Jahren ergriffen. Dies reicht vom Bemühen einzelner Bürgermeister, die Nachfolgersuche von abgebenden Hausärzten mit diversen Vergünstigungen zu unterstützen, über vielfältige Maßnahmen auf Landesebene und der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) bis hin zu gesetzgeberischen Veränderungen auf der Bundesebene. Bislang bleibt die Wirkung dieser Maßnahmen jedoch unbefriedigend.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2013 Perspektiven für eine gesellschaftliche Anerkennungskultur
Zum Verbandstag 2013 des vhw unter dem Motto "Vielfalt leben – Welche (Stadtentwicklungs-)Politik brauchen wir?" kamen am 14. November ca. 200 Gäste in die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften am Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte. Hintergrund der Thematik ist der für viele Beobachter unbestrittene Befund, dass zur Überwindung der auseinanderstrebenden Kräfte der Gesellschaft und des Vertrauensverlustes in die Politik eine neue Beteiligungs- und Kommunikationskultur als unverzichtbar gilt. Dies trifft insbesondere für die kommunale Ebene zu, wo sich die gesellschaftlichen Entwicklungen bündeln. So steht die weitere Ausdifferenzierung der Stadtgesellschaften in einem deutlichen Spannungsverhältnis zu den Zielen der sozialen Kohäsion der Gesellschaften – und damit letztlich auch zum Anliegen der Stärkung der lokalen Demokratie in der Stadtentwicklung. Die Veranstaltung wurde moderiert von Barbara Kostolik vom Bayerischen Rundfunk.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2013 Diversität und gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Stadt

Erschienen in Heft 5/2016 Kommunalpolitik zwischen Gestaltung und Moderation
Direkte Demokratie ist in aller Munde – nicht nur in Fragen der Stadtentwicklung. Das prominenteste Beispiel liefert derzeit die Brexit-Befragung in Großbritannien. Daran lassen sich viele Fragestellungen gut veranschaulichen. Warum wollen die Menschen mehr direkt entscheiden? Was versteht man unter direkter Demokratie überhaupt? Welche Chancen und Risiken bringt direkte Demokratie mit sich? Die moderne westliche Welt erlebt seit Mitte der sechziger Jahre einen Wertewandel. Dieser findet unter anderem seinen Ausdruck in einem verstärkten Bedürfnis nach persönlicher Autonomie und Unabhängigkeit sowie in dem gesteigerten Wunsch, bei persönlicher Betroffenheit mitentscheiden zu dürfen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2015 Intermediäre in der Stadtentwicklung
Wer wird bestreiten wollen, dass sich heute eine Vielzahl von unterschiedlichen Akteuren in der Kommunalpolitik bewegt, die gemeinsame Interessen und Anliegen ihrer jeweiligen Milieus und Bezugsgruppen formulieren, bündeln und in die politische Debatte einbringen? Ob Sprecherinnen einer Bürgerinitiative, Vorsitzende von Migrantenjugendorganisationen, die Koordinatorinnen eines Schülerhaushalts, „Kümmerer“ und „Stadtteilmütter“ im Quartier, Mitglieder einer Bürgerstiftung, Organisatorinnen von Flüchtlingsnothilfen oder junge Facebook-Aktivisten, die für eine TTIP-freie Kommune werben, sie alle sind heute Teil eines vielstimmigen Chors, der politisches Handeln – nicht nur – in den Kommunen bereichert, aber auch die Willensbildung zuweilen schwierig macht und die Ratsmitglieder gelegentlich überfordert.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2014 Lokale Bildungslandschaften

Erschienen in Heft 1/2014 Ländlicher Raum und demografischer Wandel

Erschienen in Heft 2/2013 Stadtentwicklung anderswo
Bereits der erste Teil des Berichts vom 6. Vergaberechtsforum in Heft 1/2013 dieser Zeitschrift hat gezeigt, dass das Vergaberecht von immer währender Dynamik geprägt ist. Die Teilnehmer der Veranstaltung am 13. und 14. Dezember 2012 in Bonn haben sich durch die Vorträge von insgesamt elf Referenten über die aktuellen Neuerungen im Vergaberecht und die aktuelle Rechtsprechung informieren können. Nach Berichten von Dr. Lutz Horn, Heinz-Peter Dicks, Norbert Portz und Hermann Summa folgt hier Teil 2 des Berichts vom Vergaberechtsforum des vhw zu den Themen "Rückforderung von Zuwendungen" (Dr. Florian Hartmann), "Rahmenbedingungen einer umweltfreundlichen und energieeffizienten Beschaffung" (Bernd Düsterdiek) sowie "Energiewende ohne Vergaberecht?" (Gerald Webeler).
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2016 Kultur und Stadtentwicklung
Welche Bedeutung hat Kultur für eine erfolgreiche Stadtteilentwicklung? Eine zentrale Rolle bei der Gestaltung von Stadtteilen haben insbesondere lokale Kultureinrichtungen. Hier werden Kreativität und kulturelle Nachhaltigkeit erkannt, gefördert und in ihrer unmittelbaren Lebensumwelt umgesetzt – wenn die Rahmenbedingungen es erlauben! Bewusstwerdung und Umsetzung hängen dabei elementar von Umfang und Art der Kommunikation und Kooperation lokaler Milieus, Szenen oder Netzwerke untereinander ab. Allein durch „postheroisches Management“, also ohne sozialtechnische Herrschaftsrhetorik und ohne eine Top-down-Eingreifmethodik (Baecker 1994) können kulturelle Institutionen dazu beitragen, durch die Bildung von Netzwerken kulturell-nachhaltige Stadtteile zu entwickeln. In diesem Beitrag soll deshalb die Schaffung eines kulturell nachhaltigen Netzwerkes aus dem Begriffsdreieck von Akteuren, Netzwerken und kulturell-kreativen Bedingungen beschrieben werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2015 Aus- und Weiterbildung in der Stadtentwicklung
Ob nun die Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt von 2007 oder die Positionspapiere der Fachkommission Stadtentwicklungsplanung vom Deutschen Städtetag oder andere in der Literatur befindlichen Leitfäden zur integrierten Stadtentwicklung – sie alle drücken im Grunde das Gleiche aus: Stadtentwicklung ist Gemeinschaftsaufgabe – und dies unter Einbeziehung von Politik, Verwaltung, Bürger und Wirtschaft. Wie sieht es jedoch in der Praxis aus? Im Alltag der Verwaltungswirklichkeit sieht es mehrheitlich so aus, das Planungsprozesse immer noch sektoral betrachtet werden und selten integriert gearbeitet, gehandelt und gelebt wird. Die ganzheitlichen Probleme der Stadtentwicklung werden dabei nur unzureichend wahrgenommen und bearbeitet, die kausalen Zusammenhänge auf andere Bereiche werden unterschätzt oder ausgeblendet. Wie kann diesen Prozessen nachhaltig entgegengewirkt werden – denn schließlich gibt es auch keine Förderprogramme, ohne dass ein integriertes Handlungskonzept vorgelegt wird.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2015 Aus- und Weiterbildung in der Stadtentwicklung
In diesem Erfahrungsbericht lässt die Autorin den Masterstudiengang Real Estate Management (REM), den sie im Zeitraum von 2008 bis 2011 an der TU Berlin absolvierte, Revue passieren. Nach zwanzig Jahren beruflicher Tätigkeit in der Stadterneuerung bei einem Sanierungsbeauftragten im Land Berlin bot sich ihr damit eine Möglichkeit, die komplexen Entscheidungsstrukturen und Entwicklungsprozesse in der heutigen Stadtplanung zu reflektieren und neue Impulse mitzunehmen. Die Berufspraxis zeigte, dass die städtebaulichen Strukturen und Qualitäten einem Spiegelbild von Interessen und Kräfteverhältnissen gleichen und das Ergebnis von Aushandlungsprozessen darstellen. Eine Auseinandersetzung mit privatwirtschaftlichen Akteuren wurde aber in den damaligen Ausbildungszusammenhängen nicht geleistet. Das Masterstudium REM bot die Chance, diese Lücke nachträglich zu schließen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2014 Kommunikationslandschaften
Lebendige Dörfer sind kommunikative Dörfer. Dorfgemeinschaften und Nachbarschaften funktionieren (noch) und organisieren Sorge füreinander – dies im Zusammenspiel von Nachbarschaft, Ehrenamt und öffentlicher Verantwortung. Kommunikation findet hierbei nicht im luftleeren Raum statt, sie verortet sich räumlich. In diesem Artikel soll daher der Blick auf die Kommunikationslandschaften in ländlichen Räumen geworfen und dargelegt werden, welche Anforderungen an die Weiterentwicklung von Kommunikationsgebäuden und Kommunikationsplätzen im Dorf bestehen. Ebenfalls beleuchtet wird, wie eine Kommunikationslandschaft mit Blick auf das Jahr 2030 aussehen sollte und welche Schritte dorthin in Dörfern unternommen werden können.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2016 E-Commerce und Stadtentwicklung

Erschienen in Heft 5/2014 Kommunikationslandschaften
Spätestens seit der Verabschiedung der Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt ist die Zivilgesellschaft in das Blickfeld der Stadtentwicklungspolitik geraten. Denn das in dieser Charta formulierte Leitbild der integrierten Stadtentwicklung fordert nicht nur eine Koordinierung zentraler städtischer Politikfelder in räumlicher, sachlicher und zeitlicher Hinsicht, sondern auch die Einbeziehung des zivilgesellschaftlichen Sektors und damit des Bürgers in den stadtentwicklungspolitischen Diskurs. Wer also mit diesem akteursübergreifenden Ansatz auf den Bürger als „Koproduzenten“ von Stadt setzt, der muss sich – so das Credo des vhw – um die Emanzipation des Bürgers in diesem Diskurs bemühen, d. h. die Stadtentwicklungspolitik nicht nur für, sondern von und mit dem Bürger gestalten wollen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2018 Zivilgesellschaft baut Stadt
Etwa 30 Experten aus acht europäischen Ländern trafen sich am 7./8. Juni auf Einladung des vhw in der Berliner Kalkscheune zu einem internationalen Workshop mit dem Titel „Förderung des sozialen Zusammenhaltes in vielfältigen Stadtquartieren“. Dabei entstand das vorliegende Interview mit Paul Scheffer, Soziologie-Professor und Migrationsforscher aus den Niederlanden und Verfasser des Buches „Die Eingewanderten. Toleranz in einer grenzenlosen Welt“ (Hanser 2008, 2016).
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2018 Gesundheit in der Stadt
Die vhw-Bundesrichtertagung zum Städtebaurecht hat Tradition. Und so versammelten sich am 4. Dezember 2017 im großen Saal des Kardinal-Schulte-Hauses rund 160 Gäste, um sich wieder aus erster Hand über die neuen höchstrichterlichen Entscheidungen zum Städtebaurecht zu unterrichten und diese mit den vier anwesenden Bundesrichtern zu diskutieren. Ausgewiesenen Baurechtsexperten ebenso wie Nichtjuristen wurde eine interessante Auswahl einschlägiger höchstrichterlicher Leitentscheidungen zum Städtebau-, Planungs- und Umweltrecht vorgestellt und rechtssichere Wege für die Anwendung des immer komplexer werdenden Rechtsgebiets aufgezeigt. Fragen aus dem Kreis der Teilnehmer waren ausdrücklich willkommen, und die Gäste haben hiervon gerne Gebrauch gemacht.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2019 Stadtentwicklung und Sport
Was tun Fußballfans, wenn sie sich in ihrem eigenen Verein nicht mehr zu Hause fühlen? Als Fans können sie nicht einfach den Verein wechseln – also einfach gar nicht mehr ins Stadion gehen? Eine weitere Möglichkeit ist es, einen eigenen neuen Verein zu gründen. So geschehen beim Hamburger Fußball Club (HFC) Falke e.V.. Hier haben (ehemalige) Fans des HSV 2014 ihren eigenen Verein gegründet, der 2015 seinen Spielbetrieb in der untersten Amateurliga aufnahm. Um diesen Verein besser zu verstehen, wurde er ethnografisch untersucht. Ein Ausschnitt der Ergebnisse dieser Forschung soll hier vorgestellt werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2019 Stadtentwicklung und Sport
Mit Bewegung und Sport kommen viele Fachbereiche einer Kommunalverwaltung in Berührung – das Sportamt, das Grünflächenamt, das Gebäudemanagement, der Sozialbereich, das Gesundheitsamt oder die Stadtplanung. Jedoch gibt es in Deutschland bisher wenig Städte, die Bewegung und Sport als Querschnittsthema auffassen und eine ganzheitliche Strategie hierzu entwickeln. Ein Blick nach Großbritannien und dessen Konzept "Active Design" könnte hier einen wichtigen Beitrag leisten.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2019 Stadtentwicklung und Sport
Die Sportlandschaft in Deutschland, speziell in den Metropolen und Ballungsräumen, hat sich in den letzten Jahrzehnten dynamisch verändert. Längst existieren vielfältige Erscheinungsformen von Sport, die sich in sozialer, zeitlicher und räumlicher Hinsicht aufeinander beziehen, überlagern und auch konkurrenziell begegnen. Aus sportsoziologischer Perspektive werden im Folgenden verschiedene Erscheinungsformen von Sport dargestellt und vor diesem Hintergrund exemplarische Fragestellungen im Hinblick auf Sport- und Bewegungsräume in der modernen Stadtgesellschaft angedeutet.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2019 Digitale Verwaltung
Die Digitalisierung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft schreitet mit großer Geschwindigkeit voran. Digital geht nicht mehr weg – die Digitalisierung hat Städte und Gemeinden längst erreicht und wird immer schneller. Die Zukunft der Kommunen ist digital – noch digitaler als bisher. Es gibt nur noch wenige Modernisierungs- und Veränderungsprojekte in der Kommunalverwaltung, die keinen IT-Bezug und damit eine digitale Grundlage haben. Sowohl die technische als auch die organisatorische Unterstützung derartiger Projekte steht im Mittelpunkt vieler Vorhaben mit der Fragestellung, wie können Verwaltungen ihre Leistungen und die damit verbundenen Prozesse effektiver und effizienter gestalten sowie nachhaltiger handeln.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2019 Digitale Verwaltung
Die digitale Revolution ist in Wirkungskette und Ausmaß ähnlich wie die industrielle Revolution. Sie wird als tiefgreifende und dauerhafte Umgestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, Arbeitsbedingungen und Lebensumstände durch Digitaltechniken, Computer und Internet bezeichnet. Welche Auswirkungen dieser Umgestaltungsprozess auf die Verwaltungen Deutschlands hat, erleben alle Angestellten des öffentlichen Dienstes und Beamte hautnah. Wie gelingt es nun, Gestalter und nicht nur „Reaktionist“ des Umgestaltungsprozesses zu sein?
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2019 Digitale Verwaltung
So richtig geklappt hat es bisher nicht, mit der deutschen "Staatsdigitalisierung". Zwar existieren durchaus positive Insel-Lösungen, von einer flächendeckenden digitalen Verwaltung mit nutzerfreundlichen Services "nach außen" kann aber bisher keine Rede sein. Während die internen Prozesse und behördlichen Fachverfahren vielerorts effizient laufen, gibt es in der Interaktion mit Bürgern, Unternehmen und anderen Behörden noch viele "Sollbruchstellen", die einen durchgängigen digitalen Fluss von Daten und Dokumenten behindern. Das soll sich mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) nun ändern. Es ist nicht das erste Mal, dass der Staat hierzulande „den großen Wurf“ plant, um die öffentliche Verwaltung zu modernisieren. Es könnte aber das erste Mal sein, dass damit tatsächlich ein Kulturwandel seinen Anfang nimmt.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2019 Child in the City
Der derzeitige Trend zur Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung hat besonders den Verkehrssektor erfasst. Mit den neuen Technologien wird sich auch unsere Mobilität nachhaltig verändern und neue Herausforderungen für die Mobilitätsbildung und Verkehrssicherheitsarbeit mit sich bringen. Hier knüpft das Projekt Mobility 360°: Citizens of the Future an, welches sich an Schüler von der Volksschule bis hin zur Oberstufe richtet. Im Rahmen des Projekts wurde ein innovatives Workshopkonzept unter Einsatz von Methoden des Game-Based Learning, Geodesign sowie 360° Technologien entwickelt und erprobt. In den modularen Unterrichtseinheiten setzen sich die Kinder und Jugendlichen mit Mobilität und Verkehrssicherheit auseinander und schlüpfen selbst in die Rolle von Mobilitätsforschern. So sollen unter anderem auch ihre Bedürfnisse bezüglich jetziger und zukünftiger Mobilität sichtbar gemacht werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2019 Stadtentwicklung und Klimawandel
Möchte man erfassen, welche Haltungen die deutsche Bevölkerung zu Klimawandel und Klimaschutz einnimmt, sind diese nicht isoliert zu betrachten, sondern als integrales Element im Gesamtkontext der Umwelt- und Naturwahrnehmung zu verstehen. Innerhalb dieses Rahmens ist Klimawandel dabei aus Perspektive der Bevölkerung insbesondere an die Themenfelder Ressourcenverbrauch, Energie, Mobilität und biologische Vielfalt gekoppelt. Damit schlägt das Thema Klimawandel auch eine Brücke zu aktuellen Fragen der Stadtentwicklung, da das Verhältnis von Stadt und Natur aktuell einem grundlegenden Wandel unterworfen ist.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2019 Vertrauen in der Stadtgesellschaft
Derzeit wird viel über die Bedeutung von Vertrauen im politischen Prozess und noch mehr von einem Vertrauensschwund gegenüber der Politik sowie den Politikern und Politikerinnen gesprochen. Was ist da los? Und was soll uns daran zu denken geben? Der Aufsatz spürt diesen Fragen nach. Er spricht sich gegen schnelle und pauschale Krisendiagnosen aus und fordert dazu auf, die Erwartungen an die Bedeutung von Vertrauen im politischen Geschäft herunterzudimmen. Denn einige Vertrauenserwartungen werden in einer pluralistischen und komplexen Demokratie immer enttäuscht werden, weil sich im politischen Alltag unterschiedliche Vertrauensdimensionen überlagern, die nicht gleichzeitig einlösbar sind. Zum Paket der Demokratie gehören auch enttäuschte Erwartungen im Einzelfall und institutionalisiertes Misstrauen.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2019 Child in the City