
Erschienen in

Erschienen in
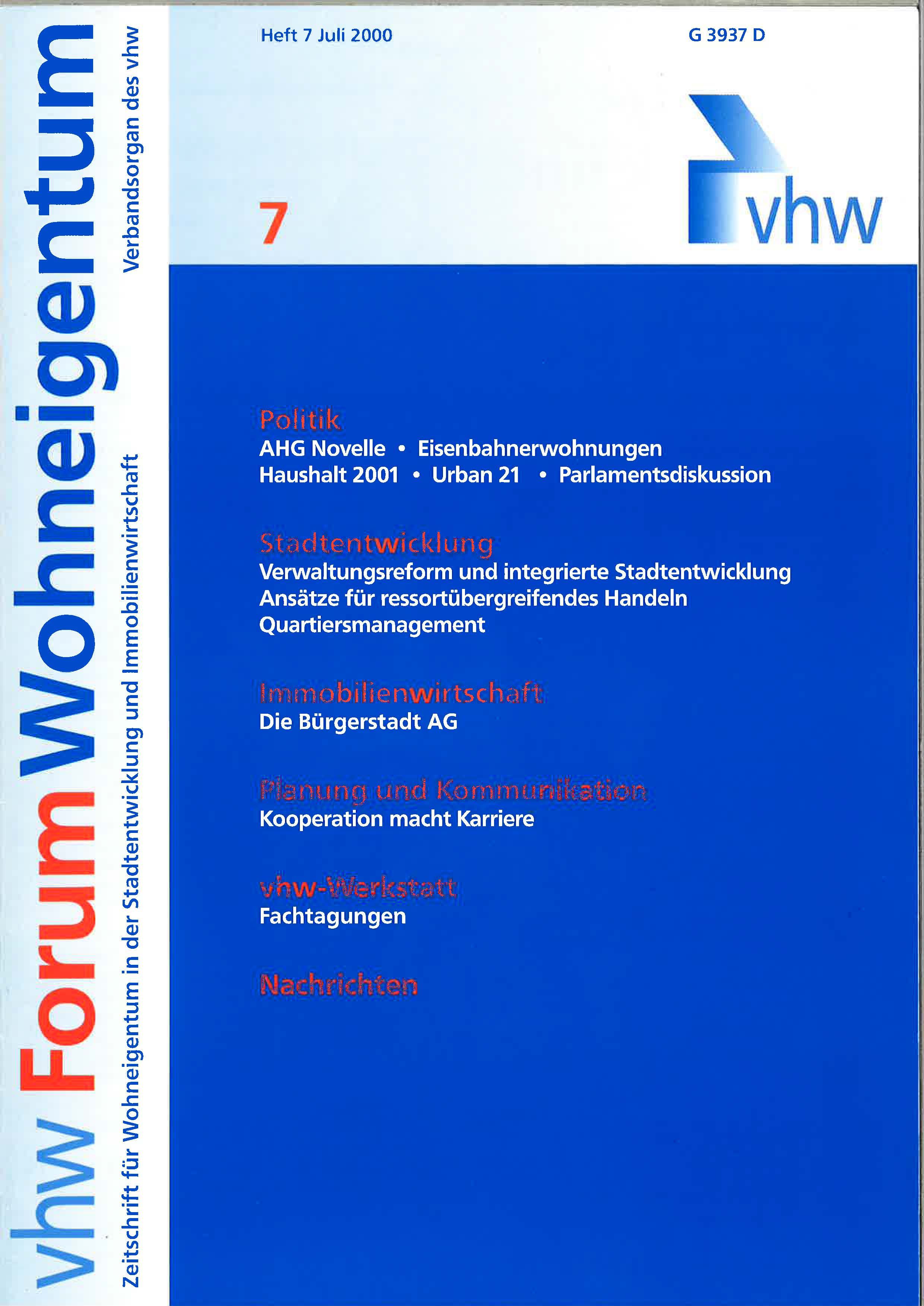
Erschienen in
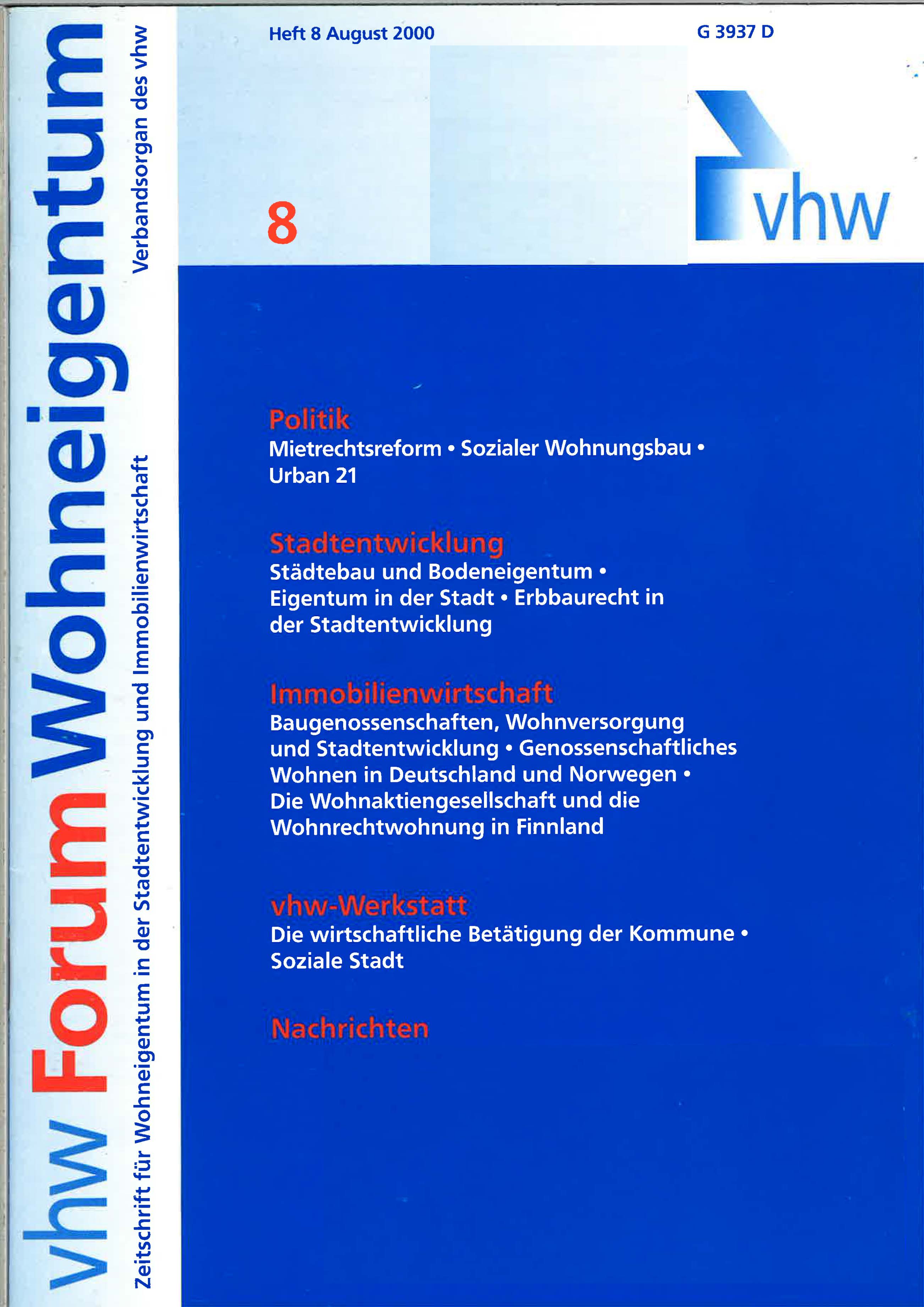
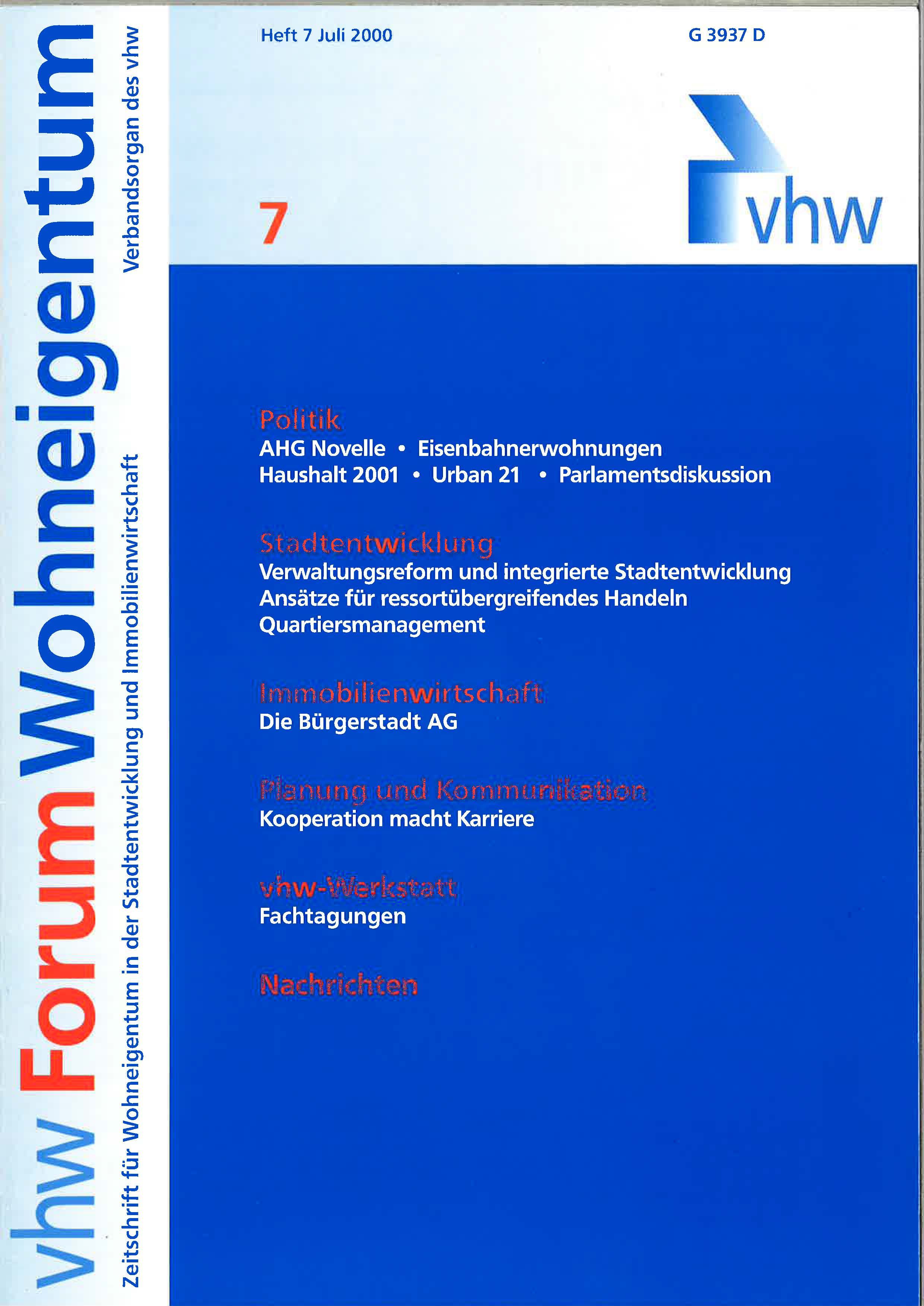

Erschienen in Heft 4/2017 Gemeinwesenarbeit und Stadtentwicklung
Stadtteilarbeit, Sozialraumorientierung, Quartiersmanagement – das sind letztlich Varianten von Gemeinwesenarbeit, einem Konzept der Sozialen Arbeit (und darüber hinaus) "in unterschiedlichen Ausprägungen". Wenn man die Geschichte der Gemeinwesenarbeit (GWA) verfolgt, versteht man auch ihre Entwicklung und Differenzierung abhängig von den jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen. Es begann am Ende des 19. Jahrhunderts in England: Junge Akademiker überschritten die Grenzen der Universität, um aus humanitären und religiösen Motiven mit den Menschen in Arbeitervierteln zu leben und zu arbeiten. Es entstanden die Settlements als sozialkulturelle Zentren mit Bildungsangeboten und nachbarschaftlicher Hilfe. Großer Wert wurde auf die Eigentätigkeit der Menschen gelegt.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2016 Fluchtort Kommune
Zum zweiten Mal seit 2014 fand am 22. Juni 2016 die Preisverleihung im Wettbewerb Preis Soziale Stadt im Berliner Radialsystem statt und wieder hatten die Organisatoren Glück mit dem Wetter, so dass die rund 300 Teilnehmer noch lange nach der Veranstaltung am Ufer der Spree zusammensitzen konnten. Vorher hatten sie eine Preisverleihung erlebt, in der erstmals Preise in sechs Kategorien vergeben wurden. Insgesamt waren 18 Projekte aus ganz Deutschland nominiert, die mit ihren Vertretern nach Berlin angereist waren. Diese wurden zusammen mit den zahlreichen Gästen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft von den beiden Moderatoren Dr. Diana Coulmas vom vhw und Dr. Bernd Hunger vom GdW in gewohnt lockerer Atmosphäre durch die Veranstaltung geführt.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2016 Fluchtort Kommune

Erschienen in Heft 4/2016 Fluchtort Kommune
Nach der Auseinandersetzung mit einer repräsentativen Rathausmitte und zentralen Foren z. B. für Kultur und Bildung drängt sich die Frage auf, ob sich nicht in den verschiedenen Stadtteilen bis hin in die weiter entfernten Rand-Quartiere ebenfalls besondere Bürgerzentren befinden müssten. Nach allem was wir in diesen dramatischen Zeiten über Gesellschaft und Städtebau lernen, kann man darauf nur mit einem klaren Ja antworten. Neben den Stadtteilen mit ihren angestammten Wohnquartieren geraten die Vorstadt-Wohnsiedlungen bei der Integrationsdebatte wieder in den Fokus. Besonders zeigt sich das bei den Banlieues um Paris. Was nützt eine strahlende und stolze Mitte, wenn es in vielen Vororten aufgrund von krassen Integrationsdefiziten rumort oder gar brennt?
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2016 Fluchtort Kommune

Erschienen in Heft 4/2016 Fluchtort Kommune
Die Integrationsdebatte, die sich aus der starken Flüchtlingszuwanderung im Jahr 2015 entwickelt hat, ist nur die jüngste Variante der seit langem andauernden Diskurse, die u.a. über Urbanität und das Fremde (vgl. Simmel 1903, Siebel 1998), Binnenintegration (z.B. Elwert 1982), soziale Mischung (z.B. Wirth 1964) oder soziale Kohäsion und Sozialkapital (z.B. Forrest und Kearns 2001) geführt werden. Während die Moderne von der bisweilen ideologisch geführten Diskussion darüber geprägt war, inwieweit sich Zuwanderer schnell individuell anpassen (assimilieren) müssten (etwa Esser 2003) oder verschiedene Gruppen mit- und nebeneinander die Gesellschaft prägen könnten („Multikulti“), treten an diese Stelle in der globalisierten Postmoderne neuere Konzepte: Dazu gehören z.B. Ansätze der Inklusion (vgl. Luhmann 1995), der Interkultur (Terkessidis 2010) und die im Kontext neuer internationaler Migration entstehenden transnationalen Identitäten (Pries 2003).
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2016 Fluchtort Kommune
Wie in vielen deutschen Städten erfordert auch in Essen die aktuelle und zukünftige Flüchtlingssituation die zügige Umsetzung verschiedener Ansätze zur Integration von geflüchteten Menschen. Flüchtlinge, die Asyl erhalten und in Essen leben und arbeiten werden, sollen sich in ihrer neuen Wahlheimat schnell zuhause fühlen. Zahlreiche Akteure aus Verwaltung, Wohnungsbaugesellschaften, gemeinnützigen Organisationen, Freiwilligenagenturen und Verbänden unterstützen das Ankommen der neuen Mitbewohner. Eine tragende Rolle spielt darüber hinaus das Engagement ehrenamtlich tätiger Mitbürger. Die Ehrenamt Agentur Essen e.V. reflektiert ihre Erfahrungen mit Ehrenamtlichen, Flüchtlingen, weiteren Freiwilligenagenturen, der bagfa (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen) und FOCO e. V. (Forum für Community Organizing) zur Bedeutung des Engagements in der Flüchtlingshilfe.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2016 Fluchtort Kommune
Flüchtlinge aus Syrien, Irak und Ägypten haben als Bürgerkriegsflüchtlinge eine realistische Perspektive auf ein Bleiberecht in Deutschland und können in Essen relativ schnell in Privatwohnungen ziehen. Familien in Privatwohnungen werden im ersten Jahr nach Einzug von den Flüchtlingsverbänden betreut und unterstützt. Dennoch ist in dieser ersten Phase am Wohnort vieles fremd. Für Flüchtlinge ist es nicht leicht, sich in der neuen Umgebung zu Recht zu finden, in der neuen Nachbarschaft, im Stadtteil, bei verschiedenen Behörden. Die Flüchtlinge haben häufig Verständigungsprobleme, bis sie die deutsche Sprache und Schrift beherrschen, sie kennen nicht alle Möglichkeiten und Wege, sich Unterstützung in ihrer schwierigen Lebenssituation zu verschaffen, leben oft aufgrund der fehlenden Sprachkenntnisse isoliert von ihrer Umgebung, sind zunächst erwerbslos.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2016 Fluchtort Kommune
Seit dem 1. Januar 2015 haben ca. 15.400 Menschen auf der Flucht aus ihren Heimatländern in Essen Zuflucht gefunden. Sie sind anerkannt als Asylbewerber, haben subsidiären Schutz zuerkannt bekommen oder befinden sich noch im Asylverfahren. Davon leben zum Stichtag 1.6.2016 ca. 10.000 Menschen in Wohnungen; sie haben eine langfristige Bleibeperspektive oder sind bereits anerkannt. Ca. 5.400 Menschen leben in Unterkünften (davon ca. 2.800 in Zeltstädten). Die größte Gruppe sind syrische Staatsbürger (ca. 8.000), gefolgt von Irak, Iran, Afghanistan. In den letzten Monaten ist vermehrt der Zuzug insbesondere von syrischen Familien aus anderen Kommunen nach Essen festzustellen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2016 Fluchtort Kommune
Wenige Themen dominieren seit dem Sommer 2015 den öffentlichen Diskurs in Deutschland im Allgemeinen und auch speziell die Diskussion an den Schulen und Hochschulen des Landes wie die Aspekte Flucht und Vertreibung. Gemeinsam ist das Bewusstsein, dass die Integration einer so hohen Zahl an geflüchteten Menschen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellt, bei der auch und insbesondere dem Bildungssektor im Sinne des lebenslangen Lernens eine essenzielle Rolle zukommt. Viele Hochschulen haben schnell auf die Situation reagiert, entsprechende Anlaufstellen geschaffen und Programme und Maßnahmen initiiert (im Überblick z.B. Schamman/Younso 2016).
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2016 Fluchtort Kommune
Seit 30 Jahren lebe ich im Stadtteil Altenessen, einem der nördlichen Bezirke in der Revierstadt Essen. Ich bin diesem Stadtteil beruflich und persönlich verbunden: Als Pfarrer habe ich 17 Jahre lang die Möglichkeit gehabt, viele Menschen im Stadtteil persönlich kennenzulernen. Ich hatte die sonst nicht so oft gegebene Gelegenheit, die Menschen in ihren Häusern und Wohnungen zu besuchen. Ich habe bei Taufgesprächen und Trauerbesuchen erfahren, wie stolz viele Menschen auf „ihren“ Stadtteil sind: Die Bergbautradition ist vor allem bei den älteren Menschen lebendig. Ich habe Menschen kennengelernt, die schon seit Generationen hier wohnen und nicht weg wollen. Aber auch die anderen sind mir begegnet: Sie wollen weg aus dem Stadtteil, der mit so vielen sozialen Problemen belastet ist. Ich habe auch die Armut mancher Familien bei Besuchen deutlich mitbekommen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2016 Fluchtort Kommune
Beschleunigte Entwicklungen – beispielsweise vom Beginn einer gelebten Willkommenskultur im Spätherbst 2015 hin zu einer verallgemeinernden Skepsis gegenüber Asylsuchenden nach den Vorfällen der Silvesternacht in Köln oder auch die Schließungen europäischer Grenzen und damit der Balkanroute, Vorstöße zu Gesetzesänderungen und Obergrenzen oder die Kooperation mit der Türkei – kennzeichnen die dynamische Situation rund um das Thema Migration und Flucht nach Europa der letzten Monate. Nach den teilweise chaotischen Zuständen rund um Registrierung und Erstversorgung reüssiert jetzt das Thema Integration, insbesondere in den kommunalen Bezügen. Zunehmend wird die Ankunft der vor Krieg oder Verarmung fliehenden Menschen in den Städten und Gemeinden, mithin in den Essener Quartieren sicht- und erlebbar. Dabei werden häufig die Kommunen im Ruhrgebiet von Geflüchteten als Wohnort ausgewählt, weil sie dort bereits auf bestehende Communities treffen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2016 Fluchtort Kommune
Die Stadt Mülheim an der Ruhr und das kommunale Wohnungsunternehmen SWB-Service-Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH setzen gemeinsam mit sozialen Akteuren auf eine angemessene Unterbringung von Flüchtlingen. Hier befördern die Beteiligten durch frühzeitiges Zugehen und Sensibilisieren der Nachbarschaft Integration durch Akzeptanz, begreifen Zuwanderung als Chance und sehen Flüchtlinge als Bereicherung der Nachbarschaft an. Dabei ist dies die Arbeit ganz vieler Mitarbeiter, Akteure, Partner und ehrenamtlich tätiger Bürger, die sich jeden Tag aufs Neue engagieren, ihre Aufgabe mit Leben füllen und sich für ein soziales Miteinander einsetzen.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2014 Lokale Bildungslandschaften

Erschienen in Heft 3/2014 Lokale Bildungslandschaften
Friedhöfe sind besondere städtische Orte. Doch sie unterliegen einem Wandel, der auf demografische Entwicklungen sowie den gesellschaftlichen Wertewandel zurückzuführen ist. Es entstehen Flächenüberhänge, die aufgrund ihrer Lage und Vielfältigkeit bedeutsam für den städtischen Raum sind. Friedhofsentwicklungspläne sollen die ökonomischen Herausforderungen für die Friedhofsträger lösen und ggf. nicht mehr benötigte Friedhofsflächen einer neuen Nutzung zuführen. Die Umnutzungen von Friedhofsüberhangflächen stellen ein neues Aufgabenfeld für die Stadtentwicklung dar. Im Folgenden werden am Beispiel der Stadt Berlin Anforderungen an einen Friedhofsentwicklungsplan analysiert und Nachnutzungsmöglichkeiten diskutiert.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2014 Lokale Bildungslandschaften
Im Jahr 2006 initiierten heutige Vorstandsmitglieder des Vereins Stadt als Campus e. V. im Zusammenwirken mit der Schader-Stiftung die Verbändeinitiative ZUHAUSE IN DER STADT. Grundgedanke war, im Rahmen der Nationalen Stadtentwicklungspolitik eine nachhaltige Kooperation der etablierten stadtgestaltenden Akteure zum "gemeinsamen Stadtmachen" zu kultivieren. Nach impulsgebenden Statuskonferenzen und Campus-Foren mit den für die Stadtentwicklung relevanten Fach- und Berufsverbänden und Kammern wurde die Initiative 2008 zum offiziellen Partner der Nationalen Stadtentwicklungspolitik (NSP). In dieser Funktion haben die Mitglieder unter Moderation von Sabine Süß, damals geschäftsführender Vorstand der Schader-Stiftung, im Ergebnis eines intensiven Diskussionsprozesses im Sommer 2009 Orientierungen für eine integrierte Stadtentwicklung herausgegeben, die noch heute gültig sind.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2014 Lokale Bildungslandschaften
Im Jahr 2010 begann die inhaltliche und konzeptionelle Zusammenarbeit der Stadt Karlsruhe mit dem vhw. Die Mitarbeit im Städtenetz des vhw ist deshalb sehr wichtig, weil der Bereich Bildung für die Stadt Karlsruhe einen äußerst hohen Stellenwert hat. Durch die Verzahnung der Bereiche "Bildung" und "Betreuung" soll ein bestmöglicher Verlauf der Bildungsbiografien der Schulkinder erreicht werden. Ein Ziel der Zusammenarbeit ist es u. a. die Bildungsplanung durch die Komponente der Quartiersentwicklung zu ergänzen. Die Vereinbarung mit dem vhw hat das Ziel, die eigenen Ansätze zur stadtteilorientierten Schulentwicklung durch die Einbeziehung ihrer stadtgesellschaftlichen Milieus zu erweitern.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2014 Lokale Bildungslandschaften

Erschienen in Heft 3/2014 Lokale Bildungslandschaften
Die Mannheimer Neckarschule im Stadtteil Neckarstadt-West steht im folgenden Artikel exemplarisch für viele formale Bildungseinrichtungen. Ein kontinuierlich wachsender Anteil der deutschen Bildungseinrichtungen sieht sich bei immer knapper werdenden finanziellen Ressourcen und einem steigenden Mangel an Fachpersonal mit einem immer größeren und komplexeren Aufgabenspektrum konfrontiert. Den Schulen in Quartieren, deren Bewohner überwiegend Migrationshintergrund haben bzw. Ausländer sind bei einem überproportional hohen Anteil an Transferleistungsempfängern, wird eine zentrale Rolle im Hinblick auf das Gelingen von Integrationsprozessen zugewiesen. Diese zusätzliche Aufgabe erschwert jedoch in erheblichem Maße den Regelbetrieb der Bildungsinstitutionen.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2014 Lokale Bildungslandschaften
"Den Stummen eine Stimme geben" – das ist im stadtentwicklungspolitischen Diskurs ein zentrales Anliegen, welches der vhw bei der Umsetzung des Städtenetzwerks "Stärkung lokaler Demokratie durch bürgerorientierte integrierte Stadtentwicklung" verfolgt. Wesentliches Ziel ist es, bei der Durchführung von Dialogen und Beteiligungsprozessen die Vielfalt der Stadtgesellschaft nicht nur quantitativ abzubilden, sondern die Bedürfnisse, Anliegen und Sorgen in all ihren Facetten aufzugreifen und in den stadtentwicklungspolitischen Diskurs einfließen zu lassen. Mit Hilfe von Akteurs- und Netzwerkanalyse, zielgruppengerechter Ansprache und Interviewtechniken (Grundlage hierfür ist das Instrument der Milieus und der durch den vhw erstellte Milieusurvey) soll dabei sichergestellt werden, dass sich die Diversität der Stadtgesellschaft qualitativ in der Beteiligungsstruktur widerspiegelt.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2014 Lokale Bildungslandschaften
In sozial benachteiligten und strukturschwachen Stadtteilen bestehen vielfach noch unzureichende Bildungschancen für Kinder und Jugendliche. Mit dem ExWoSt-Forschungsfeld "Orte der Integration im Quartier" wurden diese Anforderungen aufgegriffen und Lösungsansätze in bundesweit acht Modellvorhaben praktisch erprobt. Das Forschungsfeld wird im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) mit einer Laufzeit von drei Jahren durchgeführt. Seit Herbst 2011 wird es von empirica als Forschungsassistenz begleitet.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2014 Lokale Bildungslandschaften
Mit dem anhaltenden Strukturwandel zerfallen die Städte zusehends in Teilstädte: Migrationshintergrund, Religion und ethnische Herkunft, die Verteilungswirkungen von Wohnungsmarkt und -politik, die Verfestigung von Armut und Arbeitslosigkeit und die Herausbildung einer ‚new urban underclass’ prägen zunehmend die räumliche Struktur der Stadt und das Bild einzelner Quartiere. Bei der Entstehung benachteiligender Quartiere spielen nicht zuletzt die Schulen eine wichtige Rolle: Wie wir seit PISA wissen, sind in Deutschland Bildungserwerb und Schulerfolg – und damit auch die weiteren Lebenschancen – stärker als anderswo an die soziale Herkunft gekoppelt. Und soziale Herkunft bedeutet eben nicht nur die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schicht oder Ethnie, sondern auch die Herkunft aus einem bestimmten Wohnviertel.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2014 Lokale Bildungslandschaften
"Sie sprechen schlecht deutsch, sind bildungsunwillig und werden von ihren Eltern zu wenig gefördert", so das pauschale Urteil, mit dem die fehlenden Bildungserfolge von jungen Migranten im öffentlichen Diskurs vielfach begründet werden. Auch die Bildungsforschung befasst sich vornehmlich mit der defizitären Bildungspartizipation junger Migranten (vgl. z. B. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2012). In Abgrenzung zu den vorherrschenden defizitorientierten Forschungsansätzen untersucht das Projekt "Bildung, Milieu und Migration" vor allem, welche Chancen und Ressourcen speziell Menschen mit Migrationshintergrund mitbringen – etwa aufgrund ihrer Mehrsprachigkeit, hoher Bildungsambitionen, ausgeprägter Leistungsorientierung oder ihrer Flexibilität und Frustrationstoleranz.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2016 E-Commerce und Stadtentwicklung
Die Steuerung und Genehmigung von Windenergieanlagen (WEA) richtet sich in zahlreichen Bundesländern nicht mehr nach dem Regionalplan, sondern nur noch nach den gesetzlichen Vorgaben des Bauleitplanungsrechts und des Immissionsschutzrechts. Als Konsequenz hieraus sind grundsätzlich im gesamten unbeplanten Außenbereich einer Kommune auf windhöffigen Flächen WEA zulässig, die im Schwarzwald in der Regel als Windfarmen mit bis zu fünf WEA errichtet werden. Der Ausbau der Windenergienutzung ist teilweise mit einem multipolaren Konfliktpotenzial verbunden. Der vorliegende Beitrag zeigt sowohl das Konfliktpotenzial anhand eines aktuellen Beispielfalles auf als auch die Möglichkeit der Konfliktprävention durch den Einsatz der Mediation bei der Planung, Genehmigung und dem Betrieb von Windenergieanlagen.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2016 E-Commerce und Stadtentwicklung
Die wachsende Nachfrage nach innerstädtischem Wohnraum hält europaweit an. Zugleich ist die führende europäische Stadtentwicklungsstrategie der baulichen Nachverdichtung gescheitert. Stadtentwicklung findet heute im hochpreisigen Wohnsegment statt. Die letzten Baulücken werden zeitnah erschlossen sein, der ökologische Treibstoff der Stadt geht damit zuneige. Die bisherigen Konzepte europäischer Stadtplanung greifen zu kurz: Weder Suburbanisierung noch Nachverdichtung befriedigen die neuen Wohnbedürfnisse. Menschen verbinden mit urbanem Leben vor allem innerstädtisches Wohnen, den Puls, den Trubel, die Dynamik des Stadttreibens. Nicht grundlos fahren die meisten Menschen lediglich durch Vororte. Das Erschließen von Baulücken und Brachen hingegen gleicht dem Bild einer planerischen Einbahnstraße oder genauer: einer Sackgasse.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2016 E-Commerce und Stadtentwicklung
Im Rahmen des Verbandstages 2015 in Berlin berief die Mitgliederversammlung am 12. November 2015 die vhw-Gremien neu. Der Verbandsrat besteht aus vierzehn Mitgliedern, drei Mitglieder sind ausgeschieden, frei neue Vertreter wurden in den Verbandsrat gewählt. Dem Gremium mit seinen ehrenamtlichen Mitgliedern obliegen u. a. die Beratung und Aufsicht des Vorstandes. Im Kuratorium des vhw sind aktuell 48 Personen, neu wurden neunzehn Mitglieder gewählt, sechzehn Mitglieder sind ausgeschieden. Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus fünf Personen, zwei sind ausgeschieden, dafür wurden zwei neue Mitglieder in den Rechnungsprüfungsausschuss gewählt. Darüber hinaus hat die Mitgliederversammlung Frau Prof. Christiane Thalgott zum Ehrenmitglied des Verbandes berufen. Frau Thalgott war von 2003 bis 2015 Mitglied des vhw-Vorstandes bzw. des Verbandsrates. Gemäß der Satzung des vhw wurden Verbandsrat, Kuratorium und Rechnungsprüfungsausschuss für die Dauer von drei Jahren gewählt.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2016 E-Commerce und Stadtentwicklung

Erschienen in Heft 1/2016 E-Commerce und Stadtentwicklung
Warenhäuser stehen seit einigen Jahrzehnten unter einem erheblichen Wettbewerbsdruck. Die Anteile am Einzelhandelsumsatz sinken kontinuierlich und dementsprechend mussten viele Häuser schließen und sogar einige Konzerne aufgeben. Wegen der großen Bedeutung für die Entwicklung der städtischen Zentren ist diese Problematik auch stets Gegenstand politischer und planerischer Diskussionen gewesen. Um die aktuellen Tendenzen und die Zukunftsfähigkeit der Warenhäuser besser einordnen zu können, lohnt sich zunächst ein Blick auf die Entstehung und Entwicklung dieser besonderen Betriebsform und Handelsarchitektur. Der nachstehende Aufsatz geht auch auf die derzeitigen Entwicklungen ein und betrachtet zudem die Rolle der Städte in den zu beobachtenden Umstrukturierungsprozessen.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2016 E-Commerce und Stadtentwicklung
Das Online-Shopping ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Käufer- und Umsatzzahlen sind in den letzten fünfzehn Jahren förmlich „explodiert“ und ein Ende der Entwicklung ist nicht abzusehen – weder national noch international. 2015 lag der Anteil des Online-Handels am gesamten Handelsvolumen in Deutschland bereits bei 10%; fast zwei Drittel der befragten Deutschen hatten 2015 in den letzten drei Monaten einen Online-Kauf getätigt. Die Pro-Kopf-Ausgaben für das Online-Shopping lagen 2014 bei 532 Euro, der Gesamtumsatz bei 42,9 Mrd. Euro, ein Zuwachs von 25% in Jahresfrist. Und die Tendenz ist weiter steigend. Doch welche Gruppen sind die Treiber dieses Booms und welche halten sich zurück? Auch hier gibt die Milieuforschung aktuellen Aufschluss.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2016 E-Commerce und Stadtentwicklung
Der Abgesang auf den Einzelhandel hält unaufhörlich an. Schon seit Jahren ist immer wieder zu hören und zu lesen, dass es dem Einzelhandel schlechter und schlechter geht. Die Schuld trägt oft allein der Onlinehandel – zumindest wenn man dem jeweiligen Schlussakkord von Berichten und Artikeln Glauben schenken darf. Zu kurz gedacht, denn der E-Commerce ist im Zeitalter der Digitalisierung nur ein Aspekt von vielen.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2016 E-Commerce und Stadtentwicklung
Der Einzelhandel erlebt mit der Digitalisierung einen Strukturwandel, der diesen Wirtschaftszweig vermutlich tiefgreifender und nachhaltiger verändern wird als die Einführung der Selbstbedienung vor einem halben Jahrhundert. Das verändert auch die Innenstädte; einige dürften von der Veränderung profitieren, während andere stärker unter Druck geraten. Die digitalen Technologien beeinflussen die Wertschöpfungsprozesse in der Wirtschaft und das Verhalten der Kunden. Diese Veränderungen spielen sich in einem stagnierenden Wirtschaftszweig ab, der preisbereinigt seit zwei Jahrzehnten ein Nullwachstum verzeichnet.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2016 E-Commerce und Stadtentwicklung
Spätestens mit der Suburbanisierung des Handels und der damit einhergehenden Entstehung von Shopping-Centern an nicht integrierten Standorten muss die Frage nach der Rolle des Verhältnisses zwischen Stadt und Handel neu diskutiert werden. Im Zuge des rasanten Wachstums des E-Commerce und der Möglichkeit zur virtuellen Vernetzung über das Internet liegt auf den ersten Blick die Schlussfolgerung nahe, dass sich die Erosion der funktionalen Verflechtung zwischen Stadt und Handel weiter fortsetzt. Der zweite Blick eröffnet jedoch die Frage, ob die Verbindung der physisch realen und der virtuellen Welt durch „smarte“ Handelskonzepte als Chance für die Innenstädte genutzt werden kann. Wenn dem so ist, wie sollten diese neuen Handelskonzepte ästhetisch und funktional gestaltet werden? Welche Akteure sind dafür mit einzubeziehen?
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2016 E-Commerce und Stadtentwicklung
Verbunden mit dem gesellschaftlichen Wandel und technologischen Innovationen hat es fortlaufend strukturelle Veränderungen im Einzelhandel gegeben, die stets auch Auswirkungen auf die Stadtentwicklung hatten. Mit dem Onlinehandel findet nun ein Wechsel der Vertriebsform vom stationären Handel zum Distanzhandel statt. Angesichts des dynamischen Umsatzwachstums im Onlinehandel stellt sich neben der Frage nach den Konsequenzen dieser Entwicklung für die Stadtentwicklung auch die Frage, inwiefern die Akteure vor Ort auf diese Entwicklungen reagieren können. Lokale Online-Marktplätze bilden einen möglichen Ansatzpunkt zur Vernetzung von stationärem Geschäft und Vertrieb über das Internet. Der Beitrag gibt einen ersten Überblick über Ziel und Gegenstand sowie Chancen und Grenzen derartiger Plattformen.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2016 E-Commerce und Stadtentwicklung
Zum Wesen des Handels gehören stetige Innovationen, die die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Mitbewerbern steigern sollen. Dadurch ist der Handel in einem dauerhaften Wandlungsprozess, welcher häufig die Serviceleistungen gegenüber dem Kunden im Fokus hat. Die Dynamik dieses Prozesses ist jedoch nicht immer gleich, sondern nimmt mit der gesellschaftsweiten Durchdringung technischer Innovationen zu bzw. ist eng mit diesen verknüpft. So war beispielsweise die Massenmotorisierung in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts nicht nur die Grundlage für die rasant ansteigende Mobilität weiter Gesellschaftsschichten, sondern trug auch wesentlich zur Durchsetzung großflächiger Handelsangebote auf der Grünen Wiese bei.
Beiträge

Erschienen in Heft 5/2014 Kommunikationslandschaften

Erschienen in Heft 5/2014 Kommunikationslandschaften
Eigentlich besteht in großen Teilen von Kommunalpolitik und -verwaltung schon lange ein Konsens darüber, wie Stadtentwicklungsplanung angegangen werden soll – „eigentlich“. Denn seit langem ist bekannt, was etwa in der Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt von 2007 wie folgt formuliert wurde: „Wir brauchen mehr ganzheitliche Strategien und abgestimmtes Handeln aller am Prozess der Stadtentwicklung beteiligten Personen und Institutionen – auch über die Grenzen der einzelnen Städte und Gemeinden hinaus. (...) Um diese Verantwortung auf den verschiedenen Regierungsebenen effektiv zu gestalten, müssen wir die sektoralen Politikfelder besser koordinieren und ein neues Verantwortungsbewusstsein für eine integrierte Stadtentwicklungspolitik schaffen. Wir müssen gewährleisten, dass alle, die an der Umsetzung der Ziele für eine nachhaltige Stadt arbeiten, die dafür erforderlichen und berufsübergreifenden Kompetenzen und Kenntnisse erwerben.“
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2014 Kommunikationslandschaften
Die Entwicklung von werdendem Bauland bis zur Baureife wird immer teurer – die Preise für unbebautes Bauland als Teil der Anschaffungskosten für Neubauten steigen, in den Ballungsgebieten nimmt der Anteil der Grundstückskosten an den Anschaffungskosten einer Wohnimmobilie stärker zu als die darin enthaltenen Baukosten. Die Baulandpreise lenken damit die Nachfrage nach Bauland in eine bestimmte stadträumliche Richtung und bilden auf diese Weise das Gesicht der Einwohnerstruktur einer Stadt ab. Das beschriebene Phänomen hat Auswirkungen vor allem in Wachstumsregionen mit hoher Zuwanderung von privaten Haushalten. Bei tendenziellem Rückgang der Bevölkerungszahlen in Deutschland konzentrieren sich Siedlungserweiterungen und Flächenkonversionen auf die Verdichtungsräume mit ohnehin überdurchschnittlichem Preisniveau.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2014 Kommunikationslandschaften
Städtische Freiräume sind ein knappes Gut. Insbesondere gilt das für die öffentlichen Räume in den Städten, die für das Spielen, Sporttreiben und freie Bewegen der Menschen nutzbar sind. Einerseits werden Freiräume abgebaut oder gar nicht erst geplant – anderseits scheint es eine Renaissance des öffentlichen Raums als Ort für private freizeitliche Tätigkeiten zu geben, die den gewandelten Bedürfnissen der Menschen nach selbstbestimmten Aktivitäten mehr Aufmerksamkeit gibt. Damit für eine zukünftige sport- und bewegungsbezogene Freiraumplanung die richtigen Entscheidungen getroffen werden, müssen einige Grundlagen der Freiraumplanung berücksichtigt werden. Hierzu gehören zu allererst die Bewegungsbedürfnisse und -praktiken der Menschen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2014 Kommunikationslandschaften
Zum inzwischen vierten Kongress des vhw-Städtenetzwerkes trafen sich Teilnehmer aus dem In- und Ausland am 18. und 19. September 2014 in der Berliner Kalkscheune, einer mittlerweile schon fast traditionellen „vhw-location“. Der Hintergrund dieses ersten internationalen Formates liegt auf der Hand: Eine Vielzahl von Entwicklungen hat den sozialen Zusammenhalt in weiten Teilen Europas – insbesondere in den Städten – erheblich beeinträchtigt und in vielen Metropolen sind wachsende soziale Spaltungen festzustellen. Das Problemspektrum ist dabei ebenso groß wie die Zahl der Konzepte und Maßnahmen zu seiner Lösung, aber auch die jeweiligen politischen und fiskalischen Handlungsspielräume der Kommunen. Der Kongress wollte vor diesem Hintergrund unterschiedliche Zugänge deutscher und europäischer Städte zur Wiederbelebung des gesellschaftlichen Zusammenhalts vorstellen und diskutieren.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2014 Kommunikationslandschaften
Der Befund erschüttert. Selbst nach zwanzig Jahren können die Bürger mit Nanotechnologie wenig anfangen. Das stellte sich bei dem EuroScience Open Forum (ESOF) in Kopenhagen heraus. Als Konsequenz daraus entstand die „Copenhagen Declaration“. Sie fordert die Europäische Kommission auf, für die Einrichtung von Datenknotenpunkten zu sorgen mit aktueller Nano-Info. Der Hilferuf richtet sich auch an die Forschungskommunikation in Deutschland. Ein Nachtrag und zugleich Aufheller zu den umstrittenen WÖM-Empfehlungen der Akademien – und Weckruf: Aufwachen aus dem Dornröschenschlaf!
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2014 Kommunikationslandschaften
Weder kleinere noch größere Projekte in der Stadtentwicklung werden in Zukunft ohne eine effektive Bürgerbeteiligung umsetzbar sein. Nur so kann die Möglichkeit, mehr Verantwortung und Engagement für den gemeinsamen urbanen Lebensraum zu entwickeln, genutzt werden. Zwar gibt es mittlerweile kaum ein Vorhaben mehr, bei dem die Bürger nicht in irgendeiner Form beteiligt werden, aber nicht immer führt dies zu positiven Ergebnissen. Ein Grund hierfür ist, dass den beteiligten Akteuren häufig die Bereitschaft fehlt, Verständnis für die Handlungslogik der anderen Seite aufzubringen. Das heißt zu verstehen, aus welcher Motivation heraus andere Akteure so handeln, wie sie handeln.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2014 Kommunikationslandschaften
Lebendige Dörfer sind kommunikative Dörfer. Dorfgemeinschaften und Nachbarschaften funktionieren (noch) und organisieren Sorge füreinander – dies im Zusammenspiel von Nachbarschaft, Ehrenamt und öffentlicher Verantwortung. Kommunikation findet hierbei nicht im luftleeren Raum statt, sie verortet sich räumlich. In diesem Artikel soll daher der Blick auf die Kommunikationslandschaften in ländlichen Räumen geworfen und dargelegt werden, welche Anforderungen an die Weiterentwicklung von Kommunikationsgebäuden und Kommunikationsplätzen im Dorf bestehen. Ebenfalls beleuchtet wird, wie eine Kommunikationslandschaft mit Blick auf das Jahr 2030 aussehen sollte und welche Schritte dorthin in Dörfern unternommen werden können.
Beiträge