
Erschienen in Heft 6/2017 Die Digitalisierung des Städtischen
Die neu erarbeitete Smart City Charta der Bundesregierung zur nachhaltigen digitalen Transformation der Kommunen aus dem Jahr 2017 betont unter anderem das unbedingte Erfordernis von Transparenz, Teilhabe und Mitgestaltung der Bürger bei der digitalen Transformation. Eine proaktive und inklusive Einbeziehung der Bürger in die Gestaltungsprozesse – auch im Sinne der künftigen gesellschaftlichen Kohäsion – sei dabei unverzichtbar. Auch seien die demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten in bestmöglicher Weise zu gewährleisten. Im Kontext der Diskurse zum Thema „Smart Cities“ hat die Stadt Ludwigsburg diese politische Rahmensetzung aktiv aufgegriffen und zum Bestandteil ihrer langfristigen strategischen Entwicklungsbestrebungen erklärt.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2017 Die Digitalisierung des Städtischen
Die SMART CITY hat es geschafft: In allen Medien ist sie Thema – zur besten Sendezeit und als Leitartikel. In der Regel visualisiert mit visionären, beeindruckenden Mobilitäts-, Energie- oder Klimaszenarien. Die Reportagen versuchen alles, was auch nur halbwegs technisch innovativ daherkommt, in einem vernetzten Allerlei darzustellen. Schaut man etwas genauer auf die einzelnen Beispiele und analysiert die Texte, verlieren viele angepriesene Visionen schnell ihren Glanz. Was bleibt, sind Fragen: Was genau ist eine SMART CITY? Hat die gemeinwohlorientierte, integrierte, nachhaltige Stadtentwicklung in der SMART CITY eine Chance? Wer steuert die Entwicklung in der SMART CITY? Wer verhindert eine (digitale) Spaltung der Stadtgesellschaft? Der vorliegende Beitrag beleuchtet die SMART CITY aus Sicht der Technologie-Anbieter und der Kommunen.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2023 Urbane Daten in der Praxis
Ob Bürgerbüro, Restaurantbesuch oder Sporthalle – viele Menschen besuchen täglich öffentliche Orte und öffentlich zugängliche Gebäude. Auf einen barrierefreien Zugang sind insbesondere Besuchende mit Seh-, Hör- oder Mobilitätseinschränkungen angewiesen. Gleiches gilt für Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit, weil sie zum Beispiel mit Rollator oder Kinderwagen unterwegs sind. Um die Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, gibt es verschiedene Richtlinien für die reale und digitale Welt. Die Stadt Karlsruhe leistet unter anderem mit dem Projekt „Karlsruhe barrierefrei“ ihren Beitrag zum Thema Barrierefreiheit.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2022 Soziale Verantwortung und Mitbestimmung in der Wohnungswirtschaft
Deutschland hat wieder ein eigenständiges Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Damit will die neue Koalition aus SPD, Grünen und FDP die sozialpolitische Bedeutung dieser Themen unterstreichen. „Ziel der neuen Regierung ist es, den Wohnungsbau massiv auszuweiten“, heißt es auf der Website. „Wir haben uns Gewaltiges vorgenommen. Wir wollen 400.000 Wohnungen bauen, jedes Jahr. Und wenn wir gleichzeitig die Klimaziele erreichen wollen, müssen wir das klimagerecht machen“, wird die neue Ministerin Klara Geywitz zitiert. Ein Viertel davon soll als öffentlich geförderter Wohnraum entstehen. Hier ist der Handlungsdruck am höchsten, da die Zahl der belegungsgebundenen Wohnungen in Deutschland dramatisch gesunken ist – zuletzt auf rund 1,1 Mio., weniger als die Hälfte im Vergleich zur Jahrtausendwende.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2020 Perspektiven für Klein- und Mittelstädte
Der Beitrag basiert auf Ergebnissen des von 2015 bis 2018 durch das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) durchgeführten Projektes "Vielfalt in den Zentren von Klein- und Mittelstädten – sozialräumliche Integration, städtische Identität und gesellschaftliche Teilhabe" (Reimann et al. 2018a, 2018b). An dem Projekt waren neun Kommunen als Praxispartner beteiligt, die einen vergleichsweise hohen Zuwanderanteil aufweisen und deren Innenstädte mit Funktionsverlusten konfrontiert sind: Germersheim, Goslar, Ilmenau, Michelstadt, Mühlacker, Saarlouis, Steinfurt, Weißenfels und Zittau. Die ausgewählten Kommunen stehen modellhaft für die Situation in den Klein- und Mittelstädten der ländlich strukturierten Regionen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2021 Digitalisierung als Treiber der Stadtentwicklung
Digitalisierung ist ein Kernthema unserer Zeit, das kaum einen Lebensbereich unberührt lässt: Teilhabe, klimaschonende Mobilität, Wettbewerbsfähigkeit und moderne Verwaltung hängen unmittelbar mit der digitalen Transformation zusammen. Dabei ist die öffentliche Hand Hamburgs in der Verantwortung, dass technologische Umwälzungen nicht als Selbstzweck geschehen, sondern so eingesetzt und gelenkt werden, dass die hohe Lebensqualität und wirtschaftliche Attraktivität für die Stadtgesellschaft auch künftig erhalten bleiben.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2021 Digitalisierung als Treiber der Stadtentwicklung
Seit den 1980er Jahren geistert das Paradigma der smarten Stadt durch politische, ökonomische und wissenschaftliche Debatten. Getrieben wurden diese Debatten zumeist von Vor- und Nachdenkern kommerzieller Anbieter entsprechender Technologien, Produkte und Anwendungen. So trieb IBM das Konzept mit weltweiten Initiativen an – ganz besonders nach dem Einbruch der Weltwirtschaft in den Jahren 2008 und 2009. Es blieb nicht bei der Theorie und dem Marketing: Weltweit sind Städte und Stadtteile nach dem Muster einer Smart City umgebaut oder sogar neu geschaffen worden. Entscheidend beim klassischen Smart-City-Ansatz bleibt das Produkt, die Technologie. Sie ist nach marktförmigen Gesichtspunkten entwickelt worden und muss nun entsprechend kommerzialisiert werden. Bezahlt wird nicht immer mit Geld, sondern oft auch mit der Privatisierung öffentlichen Raums, mit Daten von Bürgerinnen und Bürgern oder mit Einfluss auf öffentliche Belange.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2022 Auswirkungen des Klimawandels und die Anforderungen an das kommunale Krisenmanagement
Die Starkregenfälle und das Hochwasser der vergangenen Tage in Teilen Deutschlands mit über 170 Toten ist eine der schlimmsten Naturkatastrophen der deutschen Geschichte. Häuser sind in den Fluten verschwunden und Straßen, Bahngleise und Brücken zerstört. Ganze Existenzen der Menschen vor Ort sind vernichtet. Die Versorgung mit Trinkwasser und Strom ist in einigen Regionen zusammengebrochen. Es wird Jahre dauern, bis alle Häuser, Kitas, Klärwerke, die vielen zerstörten Gebäude wiederaufgebaut, die mehr als 600 Kilometer zerstörten Bahngleise repariert und Brücken sowie Straßen wieder instandgesetzt sind. Erste Schätzungen gehen von Schäden durch die Hochwasser-Katastrophe von mehreren Milliarden Euro aus. Deshalb braucht es jetzt schnelle und unbürokratische Hilfen für die Betroffenen und für den kommunalen Wiederaufbau in enger Abstimmung zwischen Bund und Ländern. Beeindruckend ist, wie Hilfsorganisationen, Helferinnen und Helfer sofort anpackten und unterstützen. Ihnen allen gilt ein besonderer Dank.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2022 Auswirkungen des Klimawandels und die Anforderungen an das kommunale Krisenmanagement
Von unserem Haus im Bonner Süden ist das Ahrtal, das in der Nacht vom 14. zum 15. Juli 2021 eine verheerende Naturkatastrophe traf, nur einen Katzensprung weit entfernt. In der Zeit der Flutkatastrophe hatte ich Urlaub, war aber zu Hause. Als meine Frau und ich die Meldungen von den vielen Toten und vom Ausmaß der Zerstörungen durch die Flut in den Medien hörten und sahen, waren wir wie alle anderen auch entsetzt. Wir packten Stiefel, Handschuhe, Schaufeln, Besen, Eimer, Bürsten, Kehrbleche sowie viele Wasserflaschen und auch Essen in den Kofferraum unseres Autos und fuhren Richtung Ahrweiler, um zu helfen.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2021 50 Jahre Städtebauförderung
Seit 50 Jahren ist die Städtebauförderung eines der wichtigsten Instrumente zur Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Funktionalität, Wirtschafts- und Siedlungsstruktur. Durchaus ein Anlass zum Feiern, aber auch, um zumindest ansatzweise zu reflektieren und aus dem Rückblick und dem Status quo für die Zukunft zu lernen – denn selten ist etwas so gut, dass es nicht noch besser werden könnte.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2009 vhw-Verbandstag 2009 / Leitbilder für die Innenstädte
Unternehmensengagement ist nach Auffassung des vhw notwendiger Bestandteil einer gelingenden Bürgergesellschaft. Alle müssen lernen zur Lösung der Probleme und fürs Gemeinwohl aufeinander zuzugehen und Wege zu finden – um dies zwischen Wohnungswirtschaft, Stadt, Bürgern und der Öffentlichkeit zu erleichtern, betreibt der vhw eine Art Kampagne: Ein Beirat wurde gebildet, eine Interviewstudie in Auftrag gegeben, Indikatoren entwickelt und eine Tagungsreihe ins Leben gerufen ("urbane Landschaften", beginnend am 24. November 2009) für diejenigen, die ihre Mitarbeiter fit machen wollen für eine strategische Ausrichtung des betrieblichen Engagements. Der nachfolgende Artikel beschreibt den Versuch drei Dimensionen auszumachen, in denen sich diese Strategie bewegen muss, um mehr zu sein als nur Sponsoring.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2010 Öffentlicher Raum: Infrastruktur für die Stadtgesellschaft
Unter dem Begriff "öffentlicher Raum" werden heute unterschiedliche Konzepte, in der Praxis zudem unterschiedlich weite Formen des Öffnens von Orten für die Vielfalt der Nutzenden verstanden. Der Rahmen erstreckt sich vom öffentlichen Raum als Bewegungs- und Aufenthaltsort über die programmatische Forderung nach Möglichkeiten der Begegnung bis hin zu der Ansicht, dass "öffentlicher Raum […] Brennpunkt öffentlichen Lebens [ist] - ein Ort der Begegnung und Konfrontation unterschiedlicher Schichten, Generationen und Kulturen." (Asadi et al. 1998, 3) Der hier vorliegende Beitrag geht der Frage nach, welche Integrationsherausforderungen in öffentlichen Räumen gegeben sind und wie dessen Integrationspotenziale in der Planungspraxis methodisch analysiert werden können.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2008 Migranten-Milieus in Deutschland
Migranten und Wohnen – die um diese Begriffe kreisenden Fragen und Themen werden in sozial- und raumwissenschaftlichen Disziplinen seit Jahrzehnten erforscht und debattiert. Es ist zwar festzustellen, dass die Beziehungsnetze und Identifikationsorte von Migranten oftmals in einem erheblichen Maße außerhalb des Wohnortes und des Stadtteils liegen, doch mindert dies – auch angesichts der schwindenden Integrationsfunktion des Arbeitsmarktes – nicht die Bedeutung des Wohnens für die Lebensqualität und soziale Integration von Migranten. In diesem Beitrag soll es um die Frage gehen, wie es um die Wohnrealität von Migranten bestellt ist und welche möglichen Wünsche und Anforderungen Migranten an das Wohnen stellen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2025 Kommunen zwischen Zukunftsorientierung und Gegenwartsbezug
Es gibt keinen Tag, an dem nicht auf die großen Herausforderungen der Gesellschaft und der Kommunen hingewiesen wird, denn sie sind der Seismograf der Gesellschaft. Sie sind aber auch der Transformationsriemen, der „vor Ort“ konkret mit den Bürgern Zukunft gestaltet. Die Herausforderungen werden oft mit den vier Ds bezeichnet. Es geht darum, die Dekarbonisierung der Gesellschaft zu gestalten sowie die Energie- und ökologische Wende zu organisieren. Es geht um die Digitalisierung als zentralem Treiber der Veränderung mit großen Chancen und Risiken. Es geht um den demografischen Wandel und nicht zuletzt um die Zukunft der Demokratie. Damit dies gelingt, bedarf es fundamentaler Reformen, die derzeit tagtäglich in den Zeitungen unter dem Stichwort „Entbürokratisierung“ diskutiert, aber leider nicht gelöst werden. In dem folgenden kleinen Beitrag geht es darum, welche Rolle hierbei das Personal spielt, denn zum Schluss sind es handelnde Akteure, die die Veränderung ausmachen und gestalten – auch wenn die „systemischen“ Zwänge groß sind und jeder Verantwortungsträger in institutionellen Strukturen eingebettet ist, die Handlungsspielräume ermöglichen, aber oft eben auch begrenzen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2025 Kommunales Gebäudemanagement
Spätestens seit dem deutschen Beitrag der 18. Internationalen Architekturbiennale in Venedig sind die Wieder- und Weiterverwendung von gebrauchten, „geretteten“ und vorhandenen Bauteilen, -komponenten und -stoffen im Fachdiskurs der Planenden-Welt angekommen. „Open for Maintenance – wegen Umbau geöffnet“, kuratiert von Arch+, Summacumfemmer und Büro Juliane Greb, hat dem Handlungsansatz des kreislaufgerechten Umbaus einen Pavillon gewidmet und mit Concular, vielen Architekturhochschulen und -universitäten sowie weiteren Akteuren ein lebendiges Depot aus gesammeltem Material geschaffen – vor Ort und digital. Auch in der kommunalen Planungs-, Bau- und Betriebswelt sind Ansätze des zirkulären, kreislaufgerechten Bauens mittlerweile angekommen. Kommunen, wie der Kreis Viersen, die Hansestadt Lüneburg, die Stadt Aachen, der Kreis Lippe oder die Cradle-to-Cradle-Gemeinde Straubenhardt zeigen: Ressourcenschonendes, klimagerechtes und bio-basiertes Bauen in kommunalen Kontexten gelingt.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2020 Perspektiven für Klein- und Mittelstädte
Der globale und gesellschaftliche Wandel macht vielen Demokratien zu schaffen: Der Anpassungsdruck an veränderte Rahmenbedingungen steigt konstant und die zunehmende soziale Ungleichheit führt zu einer politischen Ungleichheit, die in den Kommunen besonders sichtbar wird. Durch Segregationstendenzen und regionale Disparitäten schlägt sie sich dort räumlich nieder und wird damit umso präsenter. Fehlende Arbeitsmarkt- und Bildungschancen, ein Gefühl des Nicht-gehört-Werdens, ausbleibende Selbstwirksamkeitserfahrungen, ein vernachlässigtes Wohnumfeld, mangelhafte Kenntnisse des politischen Systems oder auch die fehlende Wahlberechtigung trotz dauerhaften Aufenthalts entfalten nicht nur faktisch, sondern auch symbolisch ihre "postdemokratischen" Wirkungen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2020 Perspektiven für Klein- und Mittelstädte
Politische Gleichheit ist ein zentrales Kriterium einer lebendigen Demokratie. Das heißt, allen Bürgerinnen und Bürgern sollten die gleichen Möglichkeiten gegeben sein, sich eine politische Meinung zu bilden, diese frei zu äußern und sich an demokratischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Es zeigt sich allerdings, dass mit zunehmender sozialer Ungleichheit und migrationsbedingter Diversität auch die politische Gleichheit abnimmt. Gerade in benachteiligten Stadtteilen sind daher die lokale Demokratie und die Integrationsfähigkeit demokratischer Prozesse besonders zu stärken. Eine Gemeinwesenarbeit, die niedrigschwellige und diversitätssensible Teilhabemöglichkeiten schafft, kann hier maßgeblich zu einer Demokratisierung von Kommunikations- und Partizipationsstrukturen beitragen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2020 Perspektiven für Klein- und Mittelstädte
In Politik und Medien hat sich vor dem Hintergrund anhaltender sozialräumlicher Polarisierungen in den letzten Jahren ein lebendiger Diskurs über den Zustand und die Entwicklungsperspektiven ländlich-peripherer Räume in Deutschland herausgebildet. So sind in vielen Klein- und Mittelstädten Schrumpfungsprozesse, eine schwache finanzielle Haushaltskraft oder zentralörtliche Funktionsverluste zu beobachten. Besonders im Zusammenspiel der Akteure vor Ort durch mehr Kooperation und partizipative Prozesse im Rahmen einer lebendigen lokalen Demokratie liegen jedoch Chancen, derartige Stagnationen oder gar Abwärtsspiralen städtischer Entwicklung zu durchbrechen und in Aufbruch oder Möglichkeitsräume umzukehren.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2025 Korruptionsprävention in Kommunen
Open Data stärkt Transparenz, Beteiligung und Innovation in Städten. Während Länder wie Dänemark zeigen, wie offene Informationen demokratische Kontrolle und Vertrauen fördern, bleibt die Umsetzung in deutschen Kommunen uneinheitlich. Hamburg, Dresden und Lübeck beweisen das Potenzial – doch vielerorts fehlen rechtliche Grundlagen, technische Infrastruktur und Ressourcen. Damit die Idee der offenen Kommune Wirklichkeit wird, müssen Bund und Länder Rahmenbedingungen schaffen, die überall gleichen Zugang zu kommunalen Daten ermöglichen.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2025 Korruptionsprävention in Kommunen
Der vorliegende Beitrag analysiert systematisch Korruptionsrisiken in Kommunalverwaltungen und leitet daraus praxisnahe Präventionsmaßnahmen ab – mit Fokus auf die Rolle einer strukturierten Risikoanalyse als Fundament eines wirksamen Antikorruptionsmanagements. Im Zentrum stehen besonders gefährdete Felder, wie Vergabe- und Beschaffungswesen, Bau- und Genehmigungsverfahren, Personalentscheidungen sowie die Vergabe von Zuschüssen und Fördermitteln, die aufgrund enger lokaler Verflechtungen und unzureichender Verfahrensdokumentation anfällig für Einflussnahme sind. Neben bereichsspezifischen Risiken werden strukturelle Faktoren, wie knappe Ressourcen, unklare Zuständigkeiten und die soziale Nähe in kleineren Kommunen, als Treiber von Kontrolllücken herausgearbeitet. Ziel ist es, Werkzeuge, Kontrollmechanismen und Integritätsstrategien zu verankern, die Interessenkonflikte minimieren, Transparenz erhöhen und eine dauerhafte Kultur der Integrität in kommunalen Abläufen fördern.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2025 Urbane Räume im digitalen Wandel
Vor dem Hintergrund dringlicher werdender Wohnungsbau- und Transformationsaufgaben zeigt sich insbesondere in der Innenentwicklung, dass private und öffentliche Interessen mitunter voneinander abweichen und kooperative Lösungen nicht immer gefunden werden können. Im Mittelpunkt des Verbandstags stand daher die Frage, inwiefern die Kommunen im Kontext städtebaulicher Aufgaben zur Durchsetzung öffentlicher Interessen besser anwendbare Rechtsinstrumente benötigen. Ganz im Sinne der Wiedernutzung bestehender Strukturen fand der Verbandstag in der 2007 zum Veranstaltungsort „Tagungswerk“ umgebauten Jerusalemkirche im Herzen Berlins statt. Durch den Tag führte die Moderatorin und Stadtplanerin Petra Voßebürger.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2025 Kommunales Gebäudemanagement
In Deutschland gibt es rund 11.000 Kommunen, die für eine Vielzahl von Aufgaben verantwortlich sind, darunter auch das Gebäudemanagement für ihre eigenen Immobilien. In ihrer Gesamtheit sind die Kommunen mit ihren rund 186.000 öffentlichen Gebäuden der größte Immobilienbetreiber Deutschlands. Die Gruppe der öffentlichen Gebäude wird maßgeblich durch Bildungsbauten, wie Schulen und Kindergärten, Verwaltungs- und Sozialgebäude, wie Pflegeeinrichtungen und Kliniken, repräsentiert. Hinzu kommen eine Vielzahl weiterer öffentlicher Einrichtungen, wie Feuerwachen, Schwimmbäder, Friedhofshallen, Bauhöfe und vieles mehr. Diese Immobilien sind nicht nur Orte des Lernens und der Verwaltung, sondern auch zentrale Elemente für die öffentliche Daseinsvorsorge und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger. Doch das kommunale Gebäudemanagement steht vor enormen Herausforderungen: Ein erheblicher Investitionsstau, insbesondere in Schulen und Kindergärten, belastet die Kommunen und gefährdet die Qualität der öffentlichen Dienstleistungen. Gleichzeitig fehlt es vielerorts an nötigen Finanzmitteln und qualifizierten Menschen, die Projekte und den laufenden Betrieb umsetzen können. Ein Dilemma, in dem viele Kommunen stecken.
Beiträge

Erschienen in Heft 3/2007 Den demografischen Wandel gestalten!
Der demografische Wandel wird inzwischen breit diskutiert und ist zum Gegenstand zahlreicher Untersuchungen und Studien geworden. Unstrittig ist dies auch ein besonderes Problem für die kommunale Ebene. War die Abnahme der Bevölkerungszahl in der Vergangenheit vor allem im Zusammenhang mit wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Strukturwandel zu beobachten gewesen – besonders ausgeprägt im Osten nach der Wende –, so wird dieser Rückgang zukünftig immer mehr Gebiete betreffen. Es geht aber nicht nur um die Bevölkerungsabnahme: Die strukturellen Trends – Alterung, Heterogenisierung und Vereinzelung – werden auch in Städten und Regionen mit stabiler Bevölkerungszahl wirksam werden. Die Herausforderung des demografischen Wandels unter schwierigen Rahmenbedingungen wird heute schon in vielen Städten erkannt und angegangen. Dabei kommt es vor allem darauf an, Aktionismus zu vermeiden und die kommunale Strategie auf einen integrierten und langfristigen planerischen Ansatz zu gründen. Die Anforderungen und Herausforderungen des demografischen Wandels sind aber von den Kommunen nicht alleine zu bewältigen. Intra- und interkommunale Netzwerke unter Beteiligung von Vereinen, Verbänden und vor allem den Bürgern sind unerlässliche Voraussetzungen für eine zukunftsfähige kommunale Strategie im demografischen Wandel.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2011 Von der sozialen Stadt zur solidarischen Stadt
Integrationspolitik hat sich im letzten Jahrzehnt zu einem eigenen kommunalen Handlungsfeld entwickelt. Dazu hat auch die späte Einsicht beigetragen, dass die Bundesrepublik eine Zuwanderungsgesellschaft ist. Mit dem Nationalen Integrationsplan haben 2007 die Gebietskörperschaften diese politische Gestaltungsaufgabe anerkannt und bekräftigt, dass Integration in erster Linie "vor Ort" stattfindet – oder scheitert. Dieser Beitrag informiert über Ergebnisse der ersten breit angelegten Studie über den Stand der Umsetzung der Empfehlungen der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Handlungsfeld der sozialräumlichen Integration.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2011 Neue Dialogkultur: Wir sprechen uns im Web 2.0
Wilde Müllhalden, defekte Laternen, Schlaglöcher oder Radwege, die von Sträuchern überwuchert werden – oftmals fallen Bürgerinnen und Bürgern Missstände und Probleme auf. Gerne würden sie diese an die verantwortlichen Stellen melden, wissen aber wegen unklarer Zuständigkeiten häufig nicht, an wen sie sich wenden sollen. Eine solche Intransparenz kann auf Seiten der Bürger zu Ärger und Unmut führen. Erste Ansätze zur Lösung dieses Bürokratieproblems gibt es inzwischen mit der bundesweiten Behördennummer "D115" oder den kommunalen Callcentern und Bürgerbüros, an die jeder zentral seine Fragen und Anliegen richten kann.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2010 Trend 2010 – gesellschaftliche Entwicklung und Milieus
Die Stadtgesellschaft ist vielfältig und bunt – und sie befindet sich in ständigem Wandel. Um ihre Mannigfaltigkeit zu begreifen, ohne sich in ihrer Komplexität zu verlieren, bedarf es angemessener Methoden der Informationsbeschaffung und praxisorientierter Modelle, um die verfügbaren Informationen zu systematisieren. Die Lebenswelt- und Milieuforschung leistet dazu einen Beitrag, indem sie am Alltagsleben der Menschen – nicht nur, aber auch – in den Städten und Wohnquartieren ansetzt und es unter einer ganzheitlichen Perspektive erklärt und beschreibt. Der vhw nutzt diesen Ansatz seit vielen Jahren. Mit dem Projekt "Wohnwissen" wurde ein Informations-Pool geschaffen, der sowohl die gesamtgesellschaftliche Struktur abbildet, als auch die kleinräumigen Verhältnisse vor Ort erschließt. Redaktioneller Hinweis: In diesem Beitrag von Michael Schipperges ist es zu einem redaktionellen Versehen bei der Bebilderung gekommen. Die Abbildungen der Wohnzimmer sind ohne Zustimmung des Autors in den Beitrag übernommen und nun herausgenommen worden. Der Autor stellt fest, dass er nicht beabsichtigte, Bilder zu verwenden, auf denen er kein Copyright besitzt.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2010 Integration und Stadtentwicklung
Im Oktober 2009 stellte der Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (vhw) auf seinem Verbandstag in Frankfurt am Main seine vertiefenden Studienergebnisse zu Migrantenmilieus der Öffentlichkeit vor. Nachdem die Hinwendung der Milieuforscher zum Migrationsthema bereits kritisch beleuchtet wurde (vgl. hierzu bspw. Kunz 2008), gilt es, auch die vom vhw vorgelegten, gebündelten und nochmals pointierten Studienergebnisse hinsichtlich ihrer integrationspolitischen Relevanz zu reflektieren.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2010 Integration und Stadtentwicklung
Viele europäische Metropolen sehen sich vergleichbaren strukturellen Anforderungen wie in Wilhelmsburg gegenübergestellt: einer Überlagerung eines hohen Anteils an Menschen mit Migrationshintergrund mit einer schwachen sozioökonomischen Basis der Wohnbevölkerung. Die IBA 2013 widmet sich diesen Anforderungen im Kontext ihres Leitthemas Kosmopolis, Internationale Stadtgesellschaft, insbesondere unter den Gesichtspunkten Bildung, Arbeit, Städtebau und öffentliche Räume. Welche Bedeutung haben öffentliche Räume in Quartieren wie den Elbinseln? Was müssen sie leisten, damit diese Räume Orte der Begegnung und vielleicht auch der Integration werden? Welchen Beitrag können öffentliche Räume zur Entstehung einer Internationalen Stadtgesellschaft, der Kosmopolis, leisten?
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2009 Corporate Citizenship in Wohnungswirtschaft und Stadtentwicklung
Was ist eine Stadtrendite durch kommunale Wohnungsunternehmen? Es kann und sollte nicht jede Tätigkeit von kommunalen Wohnungsunternehmen für eine Stadt als Stadtrendite gewertet werden. Dies führt zu einer Verwässerung des Begriffes und zu undifferenzierten Schlüssen. Daher bietet es sich an, einen objektiven Maßstab zur Beurteilung der Stadtrendite und zur Relevanz der Leistungen einzuführen. Diesen Maßstab bietet die wohlfahrtsökonomische Theorie: Überall dort, wo die lokalen Wohn- und Immobilienmärkte funktionsfähig sind, kann der Markt eine effiziente Lösung finden, egal ob diese im Wettbewerb von privaten oder öffentlichen Unternehmen angeboten wird.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2014 Ländlicher Raum und demografischer Wandel
Im Fortbildungsbereich "Immobilienrecht, -management und -förderung" hat der vhw im September zwei gut besuchte Tagungen zu den Perspektiven der Pflegegesetzgebung in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg durchgeführt. "Neue Chancen für stationäre und ambulante Anbieter durch das GEPA?" lautete das Thema am 18. September 2013 in Dortmund, während am 24. September 2013 in Böblingen die Frage "Welche Chancen bietet der Entwurf des WTPG?" gestellt wurde.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2012 Stadtentwicklung und Sport
In wenigen gesellschaftlichen Bereichen liegen öffentliche Wahrnehmung und Realität so weit auseinander wie im Sport. Im Fokus der Öffentlichkeit stehen zumeist nur einige (telegene bzw. telegen produzierte) Sportarten mit ihren Spitzenleistungen, vor allem aber auch der hoch kommerzialisierte und bisweilen skandalisierte Teil des Sports. Die Realität des organisierten Sports in Deutschland mit über 91.000 Vereinen und 27 Millionen Mitgliedschaften sieht indes völlig anders aus. Hier wird das Sporttreiben von Millionen Menschen ehrenamtlich – das heißt freiwillig und zum größten Teil unentgeltlich – mit hohem Engagement und viel persönlichem Einsatz organisiert. Selbstorganisation und Ehrenamtlichkeit sind im Gegensatz zu manchen anderen gesellschaftlichen Bereichen konstitutive Elemente des Sports in Deutschland.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2016 Kommunalpolitik zwischen Gestaltung und Moderation
Die WerkStadt für Beteiligung war neben den Grundsätzen der Beteiligung und dem Beteiligungsrat Bestandteil des Modellprojektes „strukturierte Bürgerbeteiligung“ in der Landeshauptstadt Potsdam. Das Projekt wurde am 1. November 2013 mit einer dreijährigen Laufzeit gestartet und am 31. Oktober 2016 planmäßig abgeschlossen. Dem Start des Projektes ging eine intensive circa dreijährige Entwicklungsphase (2010–2013) voraus, in der aus einer trialogisch zusammengesetzten Gruppe heraus die Perspektiven von Zivilgesellschaft, Verwaltung und Kommunalpolitik miteinander verhandelt und in die Projektstruktur und in Projektinhalte umgesetzt wurden. Aufgrund der positiven Erfahrungen wurde das Projekt durch die Stadtverordnetenversammlung im Sommer 2016 in eine dauerhafte Struktur überführt.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2016 Kommunalpolitik zwischen Gestaltung und Moderation
Die Resultate von Bürgerbeteiligung wirken sich nur in vereinzelten Fällen auf kommunalpolitische Entscheidungen aus. Die gewählten Politiker halten die inhaltlichen Ergebnisse entsprechender Verfahren für überwiegend bereits bekannt und ihr eigenes Handeln ohnehin für den Wünschen der Bürger entsprechend. Außerdem sind sie häufig zeitlich und sachlich überfordert, den Vorschlägen der Bürger die angemessene Aufmerksamkeit zu widmen. Dies sind die zentralen Befunde einer empirischen Studie, die das Verfahren des „Bürgerhaushaltes“ in insgesamt dreizehn deutschen Städten untersuchte. Angesichts der hohen Erwartungen, mit denen Bürgerbeteiligung vielerorts startet, sind diese Resultate alarmierend und verdeutlichen dringenden Diskussions- und Handlungsbedarf.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2016 Kommunalpolitik zwischen Gestaltung und Moderation
England sei das Mutterland des Fußballs und der Demokratie, heißt es. In beiden Disziplinen hat sich das Land in diesem Frühsommer allerdings nicht mit besonderen Leistungen hervorgetan. Lassen wir einmal das unrühmliche Ausscheiden aus der Fußball-Europameisterschaft beiseite und richten den Blick auf den Brexit, genauer: auf den Prozess, der zum Votum führte. Was dort geschah, hatte mit Demokratie wenig, mit Demagogie und Desinformation hingegen viel gemein. Welche Folgen der Brexit-Entscheid für das Land und die EU hat, wird sich noch zeigen. Über die Folgerungen für den Umgang mit Formen direkter Demokratie auch auf kommunaler Ebene – also mit Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden – sollte man jedoch schon jetzt nachdenken. Neben einigen grundsätzlichen Erwägungen stellt sich hier insbesondere die Frage, ob und wie sachgerechte Information und faire Prozesse zu gewährleisten sind.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2015 Aus- und Weiterbildung in der Stadtentwicklung
„Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsamen Interesse von Beschäftigten und Arbeitgebern“ (§ 5 Abs. 1 Satz 1 TVÖD). Die Sicherung der Zukunft des öffentlichen Sektors in Deutschland hängt entscheidend von der Ausbildung und Qualifikation seiner Mitarbeiter ab. Dies ist nicht nur Aufgabe einer guten Berufsausbildung, sondern zunehmend auch einer lebenslangen beruflichen Weiterbildung. Immer wieder neue rechtliche, technische und gesellschaftliche Entwicklungen stellen hohe Anforderungen an die Kompetenzen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Um die Herausforderungen einer sich rasch entwickelnden Berufs- und Lebenswelt zu bewältigen, die Effizienz der öffentlichen Verwaltung zu steigern und nicht zuletzt Beschäftigungssicherheit zu gewährleisten, müssen sich Verwaltungsmitarbeiter jeden Alters heute lebensbegleitend weiterbilden.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2015 Die Innenstadt als Wohnstandort
Städte waren stets die Laboratorien der gesellschaftlichen Entwicklung. Städte waren stets die Orte, an denen sich jene Dynamik entfaltete, die für Gesellschaften typisch werden sollte – und dies ist wahrlich kein Phänomen der Moderne, was man etwa daran sehen kann, dass wir die Entwicklung wenigstens westlicher Gesellschaften an Städten festmachen: an Athen als der Polis, die als erste Demokratie eine städtische Form des Interessenausgleichs erfunden hat; Rom als Zentrum der ersten Weltmacht, später dann als Zentrum des christlichen Europas; später dann die europäischen Zentren als Basen jeweiliger Nationalstaaten und heute schließlich die großen städtischen Agglomerationen der Welt.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2015 Intermediäre in der Stadtentwicklung
Viele Kommunen haben in den letzten Jahren ihren Immobilienbestand drastisch reduziert. Der Zwang zur Haushaltskonsolidierung machte es erforderlich, sowohl jede Möglichkeit zur Einnahmeerzielung zu nutzen als auch den Haushalt von unwirtschaftlichen Kostenverursachern zu entlasten. Kommunale Immobilien sind häufig wegen ihrer Lage im Stadtgebiet besonders interessant und deshalb in der Regel gut zu veräußern. Oft handelt es sich jedoch auch um historisch und architektonisch bedeutende Gebäude, die ihren ursprünglichen Zweck entweder verloren haben oder heutigen Ansprüchen nicht mehr entsprechen – und trotzdem hohe Kosten verursachen. Oder es sind denkmalgeschützte Gebäude, die über viele Jahre nicht angemessen unterhalten werden konnten. In diesen Fällen ist dann der Ruf nach Privatisierung der Nutzung, das heißt nach Verkauf der Immobilie, nicht weit.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2015 Quartiersmanagement
Im Jahre 2010 hat der vhw ein Städtenetzwerk ins Leben gerufen mit dem paradigmatischen Titel „Stärkung der lokalen Demokratie durch bürgerorientierte integrierte Stadtentwicklung“. 16 Städte aus der ganzen Bundesrepublik haben sich zusammengefunden, darunter einige kleinere Städte wie z.B. Filderstadt und zahlreiche Großstädte wie z.B. die Freie und Hansestadt Hamburg, um in kooperativen Projekten zur Stadtentwicklung gemeinsam mit dem vhw den analytischen und strategischen Mehrwert der Lebensstilforschung sowie innovative Beteiligungsverfahren zu entwickeln und in der praktischen Arbeit umzusetzen. In den ersten Jahren stand dabei die Erarbeitung eines theoretisch eingebetteten, anwendungsbezogenen Dialogverfahrens im Fokus der gemeinsamen, von zahlreichen Dialogexperten begleiteten Arbeit.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2013 Perspektiven für eine gesellschaftliche Anerkennungskultur
Von Amsterdam bis Zagreb ergibt sich derzeit ein ähnliches Bild: Es fehlt an Jobs – besonders für Jugendliche; die Mieten steigen vielerorts rasant an. Es mangelt an adäquatem Wohnraum genauso wie an familiären Hilfen und flexiblen Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Die Befunde zeigen, dass es in Europas Kommunen an unterschiedlicher Stelle rumort. Die identifizierten sozialen Schieflagen wirken sich dabei direkt auf den Lebensraum der Bürgerinnen und Bürger aus. Um den sozialen Zusammenhalt auf lokaler Ebene zu stärken, setzen Wissenschaft und Politik auf soziale Innovationen. Ihr zentraler Mechanismus: Sie zielen auf die Mitverantwortung der Bürger. Als Beteiligte sollen sie befähigt werden, selbst kreative Lösungen für soziale Probleme zu entwickeln.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2016 E-Commerce und Stadtentwicklung
Warenhäuser stehen seit einigen Jahrzehnten unter einem erheblichen Wettbewerbsdruck. Die Anteile am Einzelhandelsumsatz sinken kontinuierlich und dementsprechend mussten viele Häuser schließen und sogar einige Konzerne aufgeben. Wegen der großen Bedeutung für die Entwicklung der städtischen Zentren ist diese Problematik auch stets Gegenstand politischer und planerischer Diskussionen gewesen. Um die aktuellen Tendenzen und die Zukunftsfähigkeit der Warenhäuser besser einordnen zu können, lohnt sich zunächst ein Blick auf die Entstehung und Entwicklung dieser besonderen Betriebsform und Handelsarchitektur. Der nachstehende Aufsatz geht auch auf die derzeitigen Entwicklungen ein und betrachtet zudem die Rolle der Städte in den zu beobachtenden Umstrukturierungsprozessen.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2015 Die Innenstadt als Wohnstandort
Viele Städte und Gemeinden in NRW stehen vor den gleichen Herausforderungen und Problemen. Ziel ist die Sicherung und Entwicklung zukunftsfähiger und attraktiver Innenstädte und Ortskerne in Nordrhein-Westfalen. So vielfältig, komplex und individuell hierbei die Aufgaben sind, so breit und unterschiedlich sind auch die Ansatzmöglichkeiten, Methoden, Instrumente und Programme, diesen zu begegnen. In vielen Städten und Gemeinden liegen spezifische und langjährige Erfahrungen im Umgang mit den aktuellen Herausforderungen der Innenstadtentwicklung vor. Auch wenn jeweils individuelle Lösungen erforderlich sind, ist ein Austausch über die Erfahrungen hilfreich.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2013 Diversität und gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Stadt
Die Thematik der Armutszuwanderung aus Südosteuropa, unter ihnen Roma und andere Angehörige von Minderheiten, ist seit geraumer Zeit nicht nur Gegenstand von Auseinandersetzungen in der jeweiligen lokalen Öffentlichkeit. Sie findet vielmehr einen großen Widerhall in den überregionalen Medien und hat es längst in die Talkshows geschafft. Nicht selten heizen dabei Inhalt sowie Art und Weise der medialen Vermittlung die lokalen Konflikte noch zusätzlich an. Tatsächlich ist die Darstellung der Neuzuwanderer in der öffentlichen Debatte oftmals negativ pauschalisierend. Ihnen wird etwa unterstellt, dass sie es nur auf Sozialleistungen abgesehen hätten und dabei auch vor Täuschungen und kriminellem Missbrauch nicht zurückschrecken. Und geht es um die unter ihnen anzutreffenden Roma, kommen nicht selten sogar stereotype, antiziganistische Vorurteilsstrukturen zum Vorschein.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2013 Diversität und gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Stadt
"Öffentlicher Raum" – nicht nur in der Fachwelt, auch in Feuilletons und Talkshows entzünden sich an diesem Thema intensivste Debatten. Vor allem die Frage, ob der öffentliche Raum angesichts voranschreitender gesellschaftlicher Pluralisierung und zunehmender ökonomischer Interessen überhaupt (noch) „öffentlich“ sei, wird immer wieder mit großer Schärfe diskutiert. Dieser Beitrag reflektiert thesenhaft Wandel und Vielfalt von Stadt-Gesellschaft und Stadt-Räumen und kommt zur Schlussfolgerung, dass sich die Vielfalt der Stadtgesellschaft nur unvollständig in den öffentlichen Räumen der Städte widerspiegelt. Dies hat Auswirkungen auf den gesellschaftlichen, politischen und planerischen Umgang mit Differenz und Diversität in der Stadt.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2017 Vielfalt und Integration
Seit Juli 2015 bearbeitet das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) das Forschungs-Praxis-Projekt „Vielfalt in den Zentren von Klein- und Mittelstädten – sozialräumliche Integration, städtische Identität und gesellschaftliche Teilhabe“ (siehe auch: www.vielfalt-in-stadt-und-land.de). Im Kern geht es darum, dass Klein- und Mittelstädte mit Maßnahmen zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Integration positive Entwicklungseffekte für die Stabilisierung ihrer Innenstädte/Zentren auslösen. Anders als ein „reines“, grundlagenorientiertes Forschungsprojekt hat dieses Vorhaben eine auf Aktivierung und Austausch angelegte Ausrichtung. Praxispartner des Difu sind neun Projektkommunen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2017 Vielfalt und Integration
Die politische Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund findet meist nur geringe öffentliche Aufmerksamkeit. Dies gilt in erster Linie für die politische Beteiligung in Parlamenten, Parteien und bei Wahlen. Von einer gleichberechtigten und proportionalen Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund kann dort keine Rede sein. Stärkere Aufmerksamkeit erfahren zivilgesellschaftliche und beratende Formen politischer Beteiligung, die vor allem auf kommunaler Ebene praktiziert werden. Zu dieser Wachstumszone gehören Migrantenorganisationen und Integrationsräte, aber auch die Förderung des freiwilligen Engagements von Eingewanderten. Sie können jedoch vorenthaltene politische Bürgerrechte nicht kompensieren. Das Integrationspotenzial politischer Partizipation ist erst noch zu entdecken.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2017 Vielfalt und Integration
Der vhw veranstaltete am 22. Juni in Mannheim den Städtenetzwerkkongress zum Thema „Stadtentwicklung zwischen Vielfalt und Sehnsucht nach Vereinfachung“. Über das Spannungsverhältnis von Vielfalt, Komplexität und Einfachheit im Kontext von Kommunalpolitik, Verwaltung und Planung sprach Frank Jost vom vhw mit dem Mannheimer Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz, gleichzeitig Verbandsratsvorsitzender des vhw.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2017 Vielfalt und Integration
Städte sind Schmelztiegel, in denen unterschiedlichste Erwartungen, Wünsche und Hoffnungen einer großen Vielfalt von Menschen und Sichtweisen zusammentreffen. Entsprechend komplex und undurchschaubar gestalten sich öffentliche Aufgaben wie die Stadtentwicklungspolitik, die all diesen Ansprüchen gerecht zu werden versucht. Dem steht eine wachsende Sehnsucht weiter Teile der Bevölkerung nach Verständlichkeit und Vereinfachung in Politik und Verwaltung gegenüber und stellt eine der großen politischen Herausforderungen der Gegenwart dar. Der vorliegende Beitrag spannt den Bogen von veralteten Vorstellungen von Integration über den Entwurf eines „Vielheitsplans“ zum Leitprinzip der Kollaboration.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2009 Nachhaltigkeit im Wohnungs- und Städtebau
Der Beitrag basiert auf einer im Jahr 2008 von der Autorin verfassten Diplomarbeit und widmet sich der Anwendung des integrierten Ansatzes in den Städten Liverpool, Berlin und dem niederländischen Apeldoorn. Die dabei zu ergründenden Fragen waren unter anderem: "Wie und in welcher Form werden die Anwohner in das Bürgerbeteiligungsverfahren des integrierten Ansatzes einbezogen und inwiefern kommt ihnen die Verwaltung entgegen?", und die zweite Frage lautete: "Sind die Kommunikations- und Organisationsformen der einzelnen integrierten Stadtentwicklungskonzepte angepasst, um die Voraussetzung für eine aktive Bürgerbeteiligung zu schaffen?"
Beiträge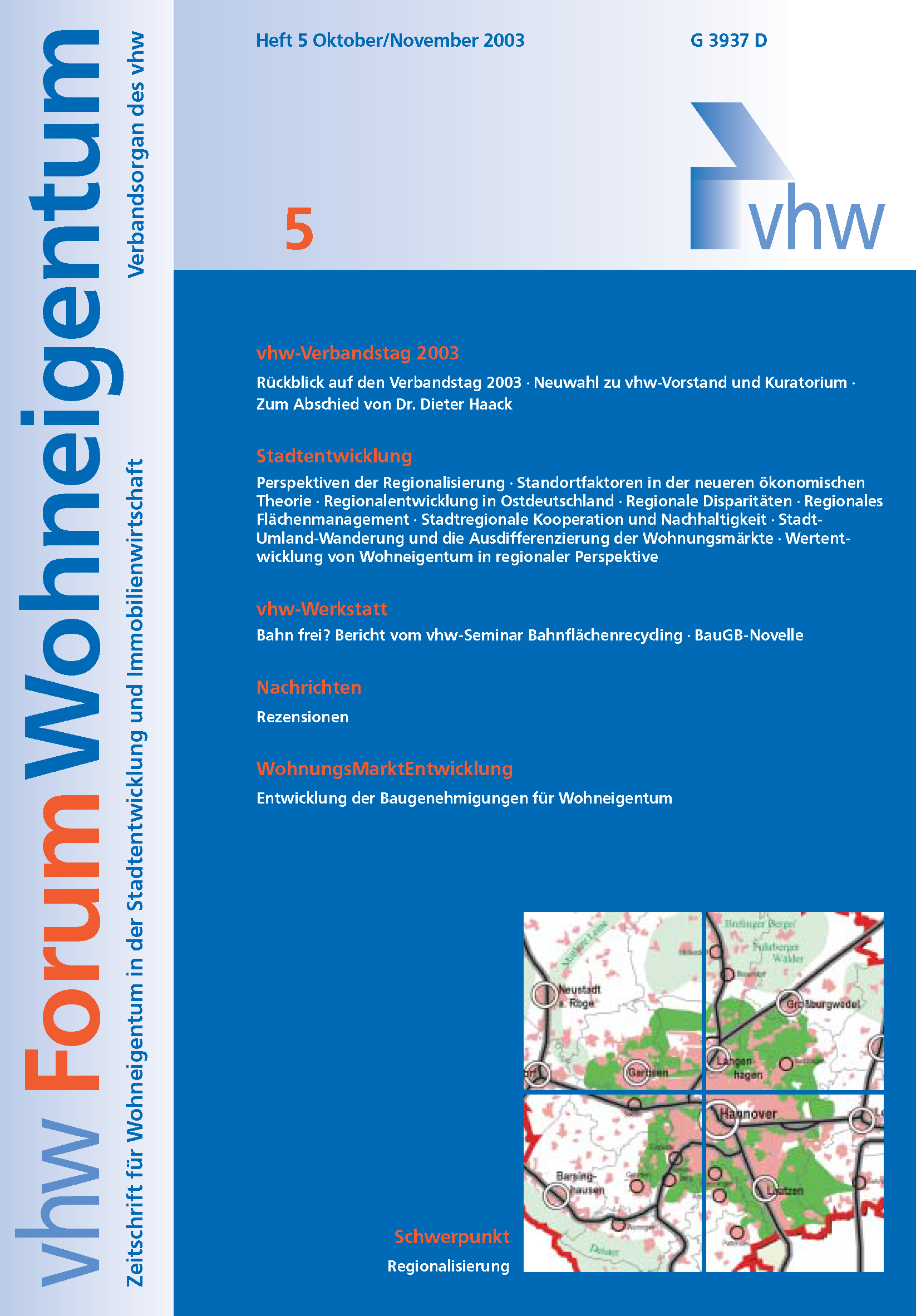
Erschienen in
Die fortschreitende Globalisierung, der europäische Integrationsprozess und neue Informations- und Kommunikationstechnologien haben den internationalen Standortwettbewerb verschärft. Ob Standorte im internationalen Wettbewerb um Firmen und hoch qualifizierte Arbeitskräfte erfolgreich sind, hängt von ihren Standortbedingungen ab. Im Folgenden wird dargestellt, welche Standortfaktoren in neueren ökonomischen Theorien der neuen Standorttheorie und der neuen Wachstumstheorie wesentlichen Einfluss auf die regionale Entwicklung nehmen. Hierbei wird begrifflich nicht zwischen Regionen und Standorten unterschieden, weil auch die betrachteten Theorien bezüglich dieser Begriffe keine inhaltliche Abgrenzung treffen.
Beiträge