
Erschienen in Heft 4/2025 Kommunales Gebäudemanagement

Erschienen in Heft 4/2025 Kommunales Gebäudemanagement

Erschienen in Heft 4/2025 Kommunales Gebäudemanagement

Erschienen in Heft 4/2025 Kommunales Gebäudemanagement
Am 6. Mai 2025 war es wieder so weit: Der renommierte Preis Soziale Stadt wurde bereits zum 13. Mal seit seiner Erstauslobung im Jahr 2000 vergeben. Rund 100 Gäste versammelten sich im Festsaal der Berliner Stadtmission am Hauptbahnhof und ehrten die fünf von der Jury ausgewählten Projekte aus ganz Deutschland. Insgesamt 111 Projekte wurden im Wettbewerb Preis Soziale Stadt 2025 eingereicht, von denen die Jury 15 in die sogenannte engere Wahl berief.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2025 Kommunales Gebäudemanagement
Der Beitrag befasst sich mit der Herausforderung kommunaler Gebäudebetreiber, fehlende Ressourcen mit den bestehenden Anforderungen an einen rechtskonformen Gebäudebetrieb in Einklang zu bringen. Dabei werden aktuelle gesetzgeberische Entwicklungen beim Neubau, der sachgerechte Umgang mit dem bestehenden technischen Regelwerk und die Frage, wie mit einem oft erheblichen Sanierungsstau mit Blick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen umgegangen werden kann, analysiert.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2025 Kommunales Gebäudemanagement
Kommunale Gebäude stellen einen wesentlichen Teil des Vermögens einer Kommune dar und sind für die Daseinsvorsorge sowie die Erfüllung öffentlicher Aufgaben von zentraler Bedeutung. Neben der baulichen Instandhaltung aller Bestandsimmobilien gehört die Gewährleistung der betrieblichen Sicherheit für Gebäude und Nutzer zu den Kernaufgaben der kommunalen Gebäudewirtschaft. Dabei geht es nicht nur um den Werterhalt und die effiziente Nutzung der Liegenschaften – auch eine Vielzahl gesetzlicher Vorgaben, Verordnungen und technischer Regeln ist einzuhalten, um die Immobilien rechtssicher bereitzustellen. Die Betreiberverantwortung ist ein zentrales Element im Gebäudemanagement, das aktiv gesteuert werden muss. Sie sollte sich in der Aufbau- und Ablauforganisation widerspiegeln und idealerweise im Selbstverständnis aller Fach- und Führungskräfte fest verankert sein.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2025 Nachhaltige Stadt- und Sportentwicklung
Die 19. Bundesrichtertagung des vhw fand am 2. Dezember 2024 wieder im Kardinal-Schulte-Haus in Bergisch Gladbach und zugleich live online statt. Inzwischen war es bereits Routine, dass Präsenzveranstaltung und digitale Teilnahme parallel laufen, und dank professioneller Veranstaltungstechnik, und engagierter Unterstützung durch viele vhw-Kolleginnen und -Kollegen im technischen Support gelang hier erneut ein reibungsloses Ineinandergreifen. Das Interesse war mit 340 Teilnahmen wieder enorm, und der vhw konnte rund 100 Gäste vor Ort sowie weitere 240 Teilnehmerinnen und Teilnehmer online in der ganzen Republik begrüßen: von Kiel, Anklam und Bergen auf Rügen bis München, Füssen und Freiburg, von Dresden und Cottbus bis Aachen und Düsseldorf. Sie alle erhielten einen exklusiven Rechtsprechungsbericht aus erster Hand und konnten sich mit Sprech- und Chatbeiträgen am Veranstaltungsgeschehen beteiligen. Diese Möglichkeit wurde eifrig genutzt, und der zwischen den zwei Welten der „Zoomies“ und der „Roomies“ moderierende vhw-Kollege Philipp Sachsinger meisterte es, die virtuellen Gäste mit ihren Fragen zu Wort kommen zu lassen und die digitalen Beiträge ggf. nach Themenblöcken zu strukturieren, zusammenzufassen und zu referieren.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2025 Nachhaltige Stadt- und Sportentwicklung
Das Auto ist bekanntlich des Deutschen liebstes Kind. Parkhäuser und Tiefgaragen, um Pkw unterzustellen, sind es mitnichten. Viele Kommunen schieben notwendige Zukunftsinvestitionen in ihre Parkobjekte vor sich her. Oft fehlt es an Know-how und Budget. Dabei stehen Parkhäuser und Tiefgaragen vor einer tiefgreifenden Transformation: Sie sollten mit E-Ladeinfrastruktur, schrankenlosen Ein- und Ausfahrten sowie einem Online-Vorausbuchungs- und bargeldlosen Bezahlsystem ausgestattet werden. Was Kommunen und private Betreiber darüber hinaus beachten sollten.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2025 Nachhaltige Stadt- und Sportentwicklung
Erfolg im Sport ist von dem gleichen sprichwörtlichen langen Atem geprägt wie der Erfolg einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Das allein stellt den Zusammenhang aber nicht her. Stadtentwicklung hat den Menschen zu dienen, die in der jeweiligen Kommune wohnen und leben. Nachhaltige Stadtentwicklung noch viel mehr, weil sie schon begriffsnotwendig den Menschen in seinem Lebensumfeld „Stadt“ in den Mittelpunkt stellt. Ein integriertes und nachhaltiges Lebensumfeld bringt Menschen zusammen, schafft Gemeinschaft. Sport bringt gleichermaßen Menschen zusammen. Sport ist niederschwellig, Sport braucht keine Sprache, ist vielfältig international und generationenübergreifend. Sport fordert auf, er bringt zusammen, er bringt in Bewegung, er inspiriert und hat die Kraft, die Welt zu verändern. In dieser Begrifflichkeit werden im vorliegenden Beitrag Sport und nachhaltige Stadtentwicklung zusammengeführt und ins Verhältnis gesetzt. Es wird ein Musterprozess vorgestellt, der sich zwischen Haltung, Labor, Suchen und Finden bewegt. Gleichzeitig ist es ein Beitrag auf der Suche nach dem besseren Wissen, um eben diesen Musterprozess in der eigenen Stadt gestalten zu können – jeden Tag neu.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2025 Nachhaltige Stadt- und Sportentwicklung
Angesichts multipler Krisen und den vielfältigen Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung stehen unsere Städte vor tiefgreifenden Veränderungen. Klimawandel, urbane Mobilität, sanierungsbedürftige Infrastrukturen und Wohnungsmangel, soziale Gerechtigkeit sowie Gesundheit und Lebensqualität der städtischen Bevölkerung sind zentrale Themen für die Zukunft unserer Städte. Eine Antwort auf diese Herausforderungen ist eine nachhaltigkeitsorientierte und alle Facetten der Stadtgesellschaft umfassende Stadtentwicklung. Nicht zuletzt trägt ein struktureller Wandel der Städte maßgeblich zu einer globalen nachhaltigen Entwicklung bei und ist ein entscheidendes Element einer „großen“ gesellschaftlichen Transformation.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2025 Nachhaltige Stadt- und Sportentwicklung
Nicht erst seit, aber erst recht in der Coronazeit, erlebte die Thematik „Sport und Bewegung im Freien“ eine nie dagewesene Bedeutung. Während Spaziergänge, Wanderungen und Radtouren sich landauf landab größter Beliebtheit erfreuten, wurden diese Jahre der Einschränkungen in Karlsruhe zum Booster für vielfältige neue Sportangebote und verhalfen beispielsweise den Sportboxen von App and Move zu einer flächendeckenden Verbreitung im Stadtgebiet oder sorgten in Karlsruhe beim TSV Bulach durch die Errichtung einer Outdoorfitnessanlage für einen nie dagewesenen Mitgliederzuwachs. Mit der Ausrichtung der World Games 2029 verbindet die Stadt Karlsruhe mehrere Ziele: Ein großer Schwerpunkt der Jahre vor den World Games und auch während der Spiele selbst liegt nämlich darin, die Bevölkerung, d. h. Jung und Alt, zum Mit- und Nachmachen anzuregen. Damit wird ein Bewusstsein für Sport und Bewegung als Schlüssel für ein gesundes und erfülltes Leben erzeugt.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2025 Nachhaltige Stadt- und Sportentwicklung
Klima im Wandel: Die globale Durchschnittstemperatur lag 2024 1,6 °C über dem vorindustriellen Niveau (1850–1900) und war das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1850 (Copernicus 2025). Das im Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 formulierte Ziel einer Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 °C bis 2050 wurde damit erstmals überschritten. Auch in Deutschland war 2024 das bisher wärmste Jahr. Im Vergleich zu den ersten 30 Jahren der systematischen Auswertungen (1881–1910) lag hier die Durchschnittstemperatur 2024 sogar um circa 1,9 °C höher (DWD 2025). Diese Entwicklung wird sich fortsetzen. Für den Zeitraum 2030–2060 prognostiziert das Umweltbundesamt je nach Emissionsszenario eine Erhöhung von bis zu knapp über 3 °C gegenüber dem Zeitraum 1881–1910, wobei die Erwärmung im Süden Deutschlands stärker ausgeprägt sein wird als im Norden (UBA 2023). Die Ursache der starken Erwärmung – darin ist sich die Wissenschaft einig – ist der von menschlichen Einflüssen verursachte Ausstoß von Treibhausgasen, insbesondere Kohlendioxid (IPCC 2024).
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2025 Kommunen zwischen Zukunftsorientierung und Gegenwartsbezug
Private Haushalte haben unterschiedliche Anforderungen und Wünsche an ihren Wohnort. Diese hängen ab von der jeweiligen Lebensphase und Lebenslage, aber auch von den individuellen Vorstellungen, Präferenzen, Lebensstilen und Aktivitätsmustern der Haushaltsmitglieder. Für die tatsächlichen Wohnstandortentscheidungen besitzen dann auch die Ressourcen des Haushalts und die Rahmenbedingungen der Angebotsseite zentrale Bedeutung. Bei begrenzten Ressourcen und einem anbietergesteuerten, knappen Immobilienmarkt wirken diese Ressourcen und Rahmenbedingungen vor allem im Sinne von Beschränkungen des mentalen und räumlichen Suchrasters. Das ‚mentale Suchraster‘ deutet dabei an, dass bereits die Wünsche und Präferenzen durch diese Rahmenbedingungen und Ressourcen ‚zensiert‘ sein können – warum sollte man sich etwas wünschen, von dem man weiß, dass es nicht realisierbar ist?
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2025 Kommunen zwischen Zukunftsorientierung und Gegenwartsbezug
Im Rahmen der von der Nationalen Stadtentwicklungspolitik geförderten Vernetzungsinitiative „Gemeinsam für das Quartier“ hat der Deutsche Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V. (DV) gemeinsam mit Prof. Reiner Schmidt (Netzwerk Stadt als Campus) ein Empfehlungspapier vorgelegt. Darin wird die kulturelle Quartiersentwicklung aus Perspektive der Wohnungswirtschaft beleuchtet. Aufbauend auf diesen Ergebnissen fand die Tagung „Kulturelle Stadtentwicklung in Wohnquartieren – Beiträge von Wohnungswirtschaft und Stadtmacher:innen“ des vhw und der Vernetzungsinitiative statt. Sie machte die Vielschichtigkeit und Wirksamkeit kultureller Strukturen und Aktivitäten deutlich. Ziel der gemeinsamen Veranstaltung war es, die wohnungswirtschaftliche Sichtweise mit der Perspektive quartiersbezogener, selbstorganisierter Kultur- und Kreativarbeit durch Stadtmachendenakteure zu verbinden und die beiden Ansätze miteinander in Beziehung zu setzen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2025 Kommunen zwischen Zukunftsorientierung und Gegenwartsbezug
Kommunale Akteure sehen sich zunehmend mit globalen Krisen und plötzlichen lokalen Ereignissen konfrontiert, die Verwaltungspraxis, politisches Handeln und planerische Zielsysteme auf die Probe stellen. Diese einschneidenden und überraschenden Ereignisse markieren einen Bruch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, bringen bisherige institutionelle Routinen ins Wanken und machen als Disruptionen Wandel unausweichlich. Was bedeutet dies für die Handlungs- und Strategiefähigkeit kommunaler Planung in der Stadtentwicklung?
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2025 Infrastrukturen in ländlichen Räumen
Die Energiewende in den verschiedenen Sektoren (Strom-, Wärme- und Verkehrssektor) zeigt sich in ländlichen Räumen mit spezifischen Charakteristika. Diese unterscheiden sich erheblich von anderen Raumkategorien, wie stärker verdichteten stadt-regionalen Gebieten. Den ländlichen Räumen werden aufgrund bestehender Standortvorteile, wie großen Freiflächenpotenzialen, positive Entwicklungschancen durch die Energiewende zugeschrieben. Aber was steckt wirklich dahinter? Wo stehen wir mit der Energiewende auf dem Land? Wie sehen heute die tatsächlichen Potenziale für den ländlichen Raum und das Gelingen der Energiewende aus? Und welche Konflikte treten dabei vielleicht zutage?
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2025 Infrastrukturen in ländlichen Räumen
Seit rund 15 Jahren wird in Deutschland zunehmend intensiv über die Sicherung der ambulanten Gesundheitsversorgung diskutiert. Während die Debatte in besonders ländlichen und peripheren Regionen begann, hat sie längst auch Eingang in urbane Räume und Beachtung in der breiten Gesellschaft gefunden. Denn das Thema Gesundheitsversorgung ist ein besonders sensibles. Wenngleich die Sicherung der ambulanten (vertragsärztlichen) Versorgung im Wesentlichen den Kassenärztlichen Vereinigungen obliegt, wächst in vielen Kommunen der Druck, das Thema auf die Agenda zu setzen. Denn die Kommunen werden von ihren Bürgerinnen und Bürgern nicht nur als erste Ansprechpartnerin, sondern auch in einer grundsätzlichen Zuständigkeit für die Fragen der lokalen Daseinsvorsorge und Lebensqualität wahrgenommen. Vor diesem Hintergrund werden sie mit den vor Ort spürbaren Problemen, wie Praxisschließungen, langen Wartezeiten und größer werdenden Distanzen für den Arztbesuch, konfrontiert. Diese Probleme sind das Ergebnis einiger seit Jahren oder gar Jahrzehnten zu beobachtenden Entwicklungen.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2025 Infrastrukturen in ländlichen Räumen

Erschienen in Heft 2/2025 Nachhaltige Stadt- und Sportentwicklung

Erschienen in Heft 2/2025 Nachhaltige Stadt- und Sportentwicklung

Erschienen in Heft 2/2025 Nachhaltige Stadt- und Sportentwicklung

Erschienen in Heft 4/2025 Kommunales Gebäudemanagement
Der Begriff der „Betreiberverantwortung“ löst mancherorts im öffentlichen Gebäudemanagement immer noch eine gewisse Beunruhigung aus. Doch warum eigentlich? Und warum ist Betreiberverantwortung keine alleinige Aufgabe des Gebäudemanagements, sondern der Gesamtverwaltung? Um diese Fragen soll es in dem nachfolgenden Beitrag gehen.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2019 Vertrauen in der Stadtgesellschaft
Trotz der hohen Popularität von Vertrauen in gesellschaftlichen Debatten bleibt der Vertrauensbegriff meist ein vages Konzept, das nicht weiter ausdifferenziert wird. Ziel des vorliegenden Artikels ist es, Vertrauen wissenschaftlich herzuleiten und einzuordnen, um es dann als Analyseinstrument auf aktuelle Herausforderungen von Stadtentwicklung und Wohnungswirtschaft anzuwenden. Hierzu dient ein Fallbeispiel aus den USA, anhand dessen Spannungen in der Stadtgesellschaft aufgezeigt und mithilfe des Vertrauensbegriffs aus einer neuen Perspektive betrachtet werden können.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2019 Vertrauen in der Stadtgesellschaft
Forderungen nach mehr Transparenz haben auch in der Stadtpolitik Konjunktur. Verbunden sind damit hohe Erwartungen. Der Deutsche Städtetag sieht in der Bereitstellung von Informationen, der Verbesserung der Kommunikation, des Dialogs und der Transparenz unabdingbare Voraussetzungen „um Akzeptanz für lokale Entscheidungen zu schaffen bzw. neu zu gewinnen“ (Deutscher Städtetag 2013). Mit seinem Projekt „Städtenetzwerk zur Stärkung der Lokalen Demokratie“ verband der vhw ähnlich große Erwartungen: „Je mehr es gelingt, Transparenz und partizipatorische Demokratieelemente in das repräsentative Demokratiemodell vor Ort einzubringen, desto mehr dürfte lokale Demokratie ihre Vorbildfunktion für das demokratische Gemeinwesen insgesamt einlösen können“ (Rohland/Kuder 2011).
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2019 Vertrauen in der Stadtgesellschaft
In zahlreichen Städten ist derzeit ein Vertrauensverlust von Bürgerinnen und Bürgern in die kommunale Politik und Verwaltung zu beobachten. Dabei ist Vertrauen zentral für die Beziehung zwischen den lokalen Akteuren und somit für eine handlungsfähige Stadtentwicklungspolitik, so die wesentliche These des Beitrags. Kommt es jedoch zu einem „zerstörerischen Misstrauen“, rücken bisher bewährte Mechanismen einer Abwägung und Entscheidungsfindung in den Blick. Es stellen sich in der Folge grundsätzliche Fragen nach den konstituierenden Faktoren von Vertrauen und Misstrauen in der Stadtentwicklung sowie den Ursachen für lokale, stadtspezifische Vertrauenskulturen.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2019 Vertrauen in der Stadtgesellschaft
Unser Verständnis von Stadtentwicklungsprozessen – und der Rolle, die Bürgerbeteiligung dabei spielt – bedarf ständigen „Neu-Denkens“. Aber selten gab es so viele Anlässe, diese Aufforderung ernst zu nehmen wie in diesen Tagen. Dabei nimmt das kommunikative Umfeld, in dem Aufgaben der Stadtentwicklung bearbeitet werden, eine besondere Rolle ein. Denn der hier zu beobachtende Wandel bleibt nicht ohne Einfluss auf Substanz und Gestaltung der Verständigung in Stadtentwicklungsprozessen. Bei alledem spielt das Thema „Vertrauen“ eine wesentliche Rolle. Dies soll mit einigen Schlaglichtern erläutert werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2019 Vertrauen in der Stadtgesellschaft

Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht

Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht

Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht
Eine Rezension des Buches „Boden behalten – Stadt gestalten“
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht
Der vhw verzeichnet mit der Stadt Halle (Saale) das 2.000ste Mitglied des Verbandes. Wir gratulieren an dieser Stelle nicht nur herzlich, sondern nutzen die Gelegenheit für ein Kurzporträt der Stadt und der aktuellen stadtentwicklungspolitischen Herausforderungen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht
Viele Kommunen wollen mehr Wohnraum durch Nachverdichtung schaffen. Bei manchen Projekten besteht der wirtschaftlich sinnvollste Weg darin, das Mietshaus, das Anforderungen an Ausstattung, Grundrisse und Gebäudedämmung nicht erfüllt, abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen, bei dem das Grundstück besser ausgenutzt wird. So entstehen am Ende mehr Wohnflächen. Außenparkplätze wandern in eine neue Tiefgarage unter den Neubau. Die rechtlichen Hürden, die damit einhergehen, dass den Mietern gekündigt werden darf, sind hoch. Was müssen Eigentümer beachten?
Beiträge

Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht
Das Erbbaurecht fristet in Deutschland auch 100 Jahre nach Inkrafttreten am 15. Januar 1919 ein Nischendasein. Es ist kaum verbreitet und es herrschen viele Vorurteile in den Köpfen von Eigentümern, Investoren und Wohnungssuchenden. Dabei vergünstigt es den Immobilienerwerb und ist äußerst flexibel, weil Erbbaurechte vererbt, veräußert und beliehen werden können. Hinzu kommt, dass es sich sowohl für Wohn- wie für Gewerbeimmobilien eignet. Kommunen können Flächen gemäß diesem Modell auch für große Infrastrukturmaßnahmen vergeben wie etwa für Flughäfen oder Gewerbegebiete. Es sichert Grundstückseigentümern durch den Erbbauzins einen langfristigen Cashflow, dessen Höhe regelmäßig gemäß dem Verbraucherpreisindex angepasst werden kann.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht
Das Erbbaurecht ist für die Vermögensplanung ebenso wie für die Wohnungspolitik ein oft unterschätztes Instrument. Dabei ist es keineswegs ein deutsches Phänomen. Man findet es in unterschiedlichen Ausgestaltungen in vielen anderen Ländern. In England, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz ist es weit verbreitet und als Instrument der Eigentumsbildung gut akzeptiert. Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein Blick über den nationalen Tellerrand.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht
Während Erbbaurechte international über alle Immobilienarten hinweg weit verbreitet sind, fristen sie in Deutschland weiterhin ein Schattendasein. In den meisten Fällen sind es Kommunen, Kirchen und Stiftungen, die in Deutschland Erbbaurechte vergeben. Diese streben eine möglichst risikoarme, aber dennoch wirtschaftliche Nutzung ihres Grundbesitzes an und sichern mit Hilfe des Erbbaurechtsmodells den langfristigen Erhalt ihres Grundbesitzes. Erbbaurechtsnehmer sind hierbei in erster Linie Privatpersonen, die über das Erbbaurechtsmodell in die Lage versetzt werden, Wohneigentum eigenkapitalschonend zu realisieren. Als reine finanztechnische Strukturierungsvariante – also unabhängig von dem Interesse, Grundbesitz dauerhaft zu sichern – findet das Erbbaurechtsmodell in der Praxis bisher nur eine geringe Resonanz. Wie Erbbaurechtsmodelle Investoren dabei helfen können, ihre Anlageziele zu erreichen, soll in dem nachfolgenden Beitrag dargestellt werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht
Vor 100 Jahren trat das deutsche Erbbaurechtsgesetz in Kraft. Ziel war es, preisgünstiges Wohnen für breite Bevölkerungsschichten zu ermöglichen. Angesichts der aktuellen Herausforderung, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und auch perspektivisch zu sichern, erfährt das Erbbaurecht eine politische Renaissance. Erbbau-Prinzip ist eine Trennung der Eigentumsverhältnisse von Boden und Gebäude für eine festgelegte Zeitdauer. Der Erbbaurechtsnehmer nutzt das Grundstück des Erbbaurechtsgebers, um zumeist ein Gebäude darauf zu errichten. Dafür zahlt er Erbbauzinsen an den Grundstückseigentümer. Der Inhalt des Erbbaurechts wird in einem Erbbaurechtsvertrag zwischen den Vertragspartnern festgelegt. Dabei können Erbbaurechtsverträge individuell gestaltet werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht
Das Erbbaurecht ausschließlich als ein Instrument „zur Behebung der größten Wohnungsnot“ anzusehen, greift zu kurz. Natürlich muss das Erbbaurecht heute modern gedacht werden, es ist allerdings auch voraussetzungsvoll. Eine Gelingensbedingung für das Erbbaurecht ist die Abkehr von der Idee des Volleigentums am Boden. Das Instrument ist vielmehr auf die Grundstücksverfügung des Erbbaurechtsausgebers angewiesen. Welche Rolle spielt hierbei die (bislang recht obskure) Sozialpflichtigkeit des Eigentums aus Art. 14 Abs. 2 GG? Welche Fortentwicklungsmöglichkeiten bestehen?
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht
Berlin war die Stadt der Freiräume. Verlassene Wohnungen, Hallen, leere Kaufhäuser, alte E-Werke, offene Räume gab es an jeder Ecke. Der Zugang war direkt. Wenn es überhaupt um Miete ging, war sie günstig, die Stadt ein Experimentierfeld für Kreative, Müßiggänger und Hedonisten. Der anarchische Moment zu Beginn der 1990er, der Clubs, Bars, Ausstellungsräume, Galerien, günstiges und umsonst Wohnen und viele andere Inbesitznahmen ermöglichte, legte auch die Basis für das kreative Image der Stadt und wurde 2003 mit Klaus Wowereits Ausspruch „Berlin ist arm, aber sexy“ zum Kern des Berlinmarketings. Kultur war Kapital geworden. Auf der anderen Seite fehlte es der ehemals geteilten Stadt an Wirtschaftskraft.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht
Damit Erbbaurechte sich auch wirklich gegenüber Volleigentum durchsetzen können, müssen sie marktgerecht ausgestaltet sein. „Marktgerecht“ bedeutet, dass die Akteure das Erbbaurecht nicht nur deswegen wählen, weil sie mangels Alternativen faktisch dazu gezwungen werden, sondern weil sie es als mindestens gleichwertig gegenüber dem Volleigentum an einer Immobilie erachten. Gleichwertig – in Bezug auf was? Bei Anlageentscheidungen geht es niemals nur alleine um die Rendite, sondern auch um das Risiko. Mehr Rendite ist i.d.R. nur zu haben, wenn man zur Übernahme eines entsprechend höheren Risikos bereit ist.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht
Der Flächenmangel in den Ballungszentren, allen voran im Bereich der Wohnimmobilien, bewegt viele Kommunen dazu, ihre Vergabestrategien zu überdenken. Dabei kommt auch ein alter Klassiker wieder auf die Tagesordnung, der lange Zeit – zumindest in der öffentlichen Debatte – eher ein Schattendasein gefristet hat: das Erbbaurecht. Für die aktuelle Problematik auf den Wohnungsmärkten dürfte die Umstellung von Verkauf auf Grundverleih keine rasche Lösung bringen. Doch die Kommunen haben aus der akuten Flächenknappheit gelernt, sich auf lange Sicht mehr Flexibilität und Kontrolle über Bauland in ihrem Wirkungsbereich vorzubehalten. Damit könnte das deutsche Erbbaurecht, das in seiner jetzigen Form gerade sein 100-jähriges Jubiläum feiert, zu einer wachsenden Größe auf den Immobilienmärkten werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht
Auf der Internetseite der Stadt Frankfurt am Main ist zu lesen: „Die Vergabe von städtischen Grundstücken erfolgt derzeit in der Regel durch die Bestellung von neuen Erbbaurechten, sodass die Zahl von städtischen Erbbaurechten weiter steigen wird.“ Die Stadt München legt in ihrem wohnungspolitischen Handlungsprogramm „Wohnen in München VI“ fest, dass sie bis 2021 mehr Grundstücke im Erbbaurecht vergeben möchte, um „langfristig bezahlbaren Mietwohnungsbau zu sichern“. In Hamburg erklärte die rot-grüne Regierung am 14. Juni 2017, dass sie strategisch wichtige städtische Grundstücke wieder vermehrt im Erbbaurecht vergeben wolle.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht
Kontinuierlich steigende Bodenpreise, eine zunehmende Verdrängung von Geringverdienern bis hin zum Mittelstand an die Stadtränder und darüber hinaus sowie die anhaltende Zersiedlung der Landschaft haben sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland die Debatte über den Umgang mit der knappen Ressource Boden anschwellen lassen. Hier wie dort gewinnt aus guten Gründen das Erbbaurecht als bedeutendes bodenpolitisches Instrument an Aufmerksamkeit.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht
Das Erbbaurecht besteht in Deutschland seit Jahrhunderten. Das Erbbaurechtsgesetz (ErbbauRG) hat es im Jahre 1919 praktikabel geformt und die Beleihungsfähigkeit hergestellt. Seitdem wurde es immer dann erfolgreich angewandt, wenn Wohnungen knapp waren oder festgelegte Nutzungen etabliert werden sollten. Heute steht vor allem die Frage nach bezahlbarem Wohnraum, die klar unterstützt werden kann. Mit dem Erbbaurecht sind Mythen verbunden, die einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise nicht standhalten. Das Erbbaurecht platziert sich zwischen Mieten und Kaufen und bildet einen eigenen Markt mit eigenen Regeln. Im Folgenden werden wirtschaftliche Kriterien aufgezeigt, die die praktischen Erfahrungen seit dem Erlass des Erbbaurechtsgesetzes einbeziehen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2019 100 Jahre Erbbaurecht

Erschienen in Heft 5/2019 Stadtentwicklung und Klimawandel

Erschienen in Heft 5/2019 Stadtentwicklung und Klimawandel

Erschienen in Heft 5/2019 Stadtentwicklung und Klimawandel
Wo sich das Stadtteilmuseum von Friedrichshain-Kreuzberg befindet? Das weiß so gut wie jeder in dem südöstlich der Berliner Mitte gelegenen Bezirk, haben Studierende des Institutes für Stadt- und Regionalplanung der TU Berlin vor einiger Zeit herausgefunden. In einem Seminar zur Stadtentwicklung haben sie sich mit der Rolle des Museums für den Stadtteil beschäftigt. Ihre Erkenntnis: Das Friedrichshain-Kreuzberg-Museum – kurz „FHXB“ –, ein roter Klinkerbau in der Adalbertstraße, ist ein lebendiger Ort, der Vernetzung und Nachbarschaftlichkeit voranbringt. Das lässt nicht nur die Biertischgarnitur vor der Tür vermuten. Das Haus versteht sich als Heimatmuseum neuen Typs, es hat sich geöffnet für die Menschen, die hier leben, Junge wie Alte, Zugewanderte wie Alteingesessene, und erzählt mit ihnen die vielfältigen Geschichten des Stadtteils.
Beiträge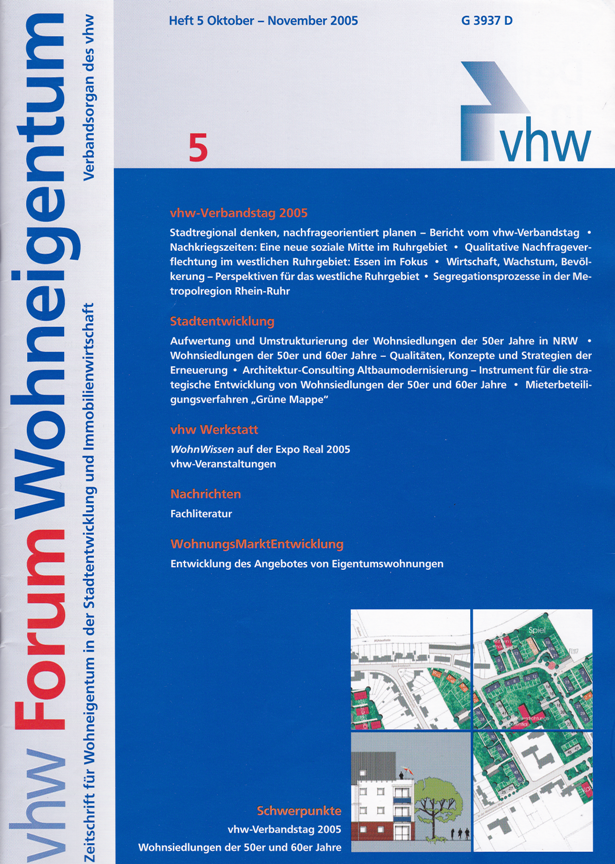
Erschienen in Heft 5/2005 vhw Verbandstag 2005, Siedlungen der 50er und 60er Jahre
Die als Segregation bezeichnete räumliche "Entmischung", d. h. die Entstehung relativ homogener, voneinander sehr verschiedener Teilräume, ist charakteristisch für städtische Gebiete. Wahrscheinlich ist eine gewisse "Spezialisierung" der Stadtteile sogar eine Voraussetzung für die Prosperität verdichteter Siedlungsräume. So können wir uns Städte bis heute kaum ohne ihre Geschäftszentren vorstellen, in denen sich die Dienstleistungsfunktionen konzentrieren. Ebenso gehören typische, von sozialen oder ethnischen Gruppen geprägte Nachbarschaften zum Bild der Städte. Seit den 1990er Jahren wird in Raumforschung und Regionalpolitik kontrovers über die – bis heute umstrittene – Vermutung diskutiert, im Zusammenhang mit globalen wirtschaftsräumlichen Veränderungen könnte es zur Zunahme regionaler und lokaler Ungleichheiten und zur Häufung sozialer Belastungen in bestimmten Stadtteilen kommen. Ungeklärt ist, welche regionalpolitischen Konsequenzen zu ziehen sind, wenn sich gesellschaftliche Probleme in Zukunft zunehmend kleinräumig fokussieren sollten. Um dies genauer beurteilen zu können, sind umfassende Analysen der Prozesse, die zur Bildung regionaler und innerstädtischer Ungleichgewichte führen sowie ihrer Auswirkungen auf die Entwicklung von Stadtregionen erforderlich.
Beiträge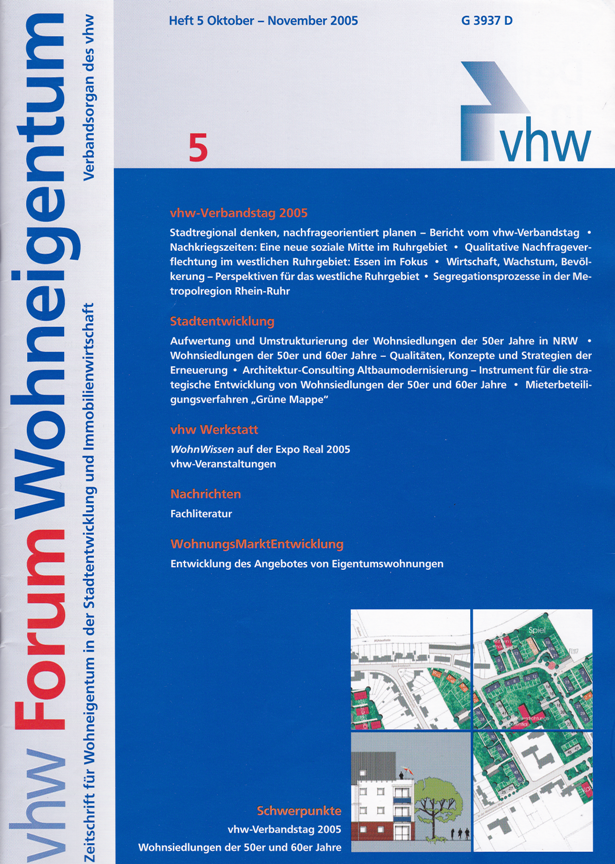
Erschienen in Heft 5/2005 vhw Verbandstag 2005, Siedlungen der 50er und 60er Jahre
Wachstum, Dynamik, Verjüngung – sind das die Begriffe, mit denen sich die Zukunft des Ruhrgebiets beschreiben lässt? Oder geht es realistisch betrachtet nicht viel mehr um Schrumpfung, Anpassung, Alterung? Es kommt auf die Strategie an: Für Regionen, die sich auf ihre Kompetenzen und Potenziale besinnen, bieten alle Prognosen zu Demographie, wachsendem Innovationsdruck und Standortkonkurrenz auch Chancen.
Beiträge