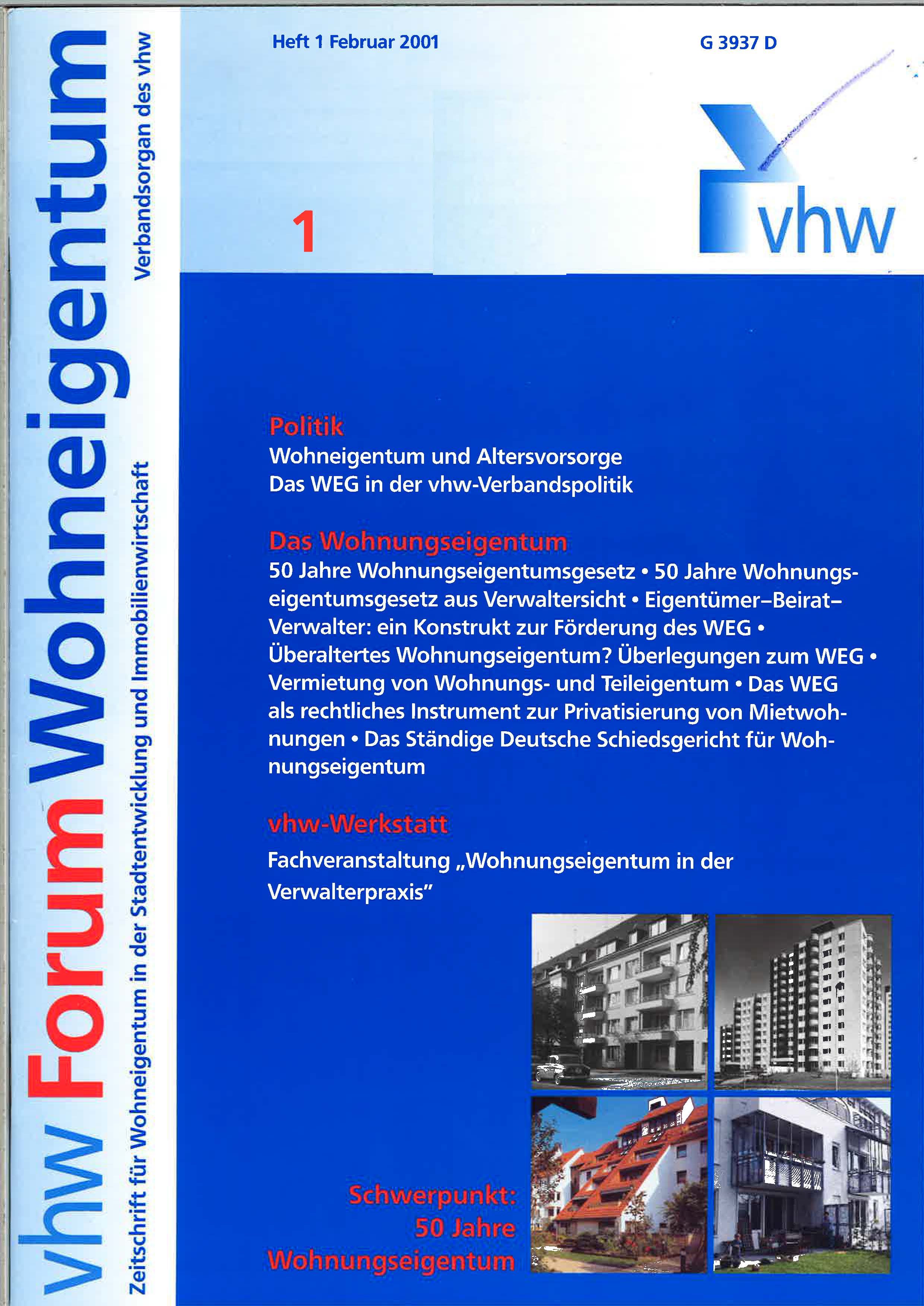
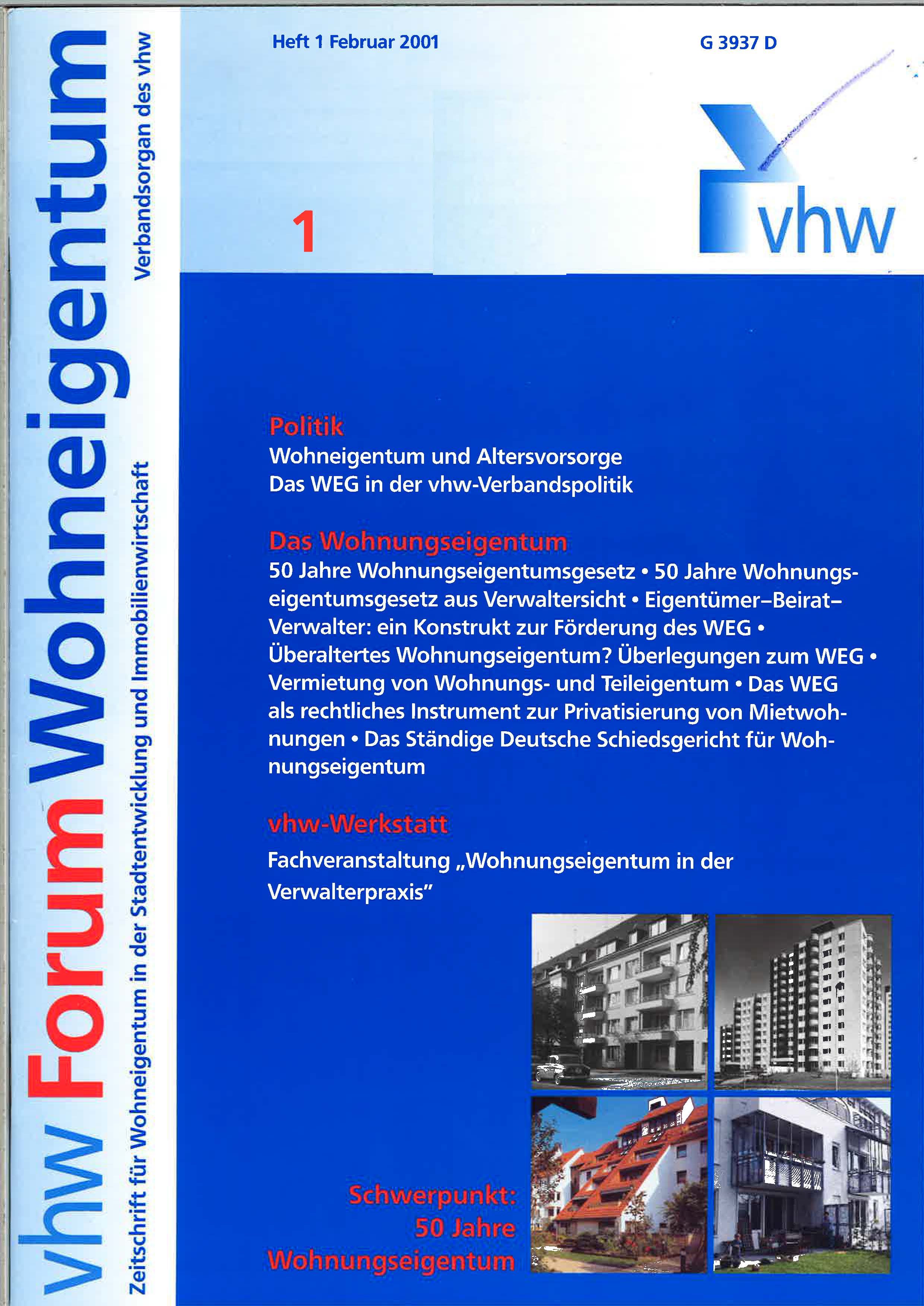
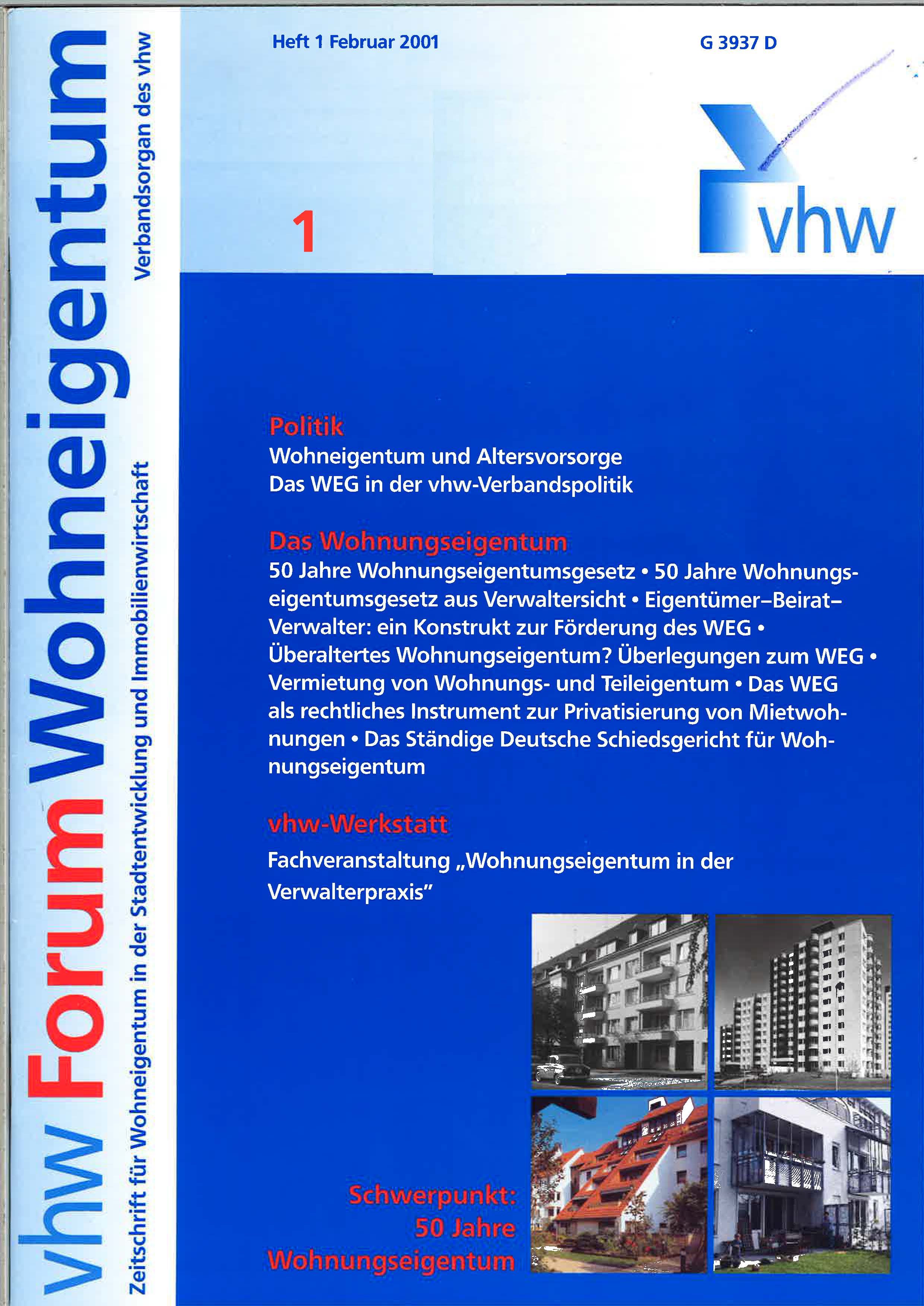
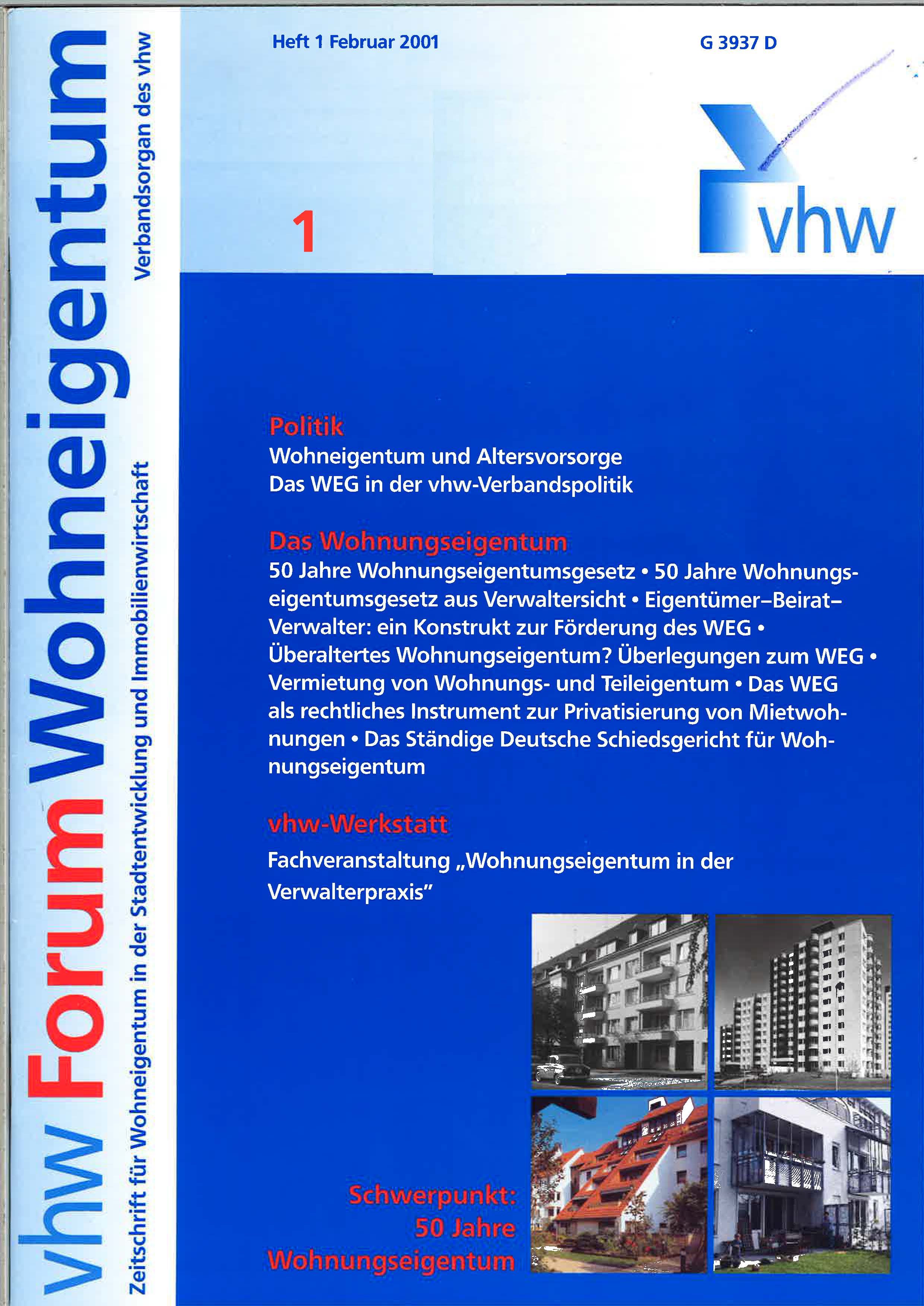
Erschienen in
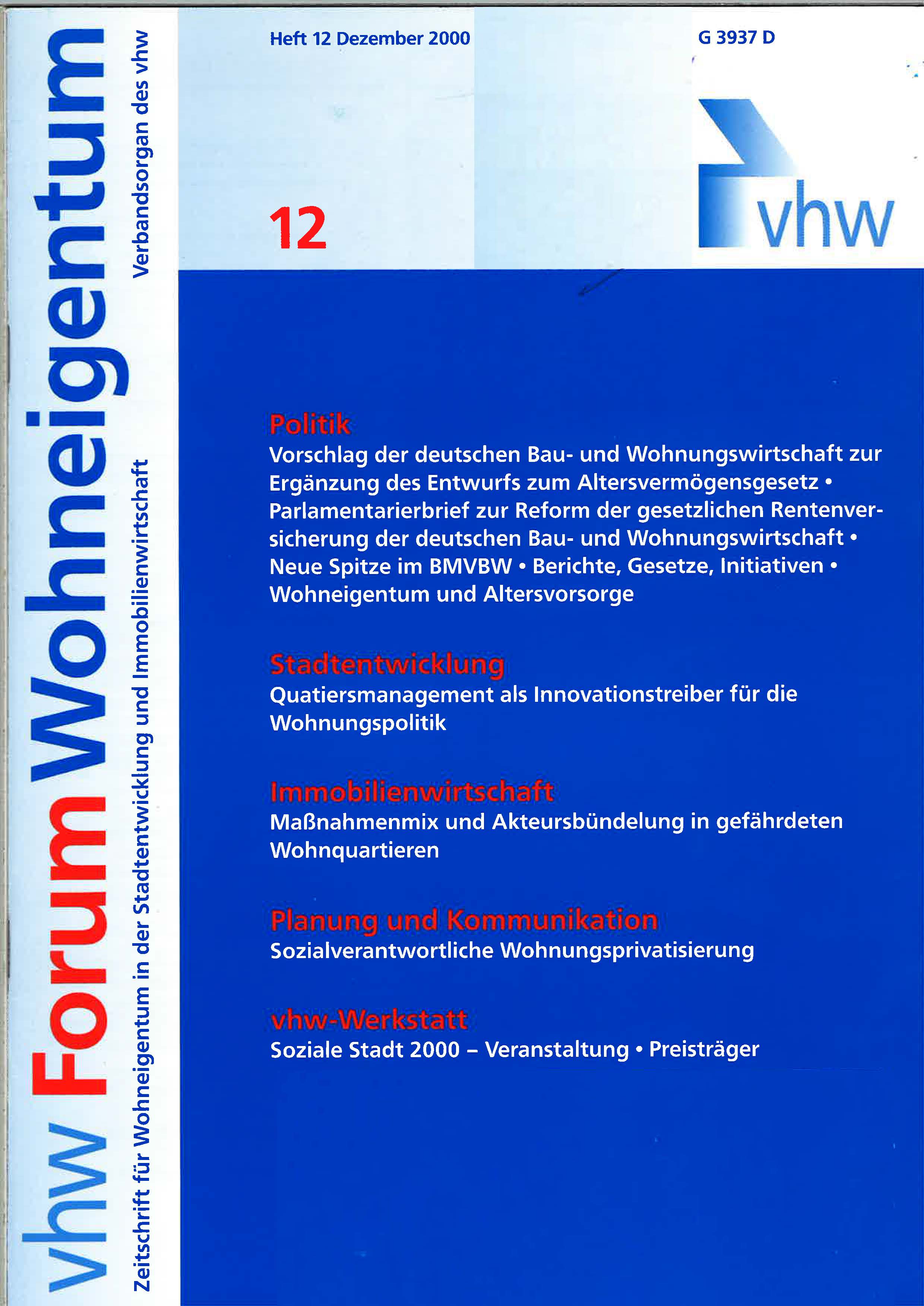
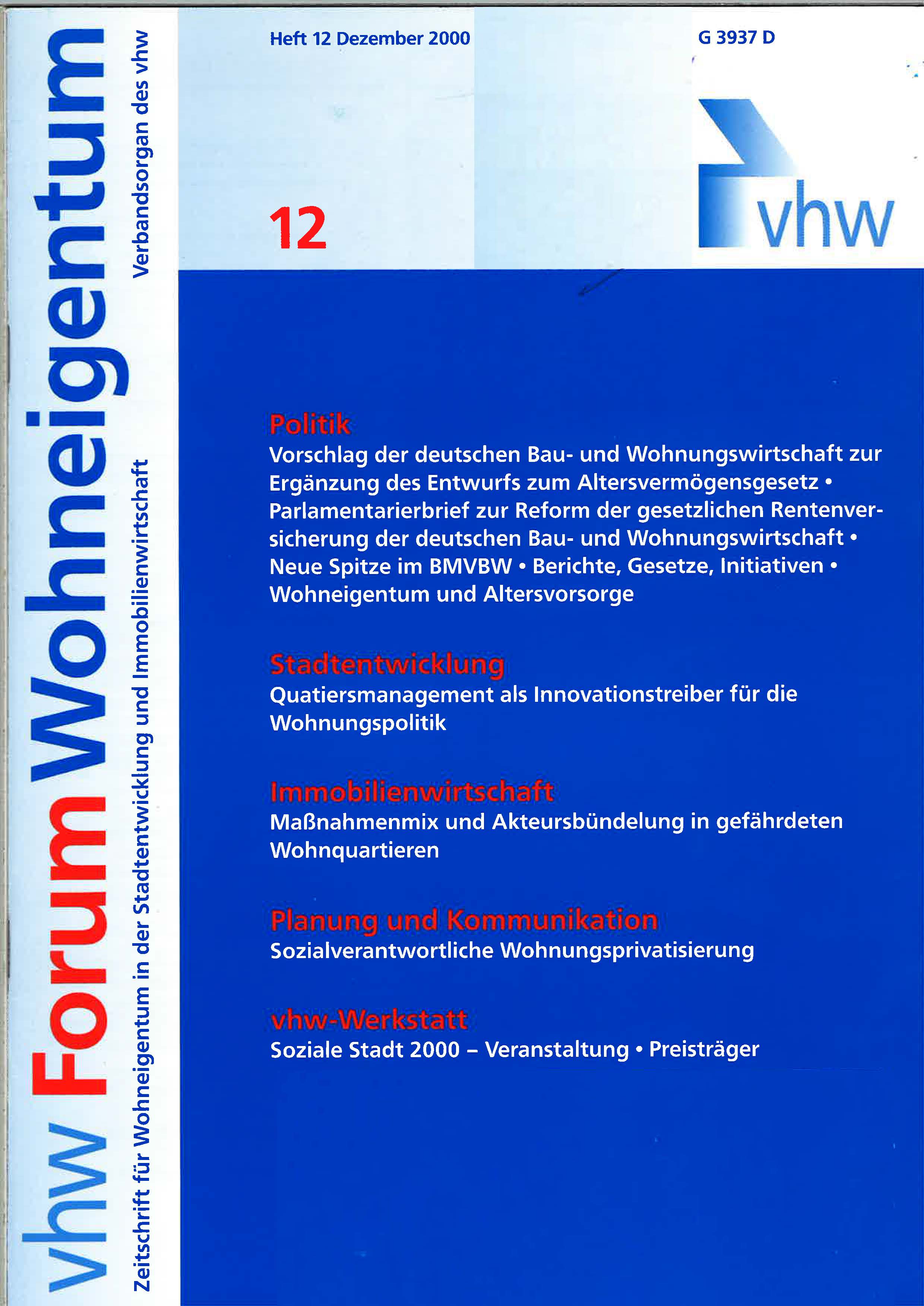
Erschienen in
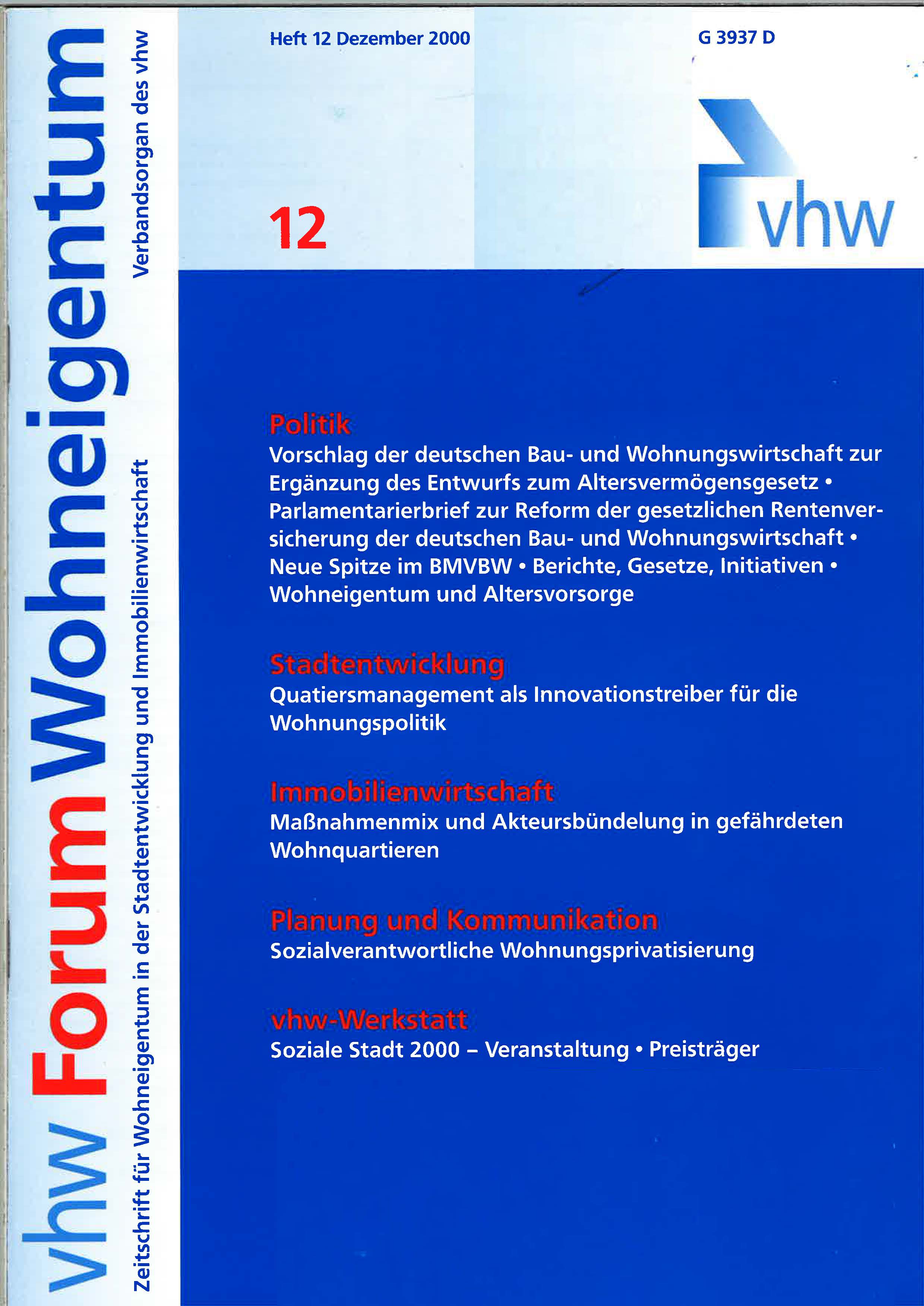
Erschienen in
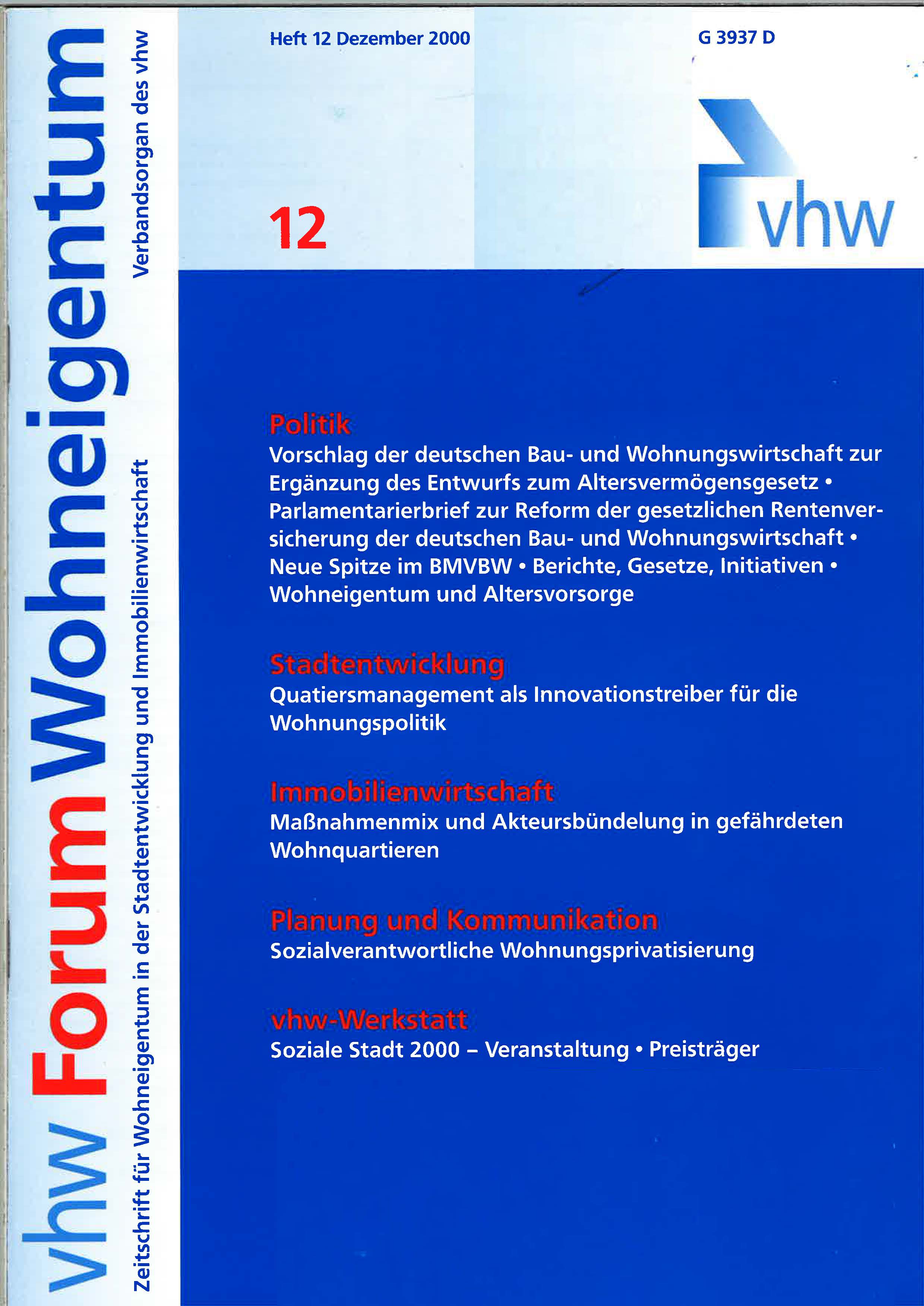
Erschienen in
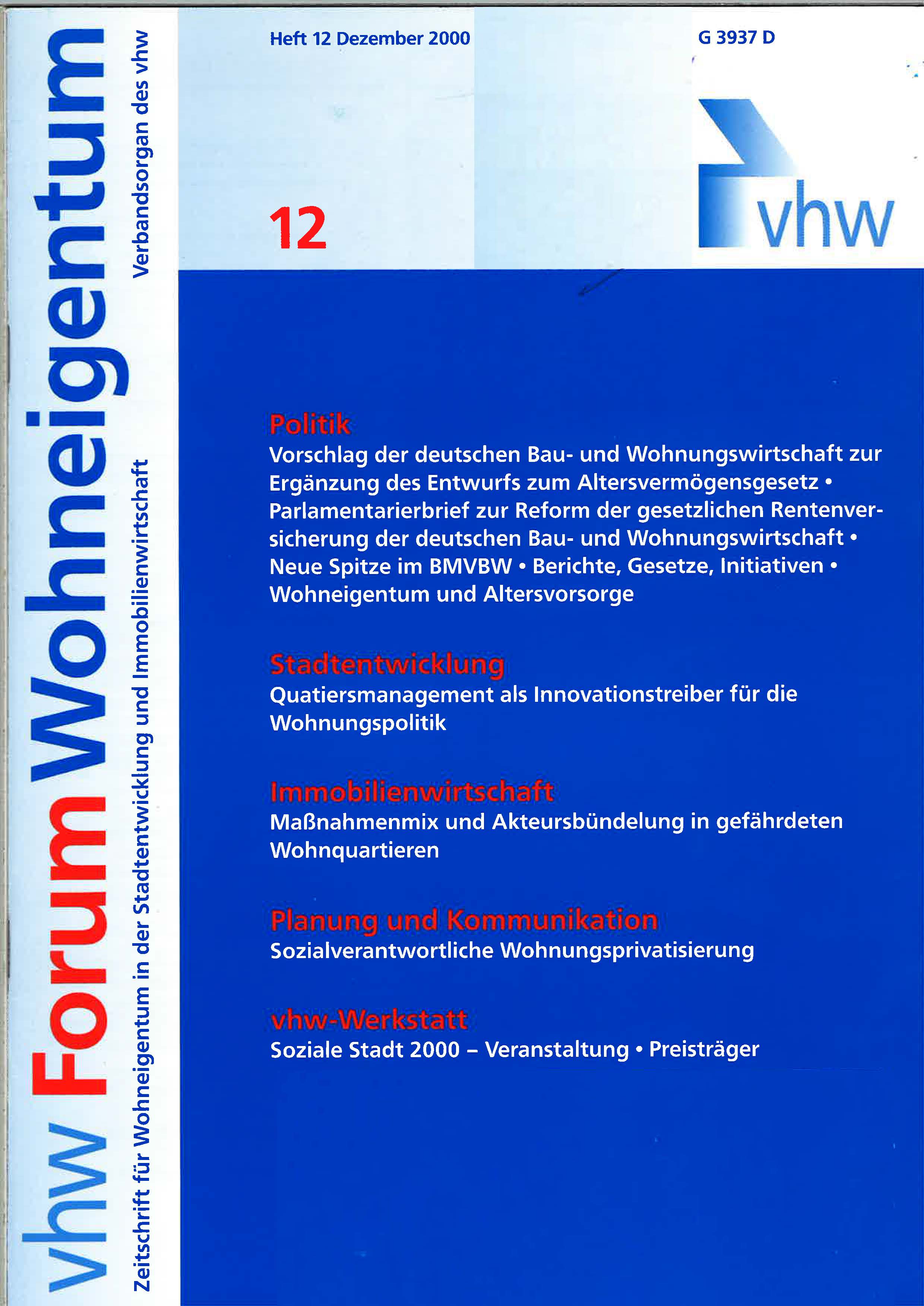
Erschienen in
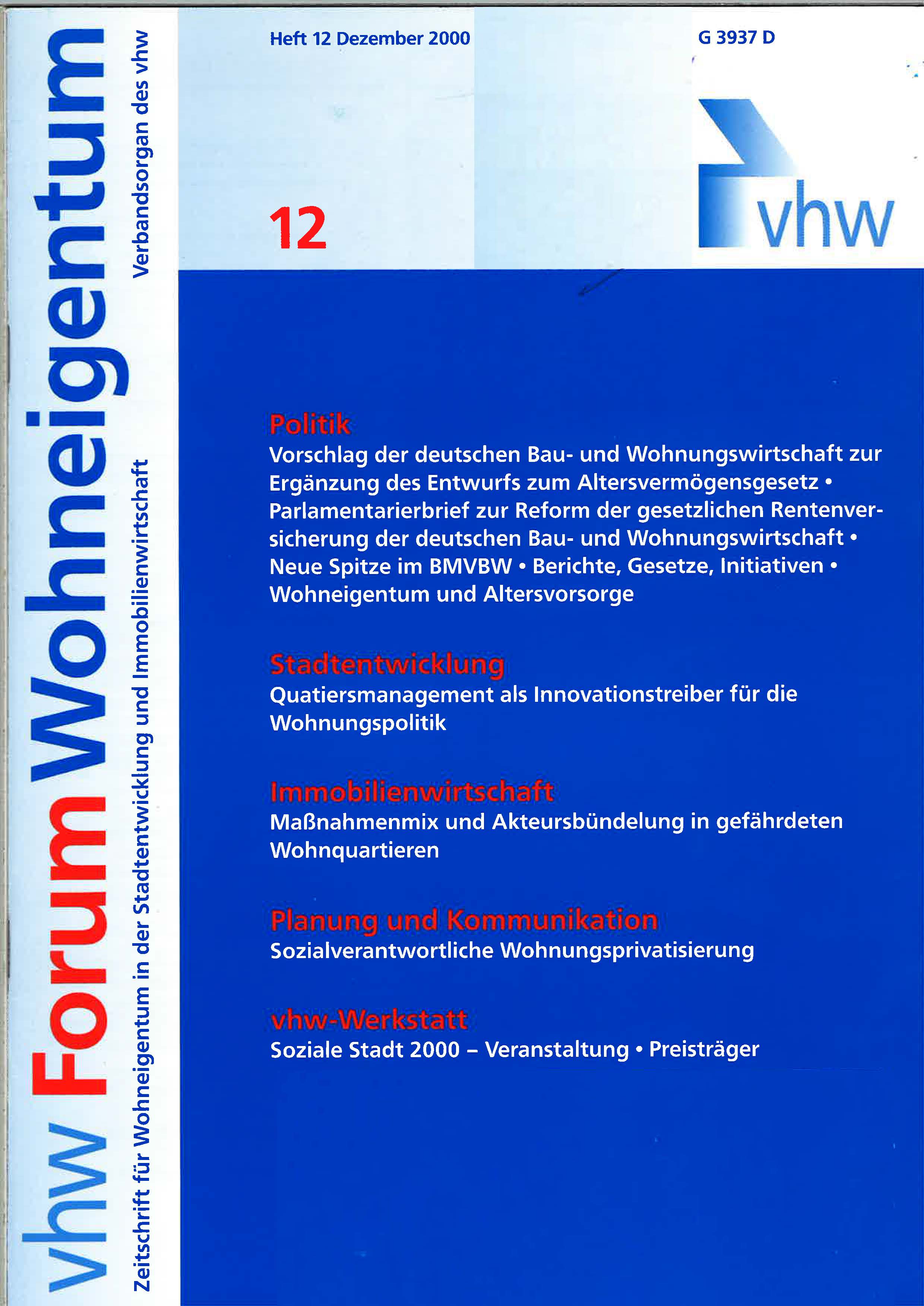
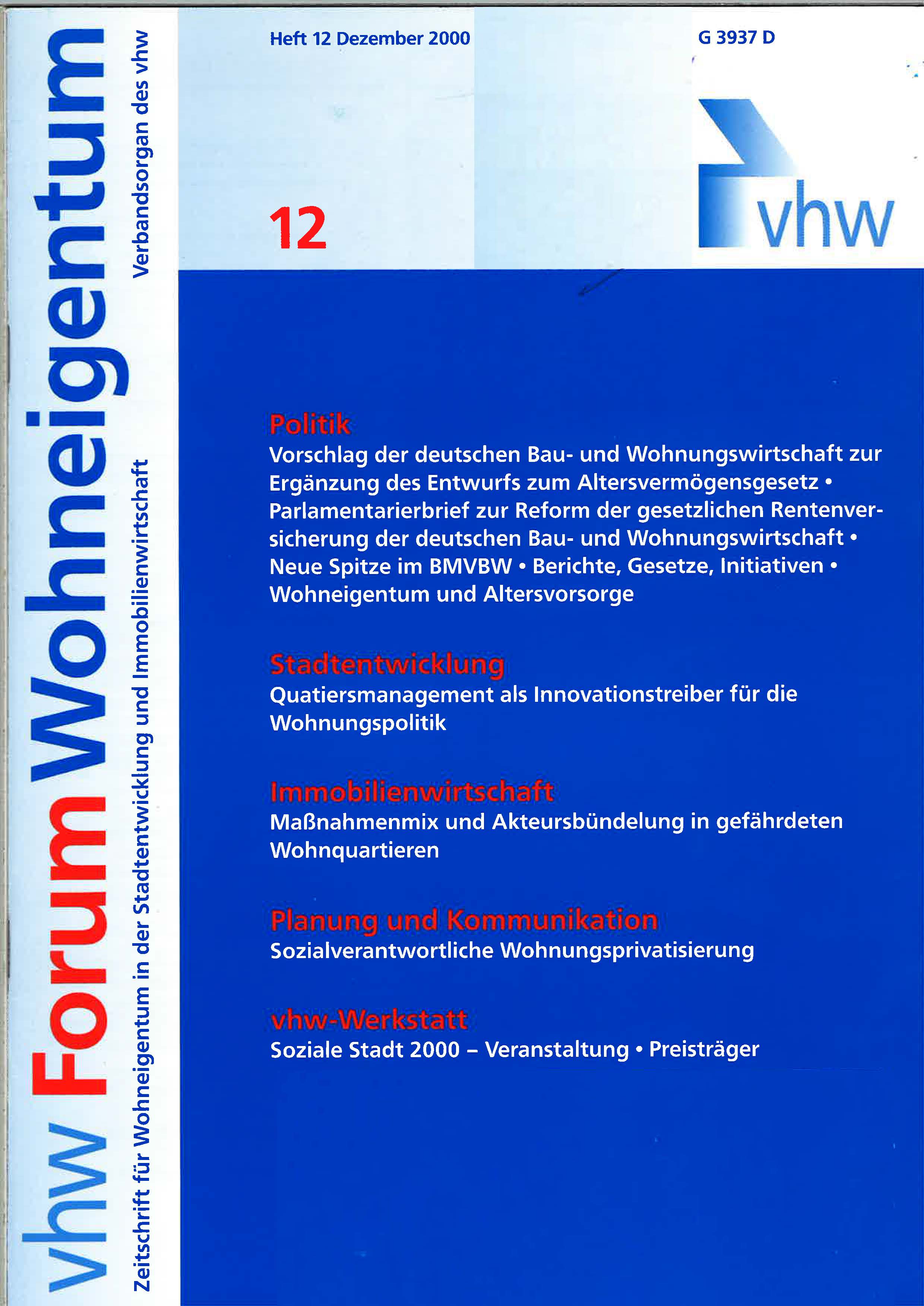
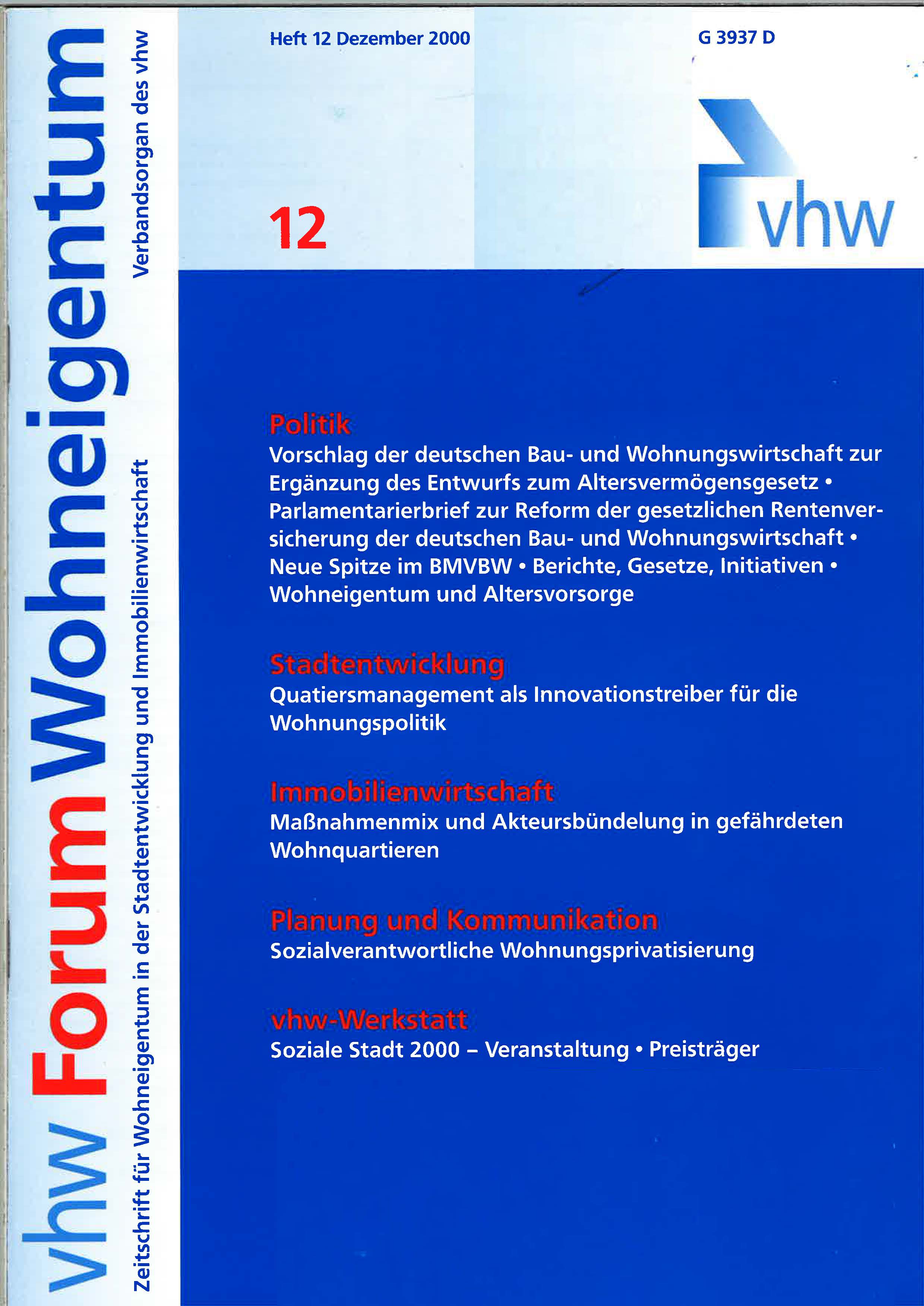
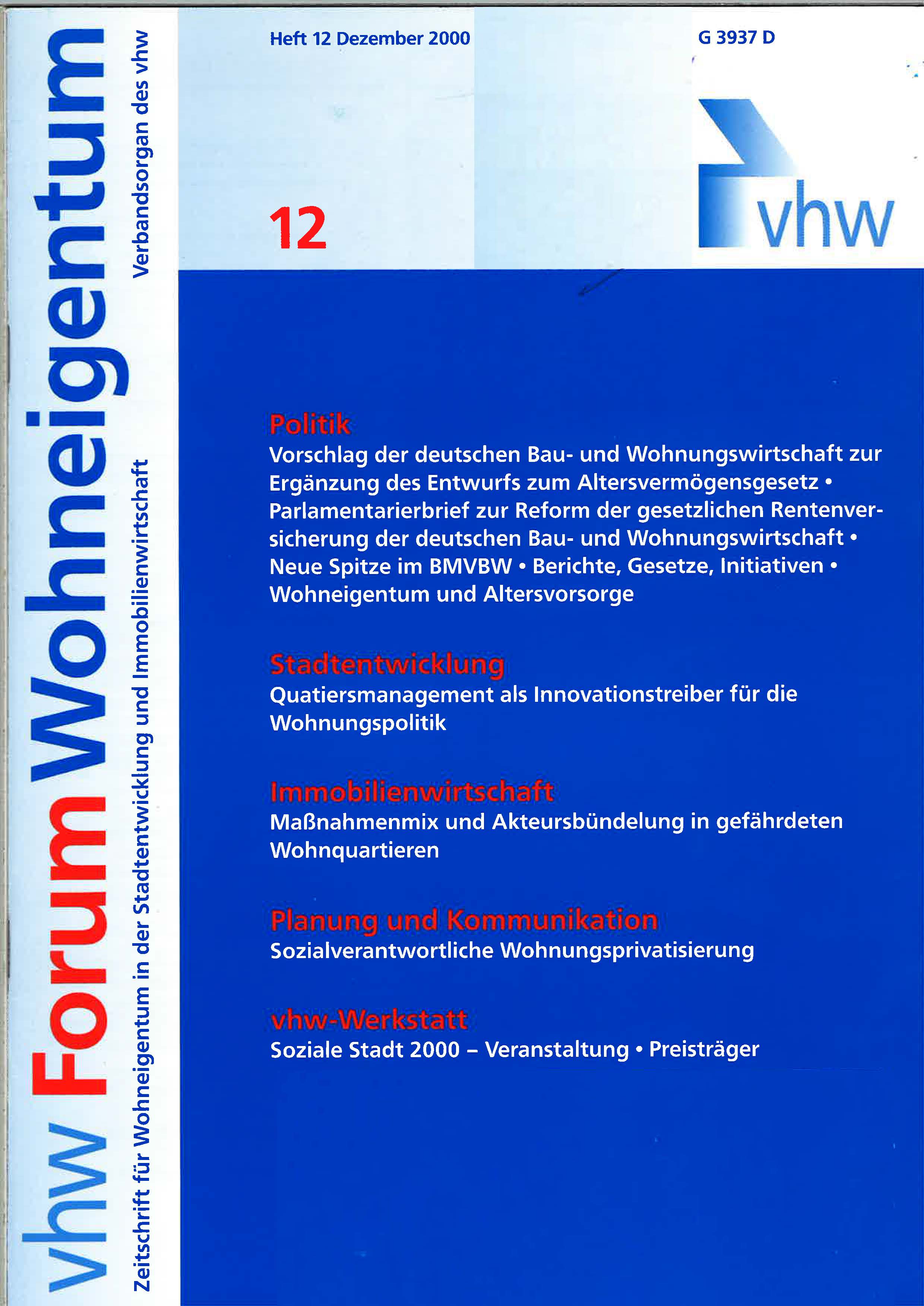
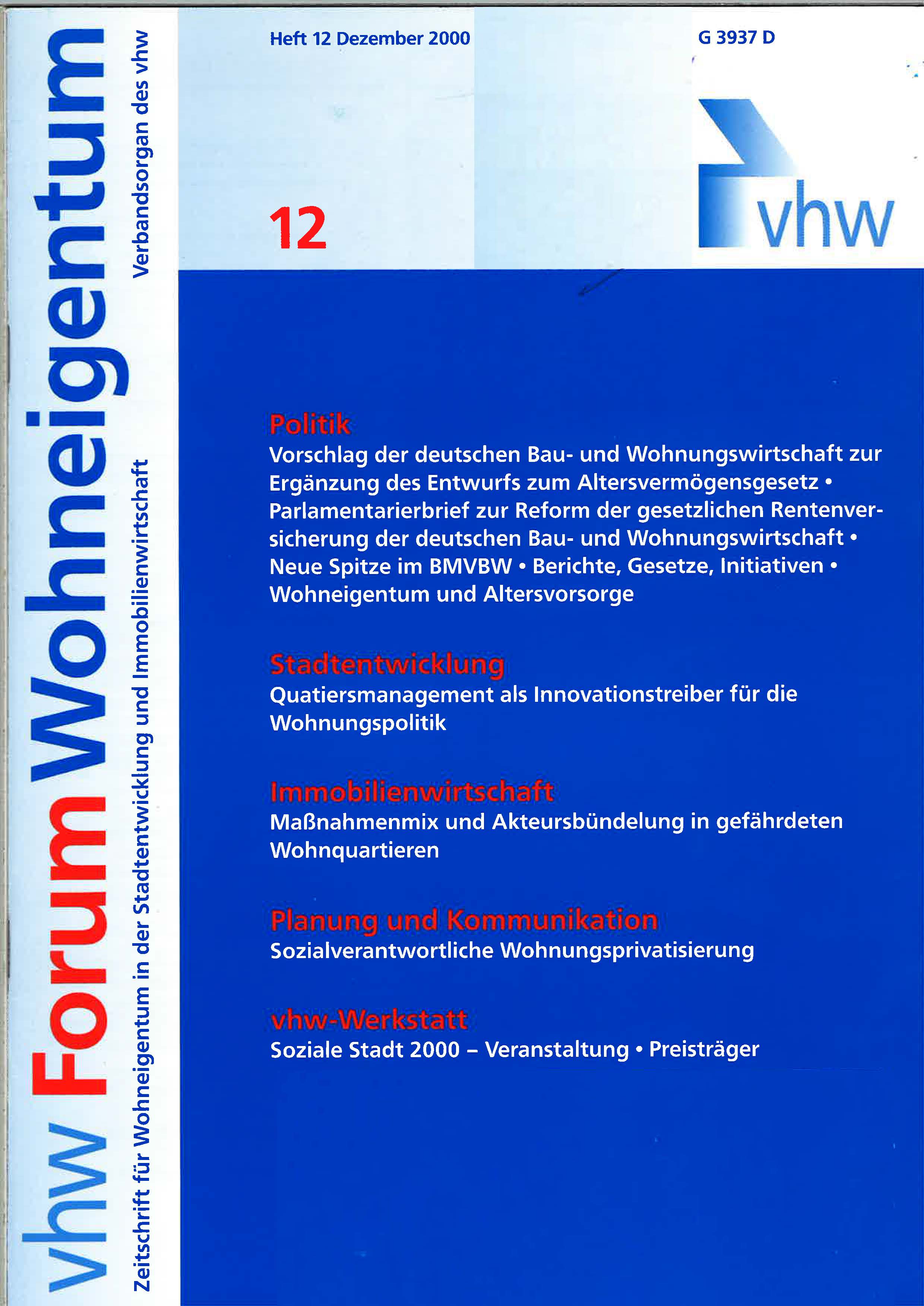
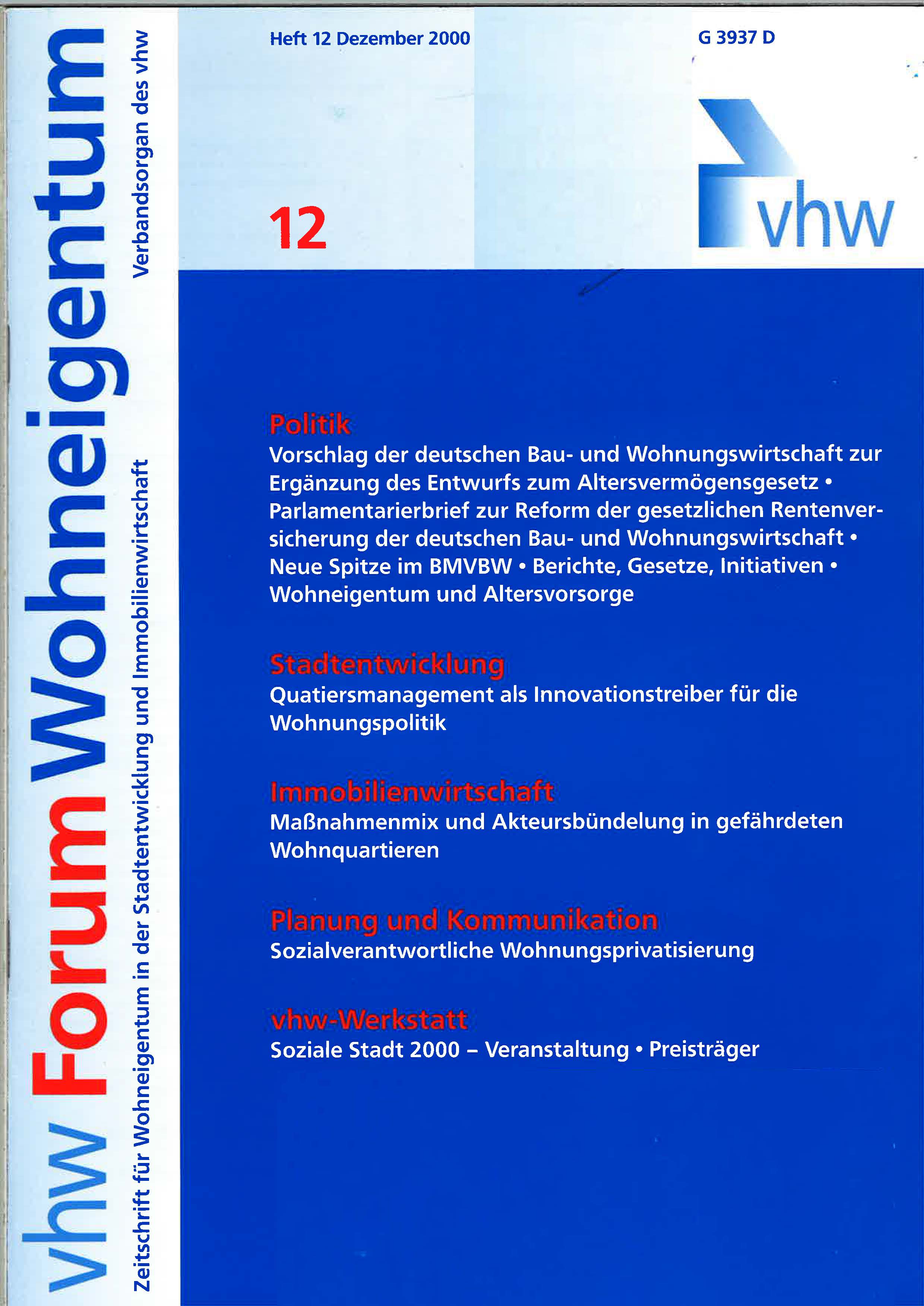
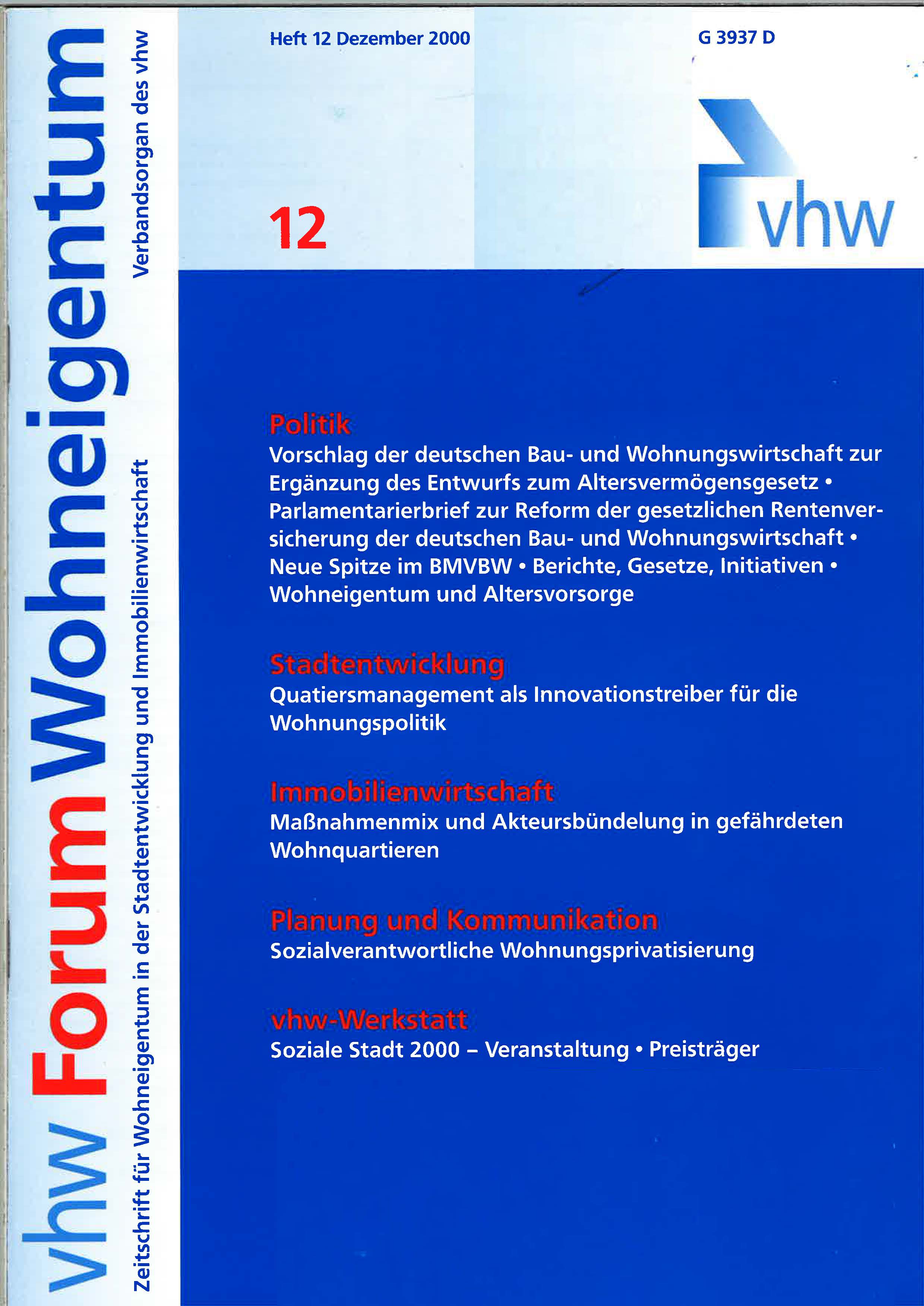





Erschienen in


Erschienen in
Stadtumbau, schrumpfende Stadt ... Themen von größter Brisanz. Themen in aller Munde? Nicht wirklich, würde man im neuen Deutsch sagen. Aktuell schon, brisant auch – aber reden darüber: eher nicht. In Öffentlichkeit und Politik ist das Thema noch nicht angekommen und die Fachwelt scheint sehr lange geschlafen zu haben und erwacht nun umso hektischer.
Beiträge
Erschienen in
Im Rahmen der Verbändeanhörung zur BauGB-Novellierung präsentierte das vhw in einem Werkstattgespräch am 3. Juli in Berlin den Abschlussbericht der Arbeitsgruppe "Stadtumbau – Besonderes Städtebaurecht und Städtebauförderung".
Beiträge
Erschienen in
Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in den Stadtregionen Düsseldorf, Mittelfranken und Kiel setzte das vhw am 3. Juni im Hamburger Museum für Kommunikation seine Reihe von Regionalforen fort. Im Mittelpunkt standen dabei die regionale Wohnungspolitik und die Verflechtungen der Wohnungsmärkte.
Beiträge
Erschienen in
Niemals in den letzten hundert Jahren wurde qualitativ so schlecht gebaut wie in der Zeit von 1950 bis Mitte der 60er. Die Wohnbebauung aus dieser Zeit weist eine minderwertige Bausubstanz und – aus heutiger Sicht – gravierende städtebauliche Mängel auf. Die Vermietung gestaltet sich zunehmend schwierig, Segregationsprozesse, hohe Fluktuationen und Unternutzung sind die Folge. Gefragt sind neue Strategien.
Beiträge
In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen für viele Wohnungsunternehmen verändert. Die regionale Nachfrage hat sich in qualitativer und quantitativer Hinsicht deutlich ausdifferenziert. Die meisten Märkte haben sich von einem Anbieter- in einen Nachfragermarkt gewandelt. Diese Nachfragesituation wird begleitet von merklich zurückhaltendem Engagement der Kapitalseite. Zudem sind mit oder ohne Gesellschafterwechsel auch die Gesellschafter der ohnungsunternehmen anspruchsvoller und vorsichtiger geworden. Die betriebswirtschaftlichen Herausforderungen an die Unternehmen sind gestiegen. Mittels Portfoliomanagement reagieren viele Wohnungsunternehmen auf die veränderte Situation.
Beiträge
Erschienen in
"Stadtumbau statt Stadterweiterung"" ihres Wachstums stehen. Wachsende Stadtregionen scheinen nunmehr die Ausnahme. Doch auch hier wäre eine Strategie, die den Bestand ignoriert und auf neue Bedarfe nur durch Zubau und Außenentwicklung reagiert, nur kurzfristig erfolgversprechend. Eine primär bestandsorientierte und nach innen gerichtete Strategie ermöglicht hingegen sowohl Wachstum als auch "qualifizierte" Schrumpfung. Am Beispiel der gemeinhin als prosperierend und "wachsend" betrachteten Stadt München werden Voraussetzungen, Instrumente, Hemmnisse und Wirkungen einer "Stadtentwicklung nach innen" dargestellt.
Beiträge
Erschienen in
Weit über eine Millionen Wohnungen in den Neuen Bundesländern stehen leer. Überdurchschnittlich stark betroffen vom "Leerstand Ost" sind die DDR-Plattenbauten. Das thüringische Leinefelde hat somit ein Problem: Hier beträgt der Anteil von Plattenbauten am gesamten ohnungsbaubestand 90 Prozent - flächenhafter Abriss kommt da nicht in Frage. Die Stadt geht einen anderen Weg und zeigt beispielhaft wie die unattraktiven Plattenbauten architektonisch und sozial beispielhaft revitalisiert werden können.
Beiträge
Erschienen in
Bremerhaven, mit derzeit rund 120.000 Einwohnern größte Stadt an der deutschen Nordseeküste, befindet sich inmitten eines tiefgreifenden wirtschaftlichen und sozialen Strukturwandels. Er äußert sich massiv in Form einer anhaltend hohen Arbeitslosigkeit, eines Spitzenplatzes im Sozialhilfebezug und einem kontinuierlichen Bevölkerungsrückgang. Im Gefolge der Einwohnerverluste insbesondere an das niedersächsische Umland entleeren sich vor allem Großsiedlungsbereiche und innerstädtische Altbauquartiere. Nach einer Prognose des Forschungsinstituts GEWOS sind bis 2015 insgesamt 10.000 leerstehende Wohnungen zu erwarten, wenn die eingeleiteten (und noch einzuleitenden) Gegenstrategien nicht greifen.
Beiträge
Erschienen in
Wohnungsmärkte und sozialräumliche Strukturen der Städte reagieren auf Veränderungen in der demographischen Entwicklung. Der Rückzug des Staates aus der Wohnungsversorgung gibt dem Markt mehr Einfluss auf die Verteilung von Wohnungen. In den deutschen Städten wird sich die Nachfrage durch die gleichzeitige Abnahme der Gesamtbevölkerung einerseits und den wachsenden Anteil von ethnischen Minderheiten andererseits sowie durch die stärkere Ausdifferenzierung von Lebensstil-Milieus verändern. Bei bestehenden Wohnungsüberhängen gewinnt der Umgang mit dem Wohnungsbestand logischerweise eine größere Bedeutung. Im Folgenden sollen die Auswirkungen der demographischen Perspektiven auf mögliche Entwicklungen der sozialräumlichen Struktur abgeschätzt werden.
Beiträge
Erschienen in
Demographische Mühlen mahlen langsam. Der demographische Wandel, von dem allenthalben die Rede ist, der hier und da mehr oder weniger sichtbar ist, er hat Ursachen, die teils weit in der Vergangenheit liegen. Die Abnahme der Bevölkerungszahl, die Alterung der Bevölkerung, die Internationalisierung durch hohe internationale Zuwanderung sind Prozesse, die zwar neu ins Bewusstsein der Öffentlichkeit getreten sind, die jedoch – vielfach als schleichender Prozess – bereits vor Jahrzehnten begannen.
Beiträge
Erschienen in
Die Entwicklung der regionalen Wohnungsmärkte ist nicht zuletzt abhängig von der wirtschaftlichen Situation vor Ort. Dabei gibt es innerhalb der Bundesrepublik große regionalökonomische Unterschiede. Regionen mit einer wachsenden Zahl an Erwerbstätigen und wachsender Wirtschaftskraft stehen stagnierende und schrumpfende Regionen gegenüber. Im Folgenden werden die Unterschiede in der regionalökonomischen Entwicklung beschrieben.
Beiträge
Erschienen in
Die Initiative Wohneigentum, ein Zusammenschluss von Verbänden aus der Bau-, Immobilien- und Wohnungswirtschaft, der Baufinanzierung und des Maklerwesens, hält die weitgehend sachfremde Diskussion über die Eigenheimzulage für unangemessen und ärgerlich. Insbesondere die von manchen verwendeten Schlagworte ("Gießkannenförderung", "ökologisch schädliche Zulage") dienen offensichtlich nur einem Ziel: das bisher – auch im Vergleich zu anderen Instrumenten der Wohnungspolitik – erfolgreiche Instrument der Wohneigentumsförderung in Frage zu stellen, damit das Fördervolumen der Eigenheimzulage als "Steinbruch" für die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte bzw. zur Finanzierung der vorgezogenen Steuerreform dienen kann. Hier wird auf die gravierendsten Vorwürfe kurz eingegangen.
Beiträge
Erschienen in
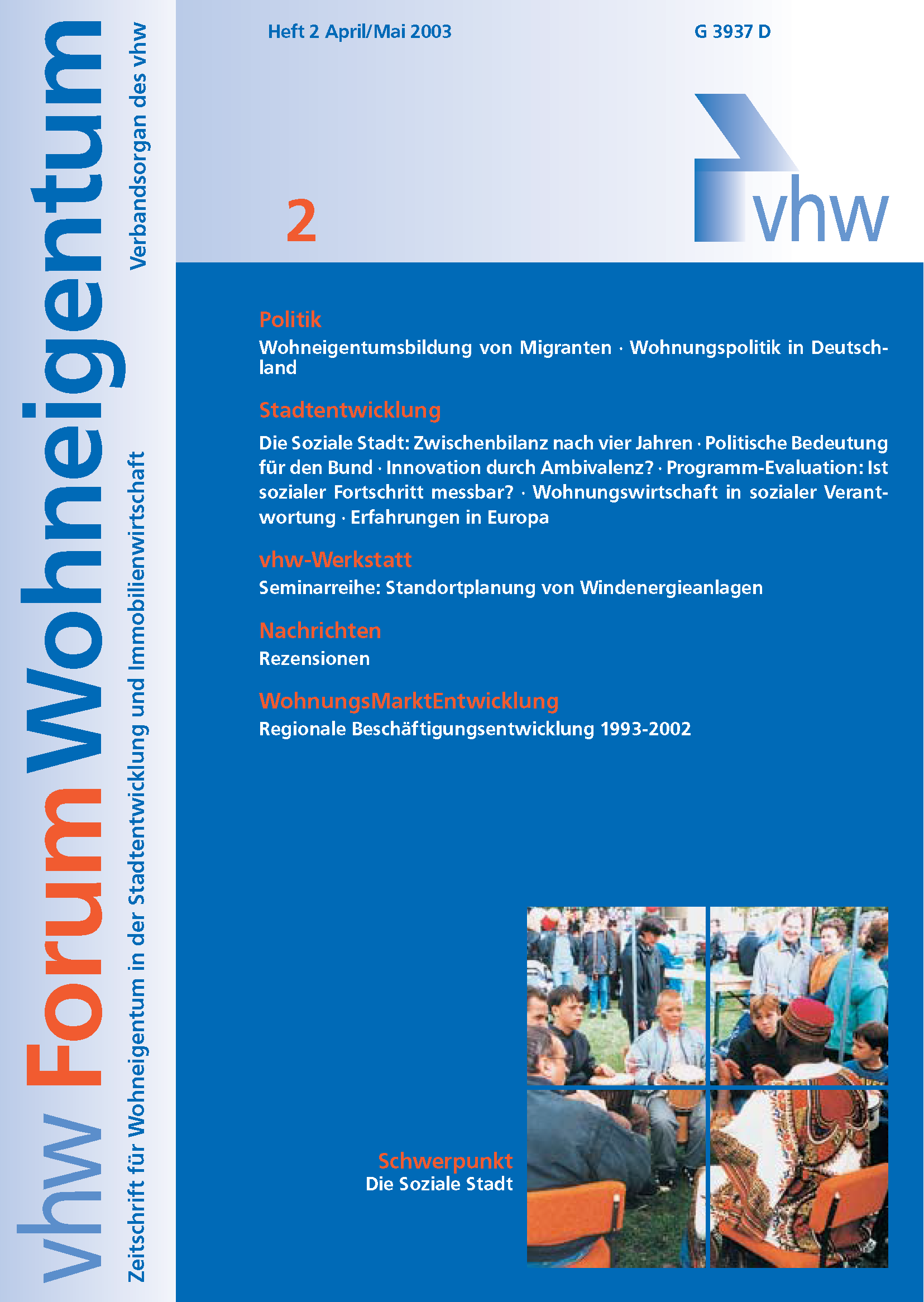
Erschienen in
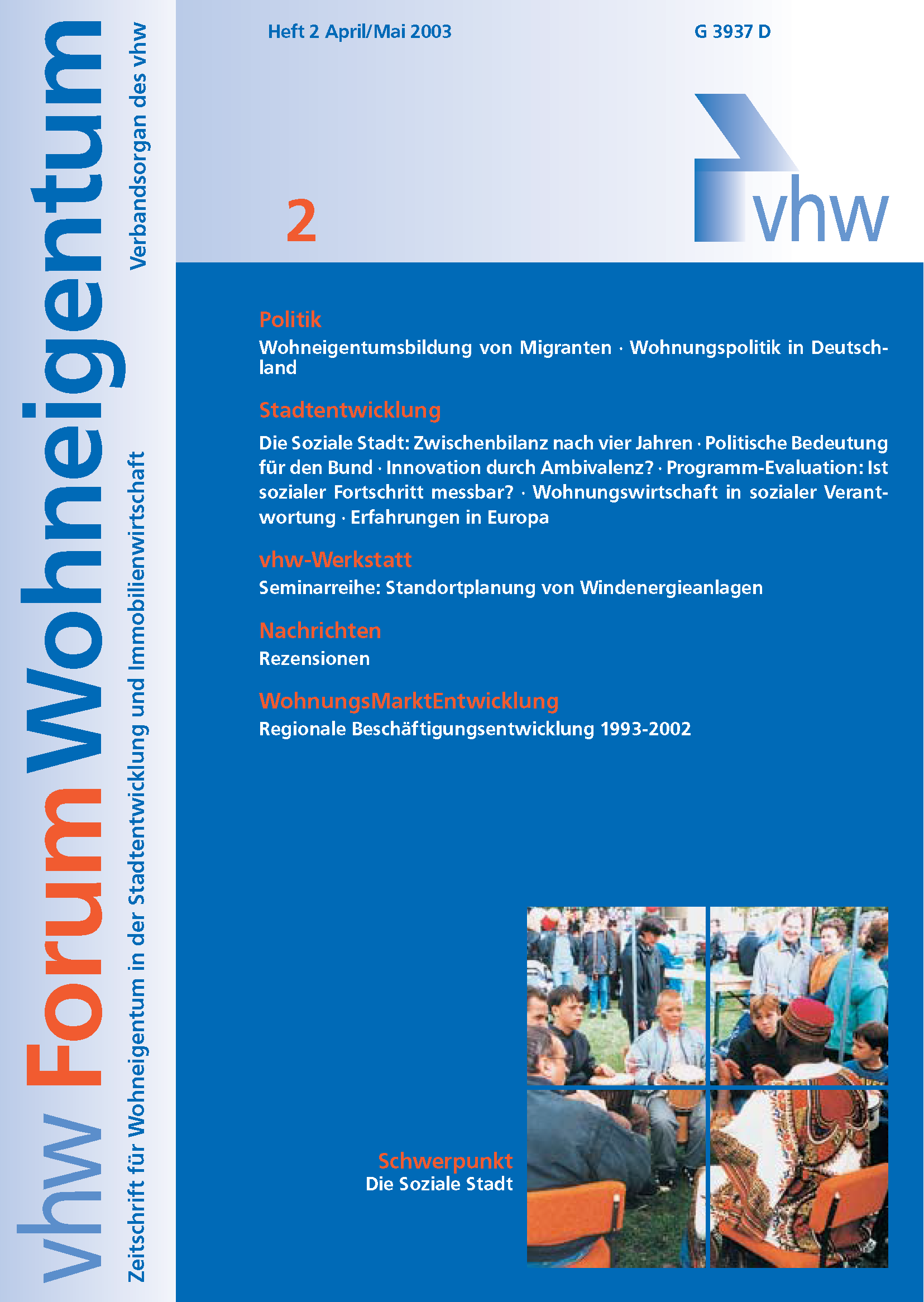
Erschienen in
Im Januar dieses Jahres wurde der Wettbewerb "Preis Soziale Stadt 2002" mit einer öffentlichen Preisverleihung und Fachveranstaltung in Berlin abgeschlossen. Getragen von sechs unterschiedlichen Auslobern und unterstützt von zwei Bundesministerien, stieß der bereits zum zweiten Mal ausgerufene Wettbewerb auf eine überwältigende Resonanz. Mehr als 200 Initiativen haben sich mit ihren Projekten beworben und mehr als 200 Gäste fanden sich auch auf der Abschlussveranstaltung ein. Die hochrangig besetzte Fachjury hat 10 Projekte mit einem Preis ausgezeichnet und sieben weiteren Bewerbern eine Anerkennung zugesprochen. Sie finden hier kurze Porträts der "Sieger" und Gespräche mit den Akteuren.
Beiträge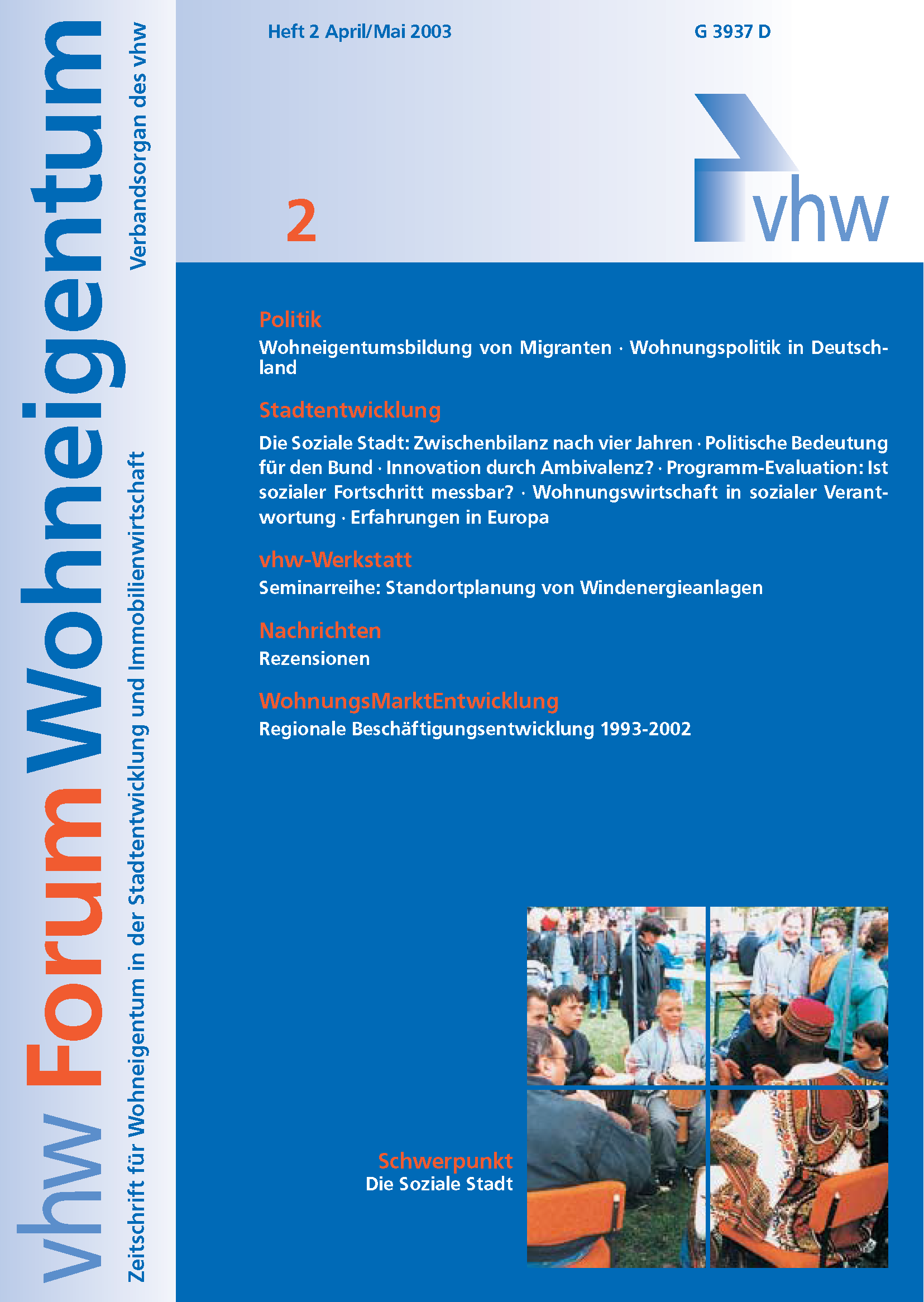
Erschienen in
Die Zunahme von Armutsgebieten in Großstädten ist ein Phänomen in ganz Europa. Als Reaktion auf diese Entwicklung entstanden in vielen Ländern Programme, die mit dem deutschen Bund-Länder-Programm "Die Soziale Stadt" vergleichbar sind. Im Rahmen des EU-Forschungsprojektes "Urban Governance, Social Inclusion and Sustainability" wurden diese Programme jetzt untersucht. Erstes Fazit: Nicht nur die Merkmale benachteiligter Wohngebiete sind sich ähnlich, auch die Ansätze zur Förderung derselben lassen Parallelen erkennen. Ein stärkerer Austausch über Probleme und Erfolge bei der Programmentwicklung und -umsetzung sowie ihrer Evaluation scheint somit wünschenswert.
Beiträge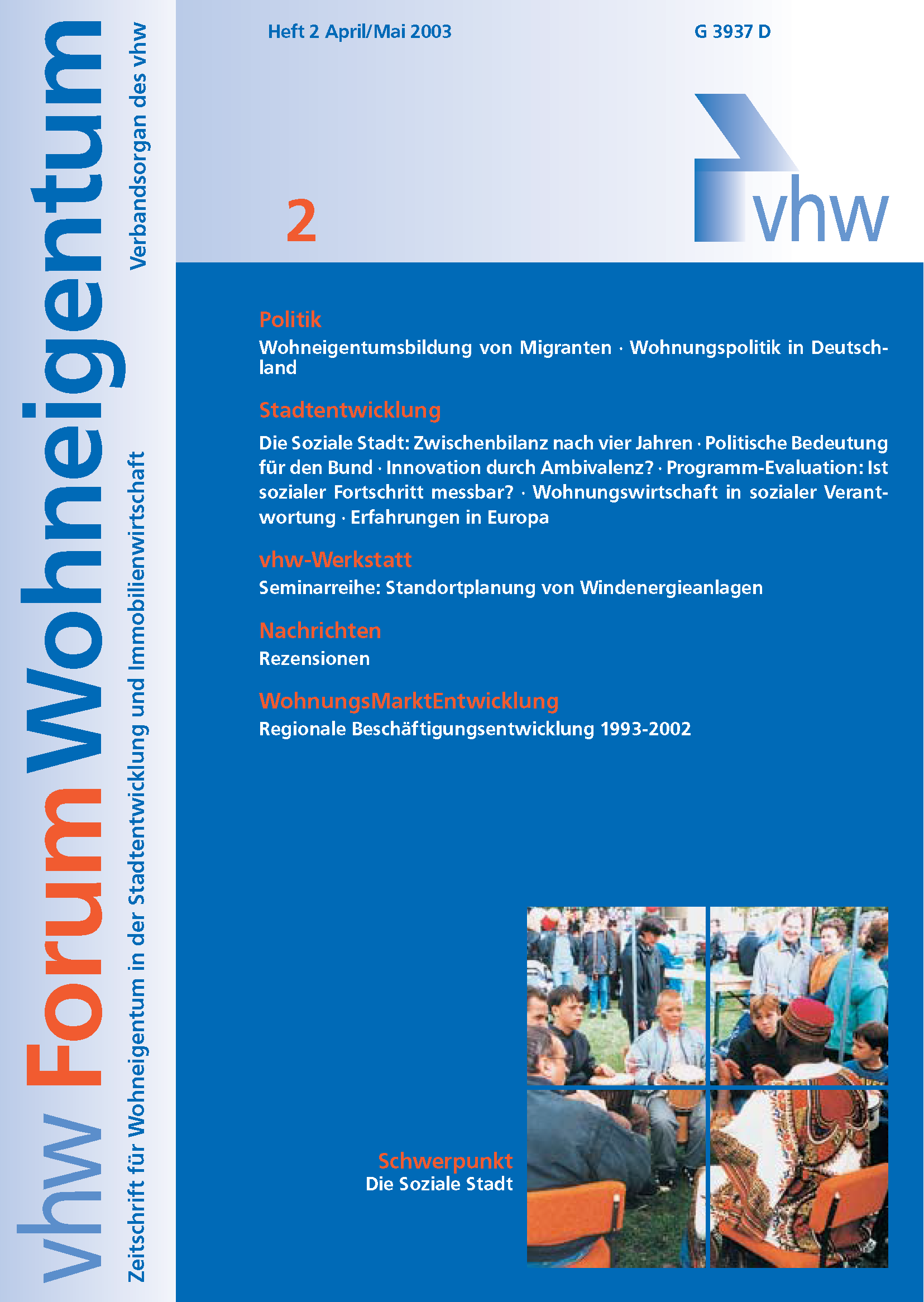
Erschienen in
Wohnungsunternehmen müssen sich ihrer sozialen Verantwortung stellen – auch aus wirtschaftlichem Eigeninteresse. Die sozial nachhaltige Bewirtschaftung von Wohneinheiten verbessert die Marktchancen eines Wohnungsunternehmens. Die Glückauf Wohnungsbaugesellschaft in Lünen behauptet sich seit über zehn Jahren mit ihrem übergreifenden, bewohnerorientierten Wohnraum-Konzept in einem schwierigen Marktumfeld – und wurde Preisträger im Wettbewerb "Soziale Stadt 2000".
Beiträge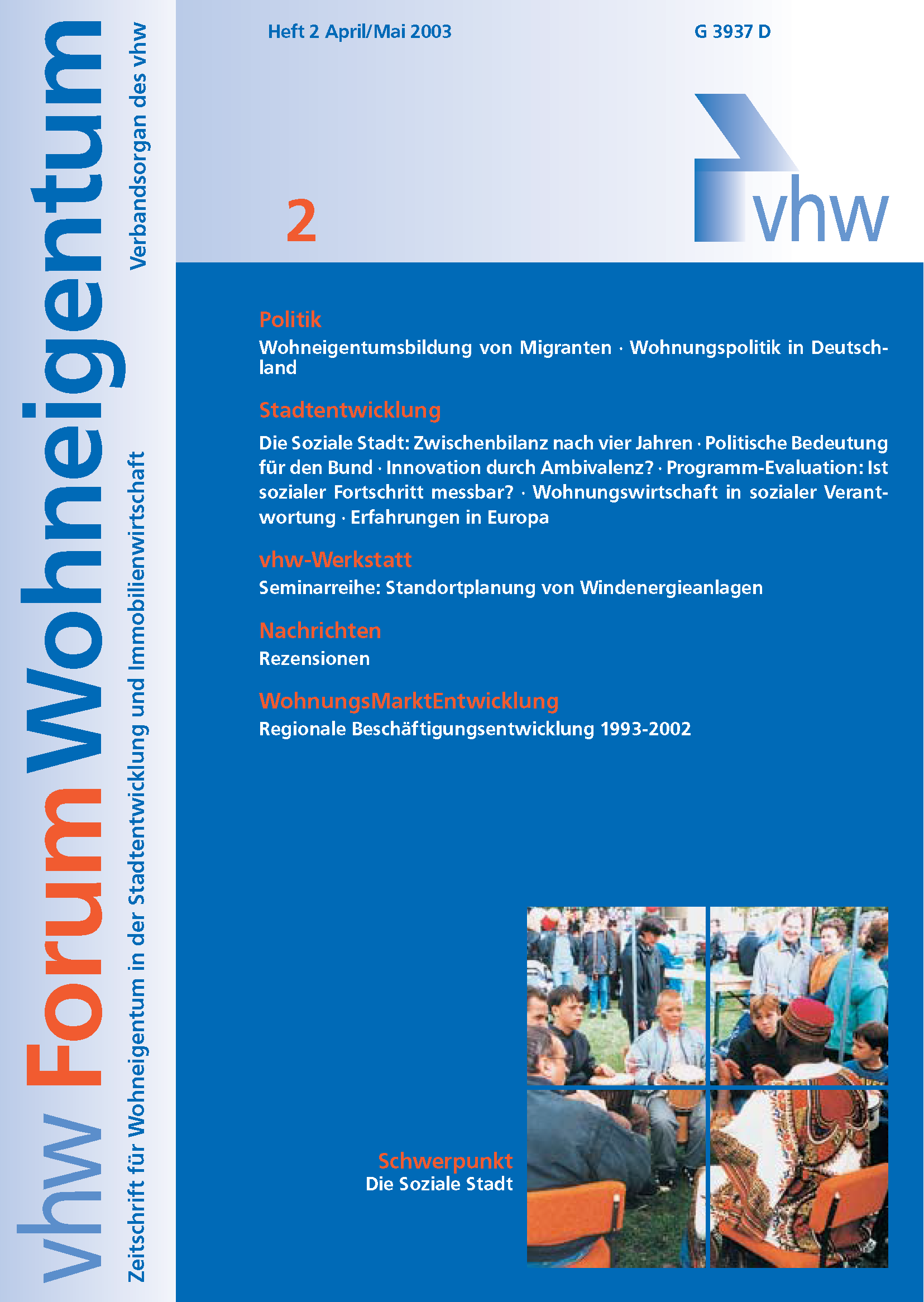
Erschienen in
Das Bund-Länder-Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt" befindet sich nunmehr im fünften Jahr seiner Umsetzung. In vielen Gebieten sind die konkreten Projektaktivitäten allerdings zum großen Teil noch jüngeren Datums. Gemessen an den Zielen eines so komplexen und ambitionierten Programms ein noch zu kurzer Zeitraum, um erwarten zu können, dass sich in den betroffenen Gebieten schon so etwas wie "sozialer Fortschritt" ausmachen lässt. Ist doch unter Experten wie inzwischen auch in der politischen Debatte längst akzeptiert, dass ein solches Programm zur Lösung der komplexen und schwierigen Probleme in den benachteiligten Stadtteilen seine Zeit braucht, sicht- und messbare Wirkungen zu entfalten. Um eine erste Bewertung der bisherigen Ergebnisse und Wirkungen vornehmen zu können, ist eine Zwischenevaluation des Programms durch das Bundesbauministerium (BMVBW) in Auftrag gegeben worden. Ergebnisse sollen Anfang nächsten Jahres vorliegen.
Beiträge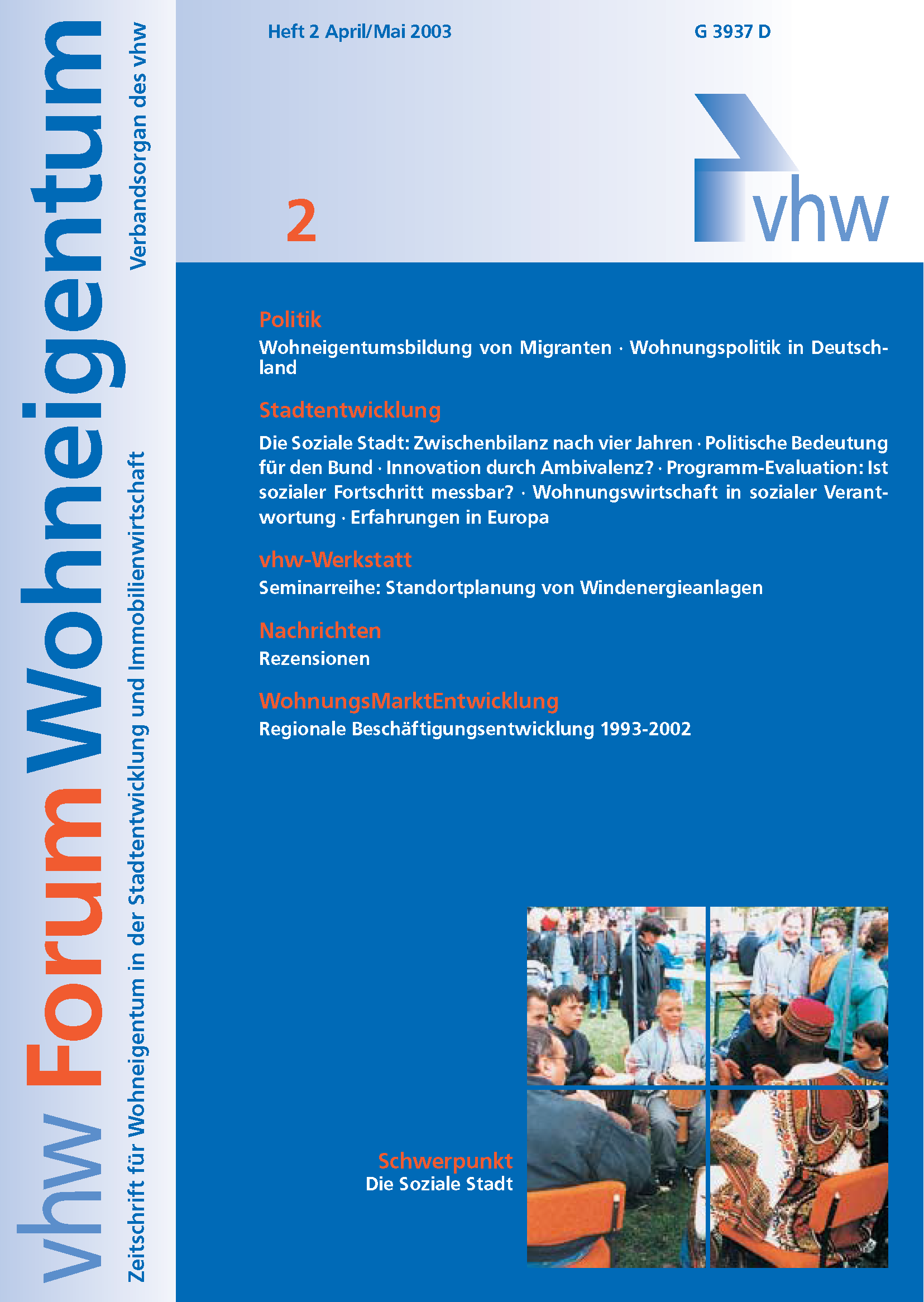
Erschienen in
Seit vier Jahren läuft das Programm "Die Soziale Stadt". Im Auftrag der Bundesregierung begleitete das Difu das Programm wissenschaftlich. Jetzt erscheint der Abschlussbericht. Fazit: Das Programm ist ein Erfolg. Um in Zukunft Konflikte zwischen den beteiligten Ressorts in Politik und Verwaltung zu vermeiden, sollten wesentliche Teile des Programms im Baugesetzbuch zu verankert werden.
Beiträge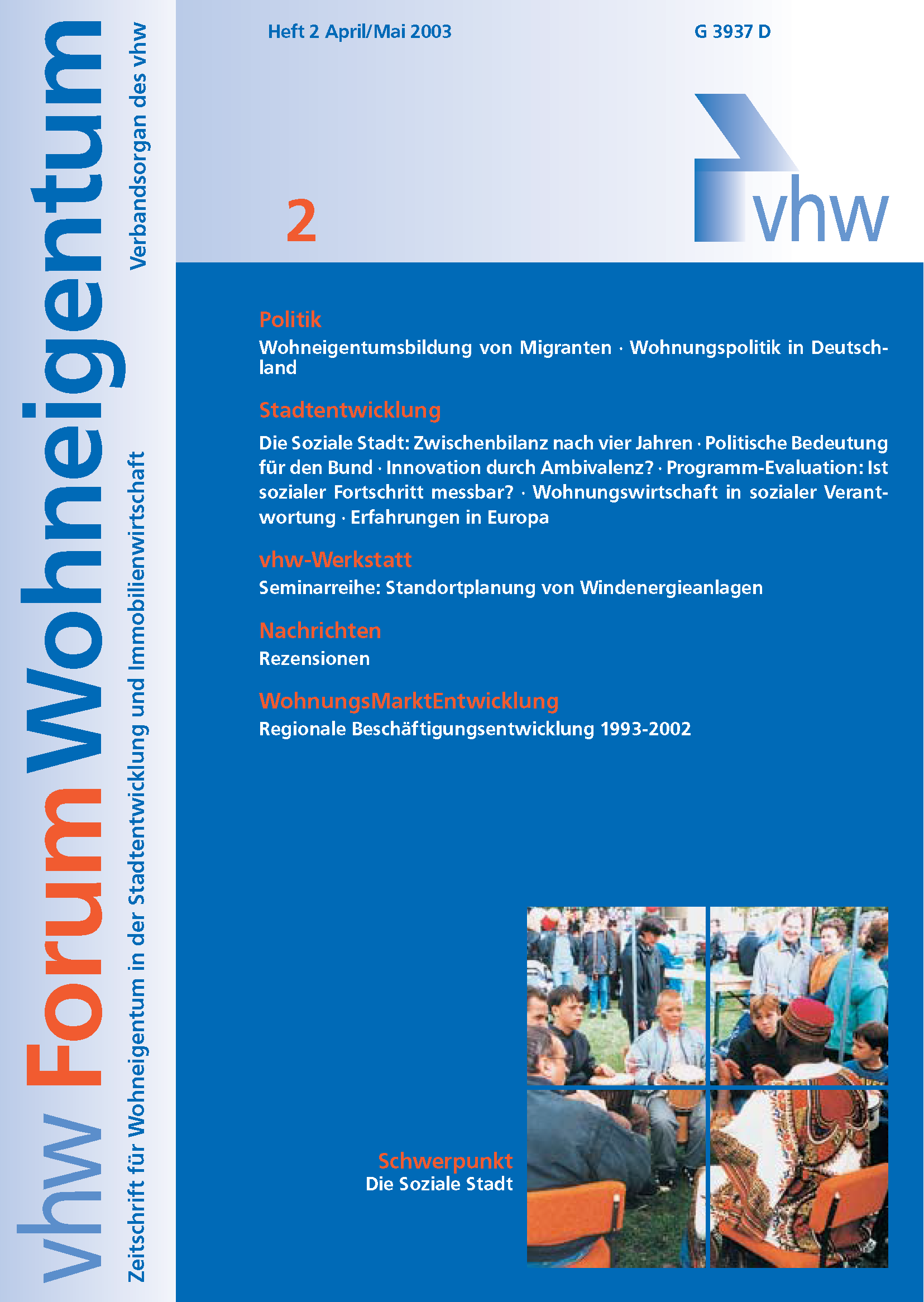
Erschienen in
Das Programm "Die Soziale Stadt" trat 1999 mit einem hohen Innovationsanspruch an. Es soll die Abwärtsentwicklung benachteiligter Quartiere stoppen, dazu aber auch Stadtpolitik und Planung für benachteiligte Quartiere erneuern. Sind im Rahmen beschränkter Mittel und Instrumente diese Ambitionen einlösbar? Der Programmabschnitt "Die Soziale Stadt" als bislang vorletzte Säule der Städtebauförderung übernimmt zwangsläufig auch deren investive Ausrichtung. Bislang hat sich dieser Rahmen der Stadterneuerung als anpassungsfähig erwiesen. Für die Akteure der "Sozialen Stadt" führt er allerdings zu zwiespältigen Handlungsorientierungen. Doch solche Ambivalenzen sind nicht allein störende Restbestände; sie können auch als produktive Irritation und damit ebenso als Geburts- und Innovationshelfer gesehen werden: Innovation nicht trotz, sondern wegen der ambivalenten Konstruktion eines Programms.
Beiträge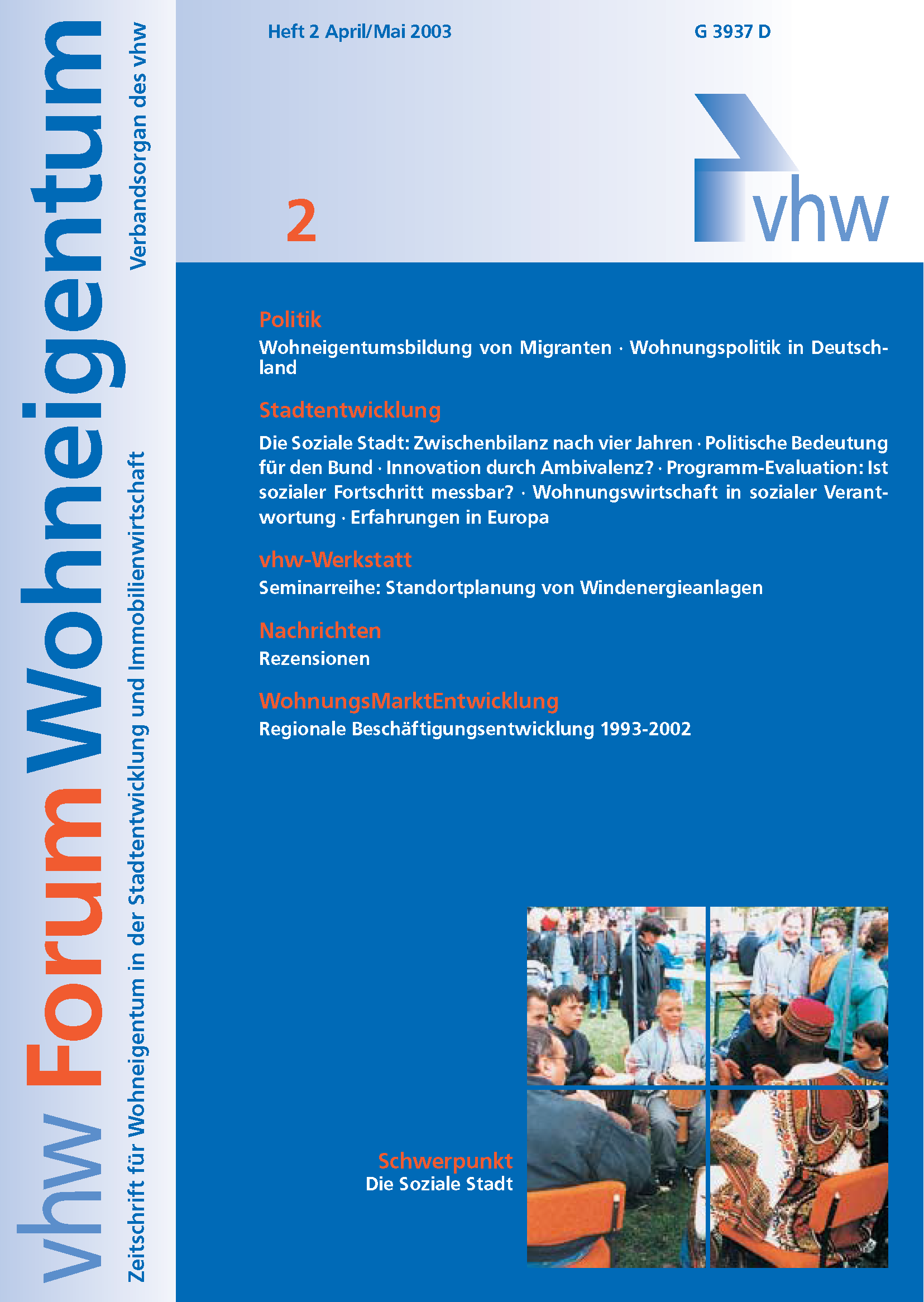
Erschienen in
Wohnungsknappheit, getrennte Verkehrsverbindungen, marode Stadtteile, große Migrationsbewegungen - keine deutsche Stadt stand in den vergangenen Jahren vor vergleichbaren Problemen wie Berlin. Seither wurden große Anstrengungen unternommen. Wohnungen wurden gebaut, Altbauten saniert, ganze Quartiere revitalisiert. Die desolate Situation ist vielfach überwunden, seit einigen Jahren steigt die Einwohnerzahl in der inneren Stadt wieder – ein Erfolg des Stadterneuerungsprogramms. Nun rücken neue Strategien in den Vordergrund.
Beiträge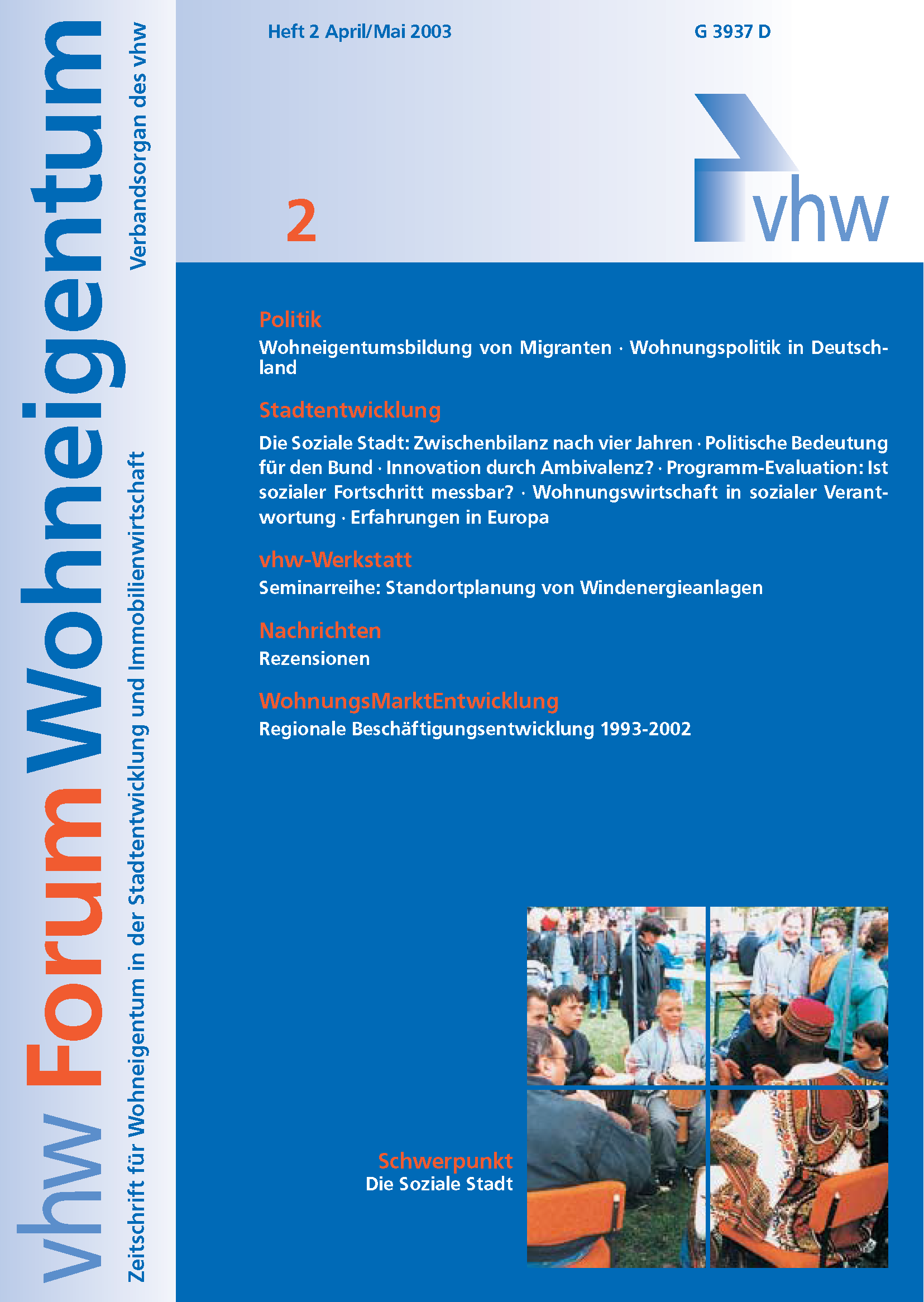
Erschienen in
Die sozialräumlichen Gegebenheiten der Wohnumgebung beeinflussen die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Mit dem Programm "Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten" (E & C) setzt die Bundesregierung kinder- und jugendhilfespezifische Prioritäten als wichtige Ergänzung des Programms "Die Soziale Stadt". Somit trägt E & C dazu bei, den integrativen Anspruch des Programms "Die Soziale Stadt" einzulösen.
Beiträge