
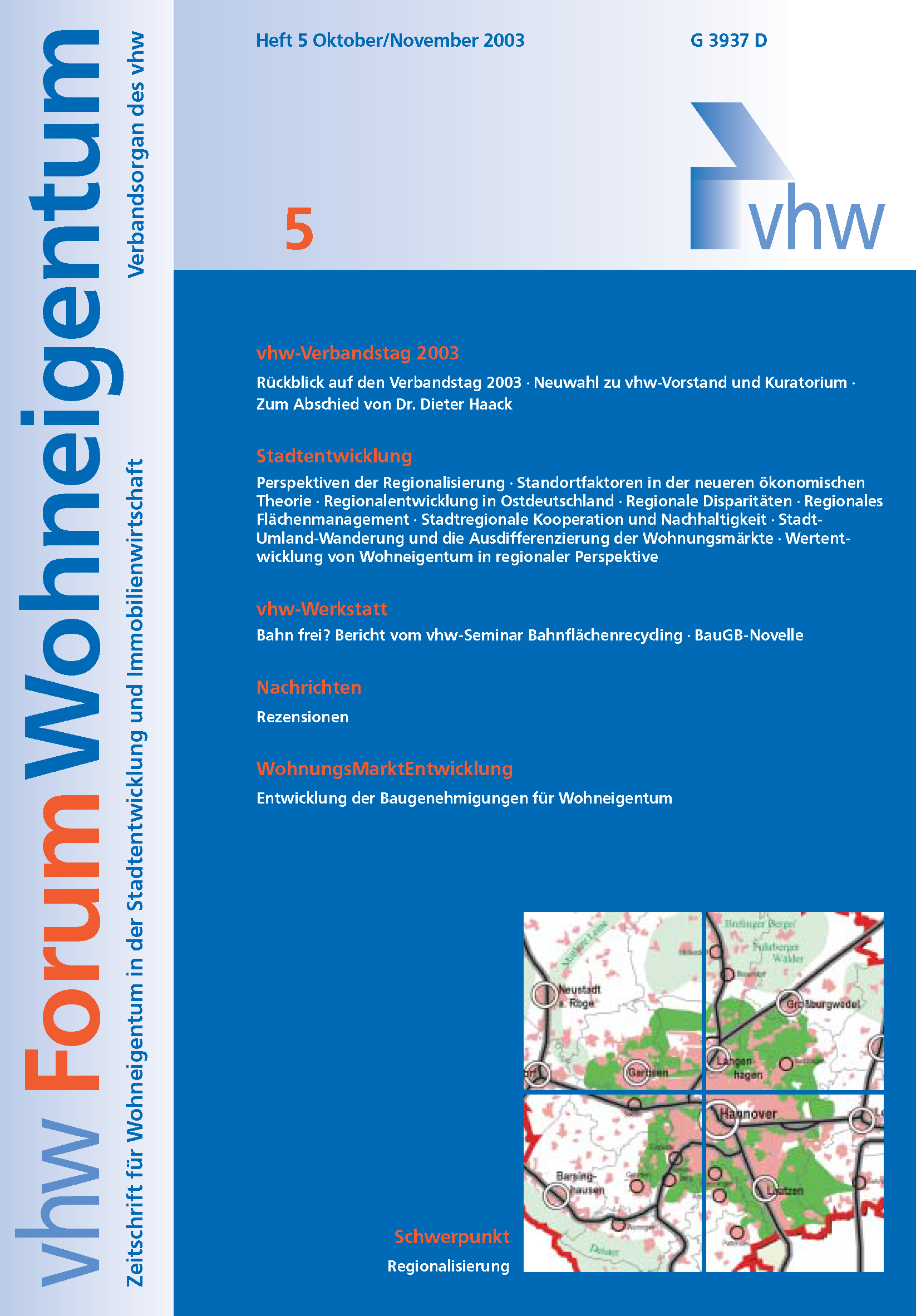
Erschienen in
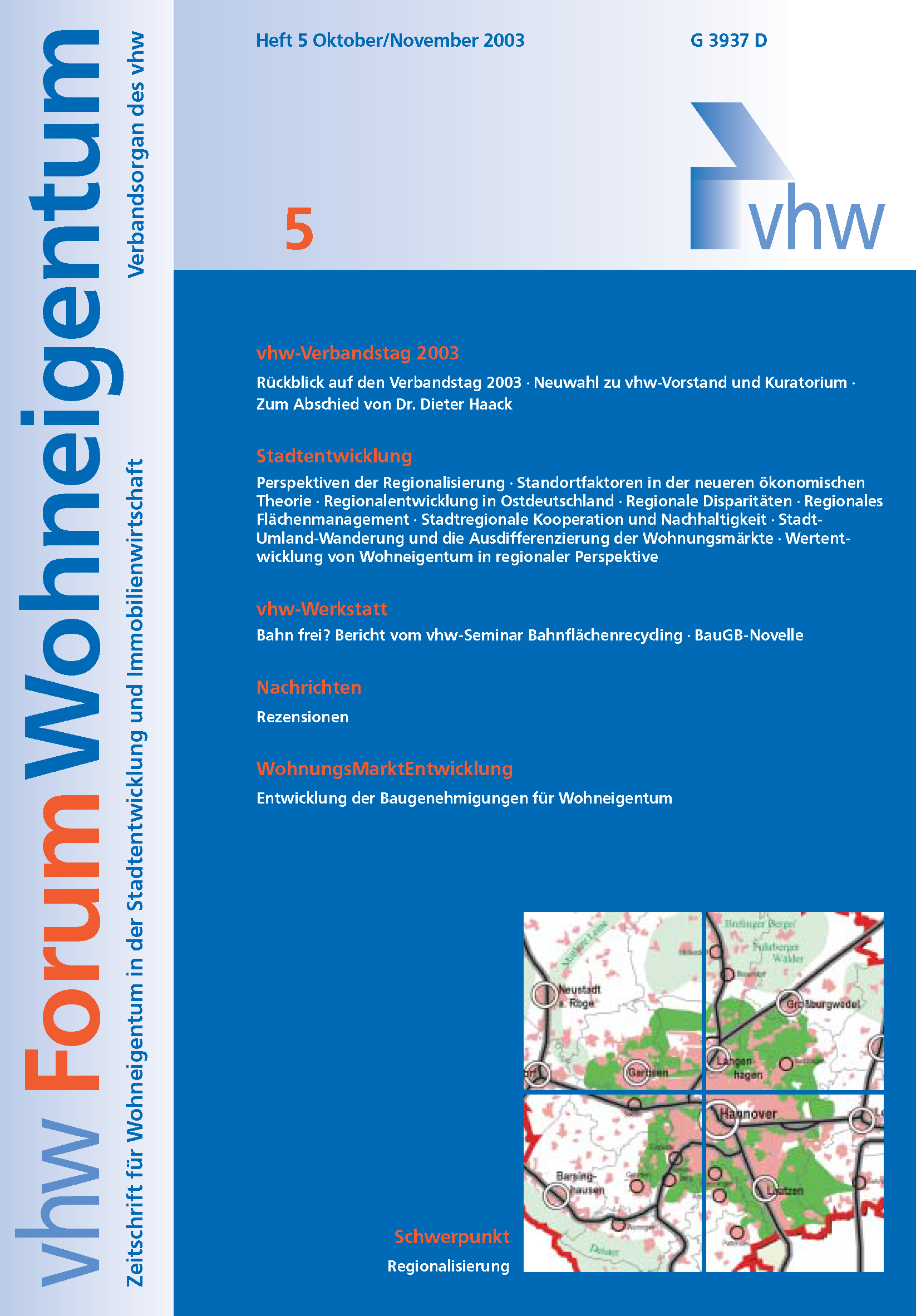
Am 24. September 2003 ging für das vhw eine Ära zu Ende: Im Rahmen des diesjährigen Verbandstages trat Dr. Dieter Haack nach neun Jahren an der Spitze des Verbandes von seinem Amt zurück. Neun Jahre, in denen er herausragende Arbeit für das vhw geleistet hat. Als Bundesbauminister a. D. und Präsident der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern prägten enorme politische Erfahrung, fachliche Kompetenz und ethisches Verantwortungsgefühl sein Wirken im vhw. Nicht zuletzt deshalb hat sich das vhw unter seiner Ägide in der Politikberatung und der wissenschaftlichen Arbeit stark für die familien- und sozialgerechte Weiterentwicklung der Wohneigentumsförderung, die Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West sowie für eine neue Beziehung zwischen Anbietern und Nachfragern auf dem Wohnungsmarkt eingesetzt.
Beiträge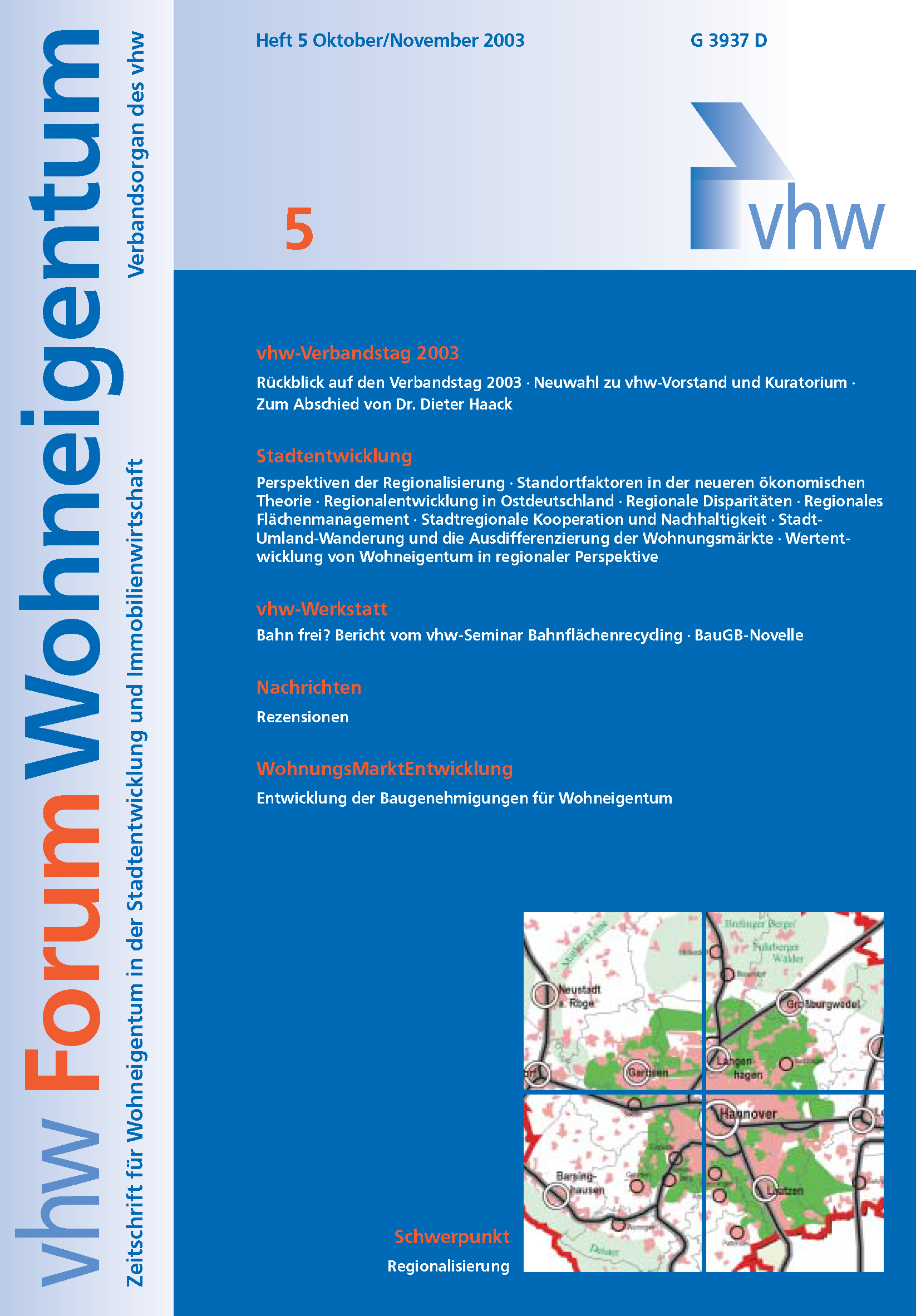
Neu zusammengesetzt präsentiert sich der vhw-Vorstand: Im Rahmen des jährlichen Verbandstages wählte die Mitgliederversammlung am 24. September in Potsdam eine neue Führungsriege: Vorstand, Kuratorium und Rechnungsprüfungsausschuss wurden neu bestimmt.
Beiträge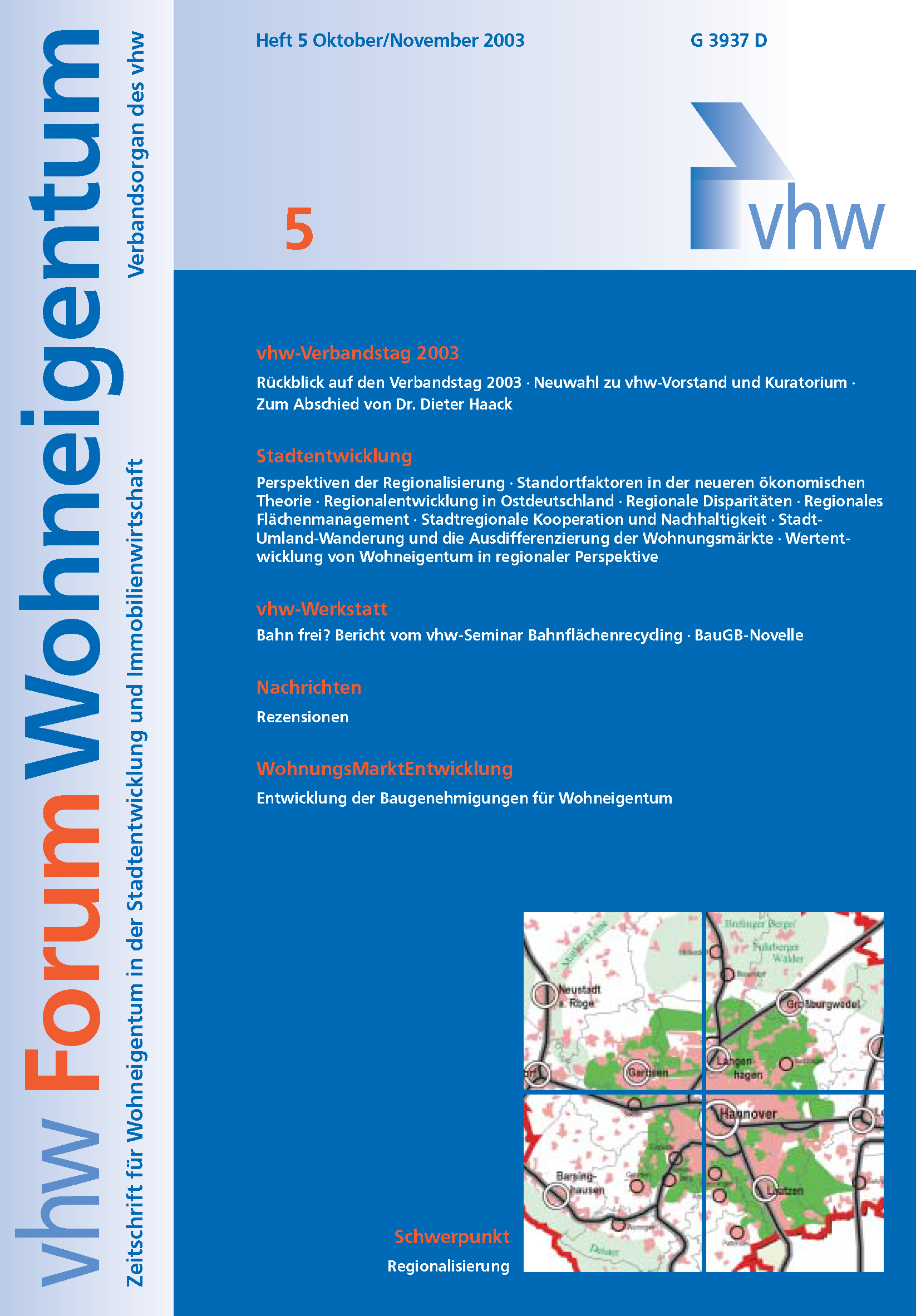
Impressionen von der Abendveranstaltung im Krongut Bornstedt und Rückblick auf die öffentliche Veranstaltung in der Katholischen Akademie. Experten aus Wohnungswirtschaft, Politik, Wissenschaft und Verwaltung diskutierten mit rund 200 Teilnehmern über die "Zukunft des Wohneigentums in Staat und Gesellschaft".
Beiträge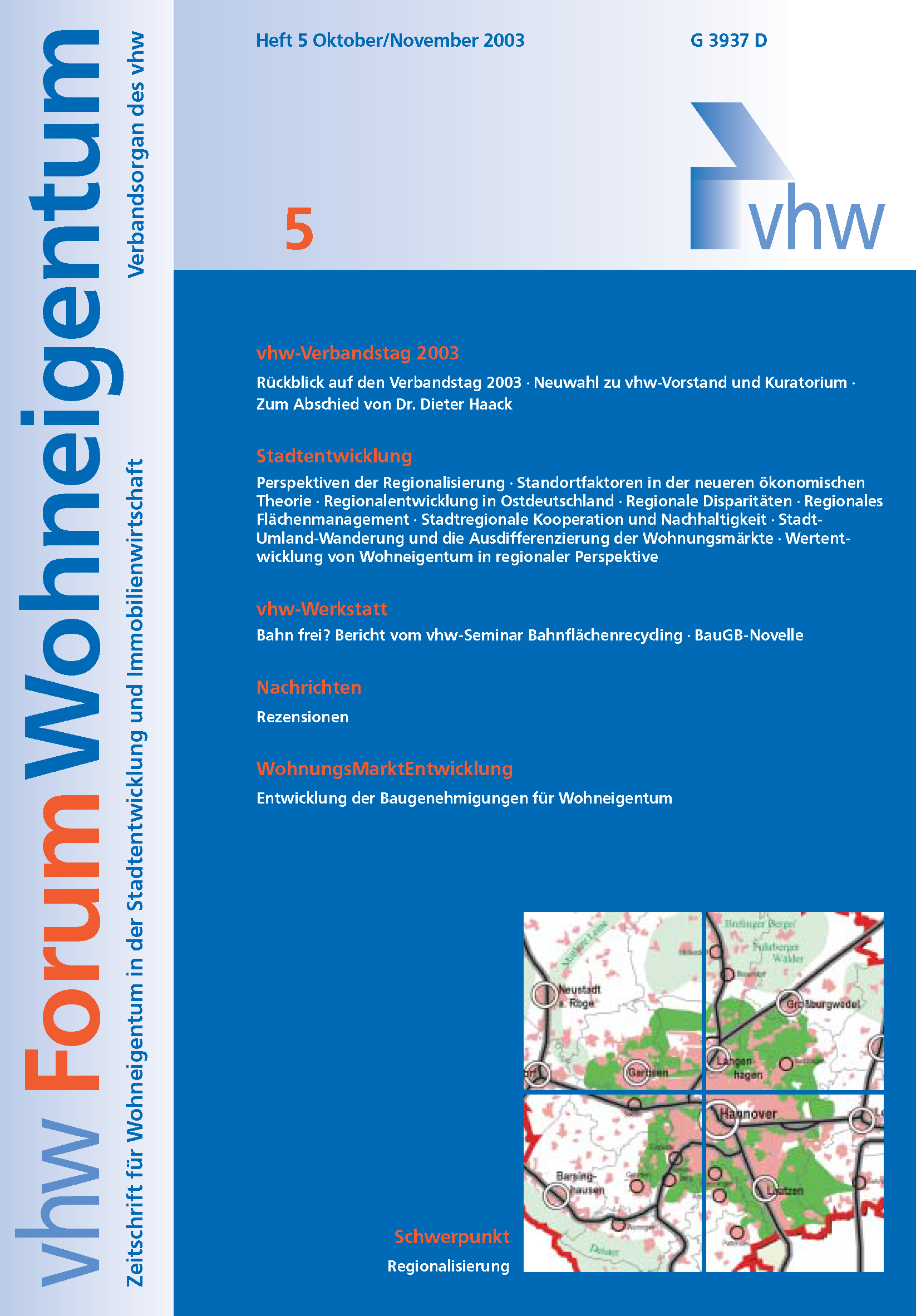
Erschienen in
Die Preise für Einfamilienhäuser weisen in den vergangenen 30 Jahren eine solide Wertentwicklung auf. Zu diesen Ergebnissen kommt die RDM-Marktforschung. Während des untersuchten Zeitraums haben sich die Preise für die beliebteste Wohnimmobilie in Deutschland verdoppelt, in manchen Großstädten sogar verdreifacht. Auch wenn Mitte der 1990er Jahre in Deutschland der Immobilienmarkt einen Einbruch zu verkraften hatte, bleibt die Investition in Wohneigentum attraktiv: Die Immobilie ist in ihrer Wertsteigerung langfristig dem Handel mit Aktien überlegen. Dies gilt besonders auch im Hinblick auf den Börsencrash in der New Economy vor wenigen Jahren.
Beiträge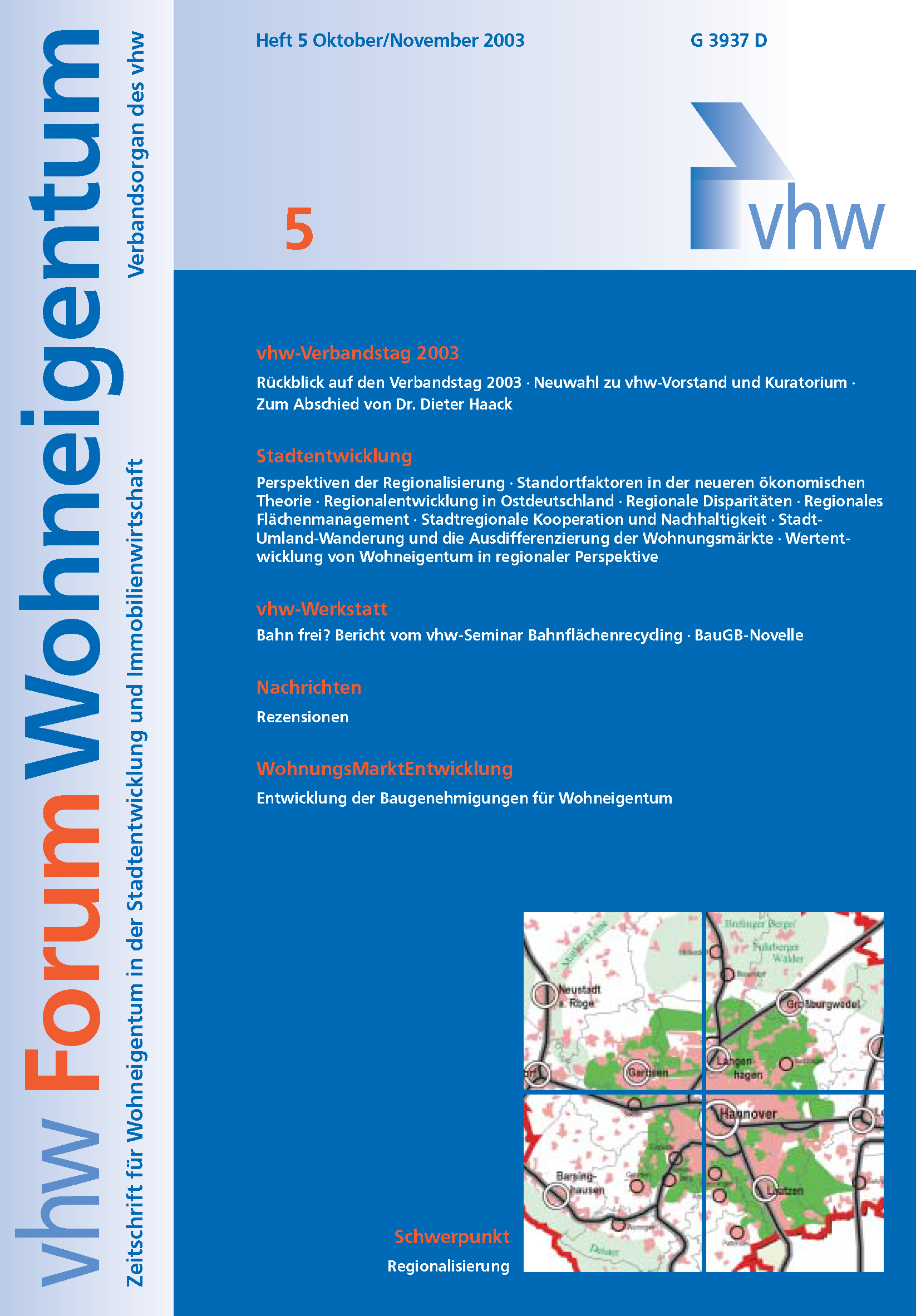
Erschienen in
Mit dem Ende des Wohnungsbaubooms der frühen 1990er Jahre sind die Wohnungsmärkte nicht nur in einen konjunkturellen Abschwung sondern auch in eine neue strukturelle Phase getreten. Unter den Bedingungen des demographischen Wandels bildet sich vielerorts ein Nachfragermarkt heraus. In diesem Markt wird die durch Wirtschaftsentwicklung und Suburbanisierung angestoßene räumliche Dynamik zu einer wichtigen Triebkraft der Entwicklung der Wohnungsmärkte und zum Motor der Neubautätigkeit werden.
Beiträge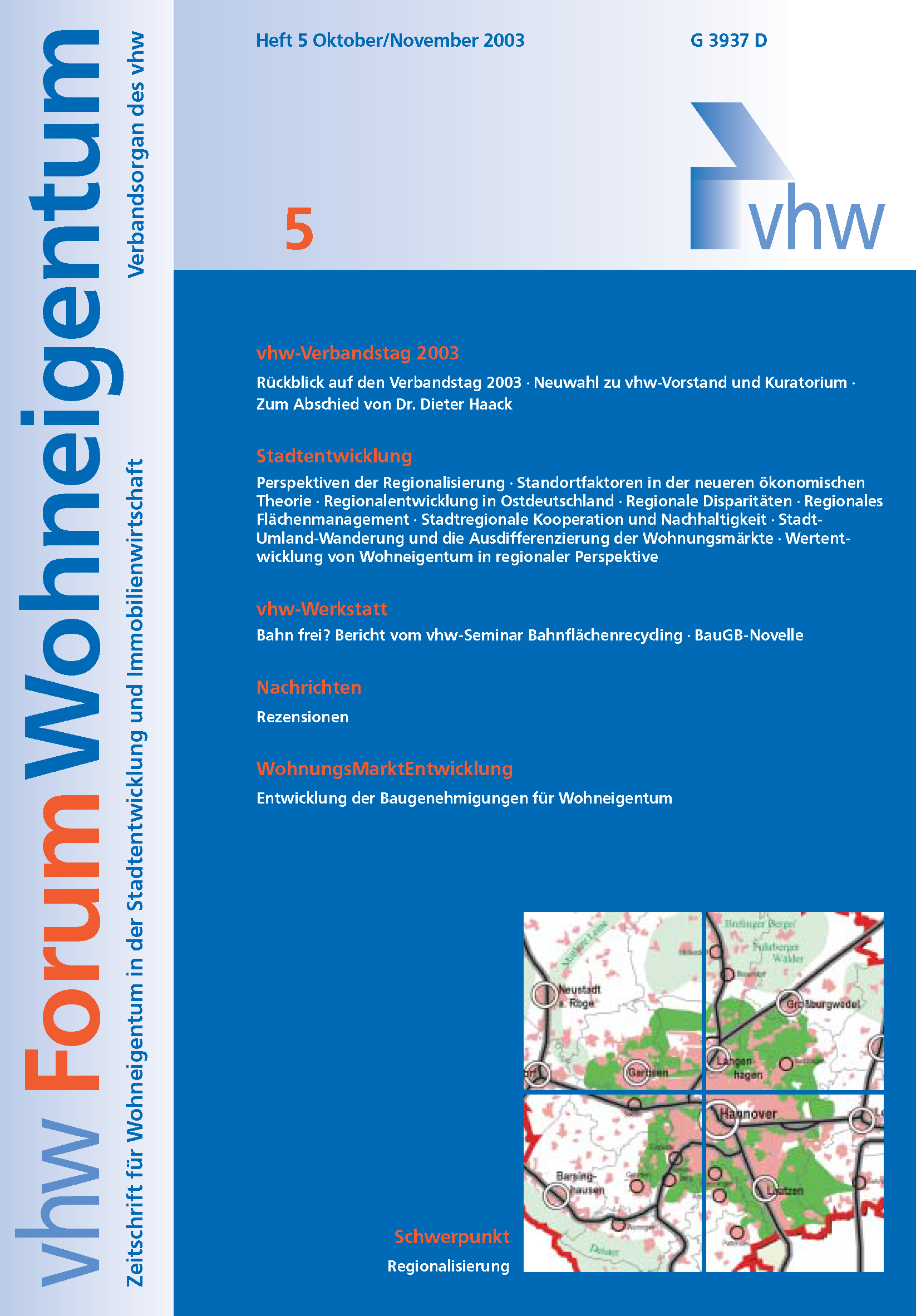
Erschienen in
Trotz Rückgangs bei den Bedarfsträgern hält der Flächenverbrauch der Stadtregionen unvermindert an. Unter diesen Voraussetzungen ist die effiziente Bereitstellung einer funktionierenden Infrastruktur immer weniger möglich. Benötigt werden deshalb Strategien zur nachhaltigen Regionalentwicklung. Erfolg versprechend sind solche Strategien nur, wenn diese auf Konsens setzen. Allerdings: Jede Planung kann nur Angebote bereitstellen – inwieweit diese von den Akteuren angenommen werden, lässt sich nur bedingt beeinflussen.
Beiträge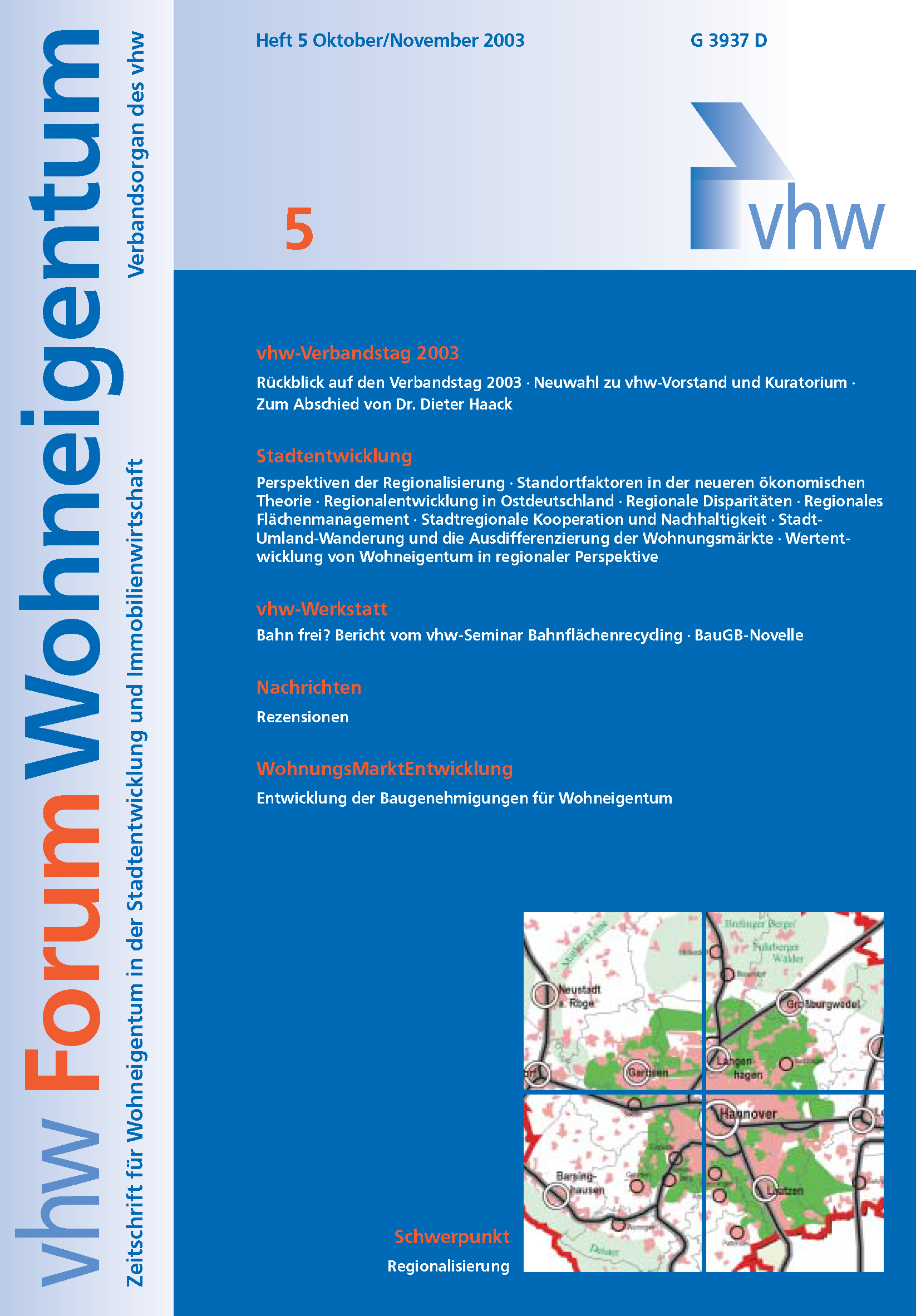
Erschienen in
Regionales Flächenmanagement besteht in der möglichst kooperativen Gestaltung der Interaktionsbeziehungen all jener Organisationen, die mit der planerischen Vorbereitung und der praktischen Umsetzung von Bauvorhaben im weitesten Sinne beschäftigt sind. Ansätze regionalen Flächenmanagements werden allerdings nur dann Erfolg haben, wenn es langfristig gelingt, die vielfältigen Instrumente, die bereits heute schon der Praxis zur Verfügung stehen, gebündelt und abgestimmt zum Einsatz zu bringen und die bestehenden Kooperationsreserven effizienter auszuschöpfen.
Beiträge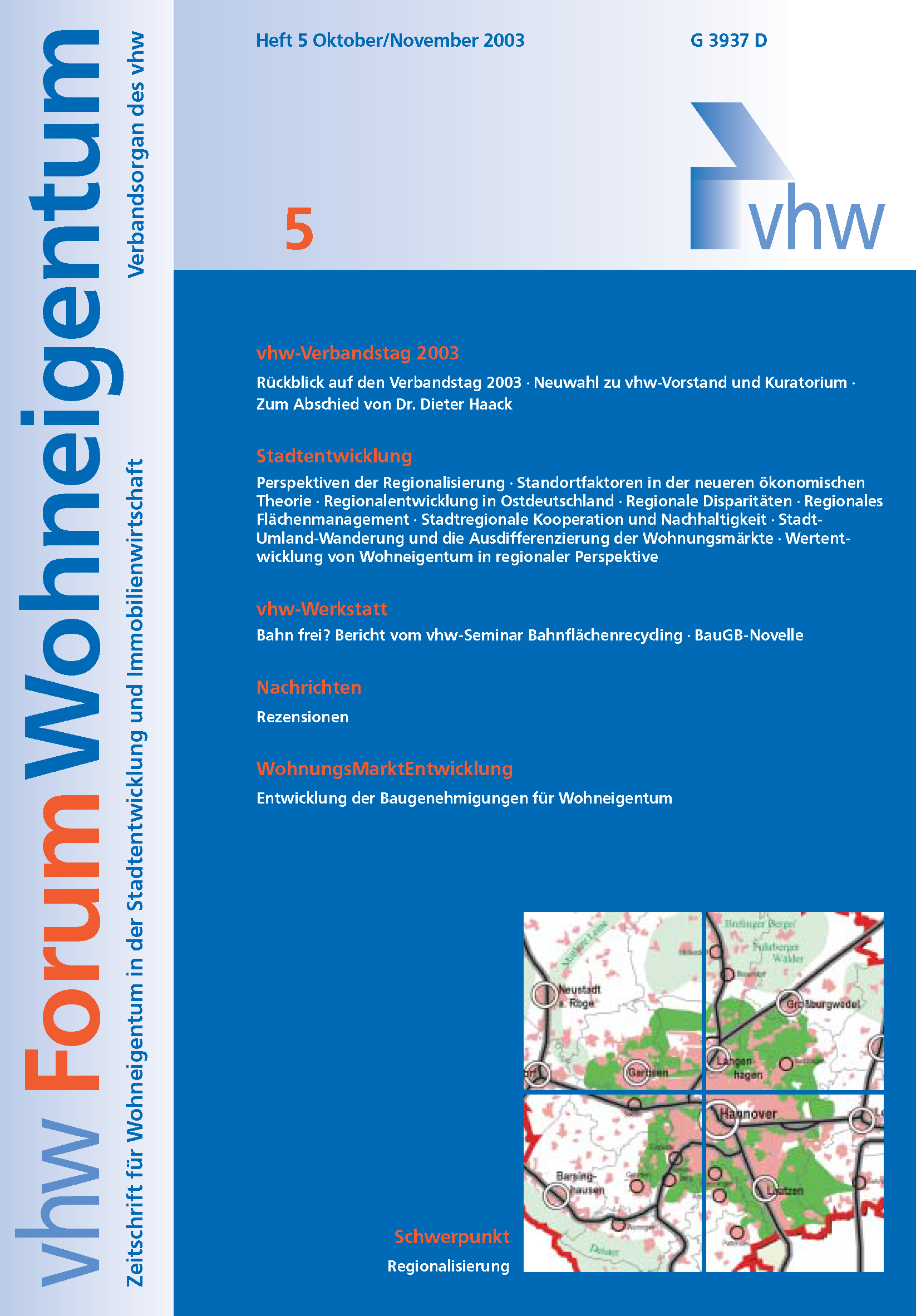
Erschienen in
Ob Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaftsstruktur, Einkommen der privaten und öffentlichen Haushalte oder Infrastruktur: Die strukturellen Defizite in den neuen Ländern sind kurz- und mittelfristig nicht auszugleichen. Im Gegenteil: die regionalen Disparitäten zwischen Ost und West nehmen zu. Offensiv gesteuerte Schrumpfung, regionale Kooperation und anhaltende Transferzahlungen sind erforderlich. Die Politik muss sich zu ihren Möglichkeiten bekennen und der Bevölkerung realistische Perspektiven aufzeigen.
Beiträge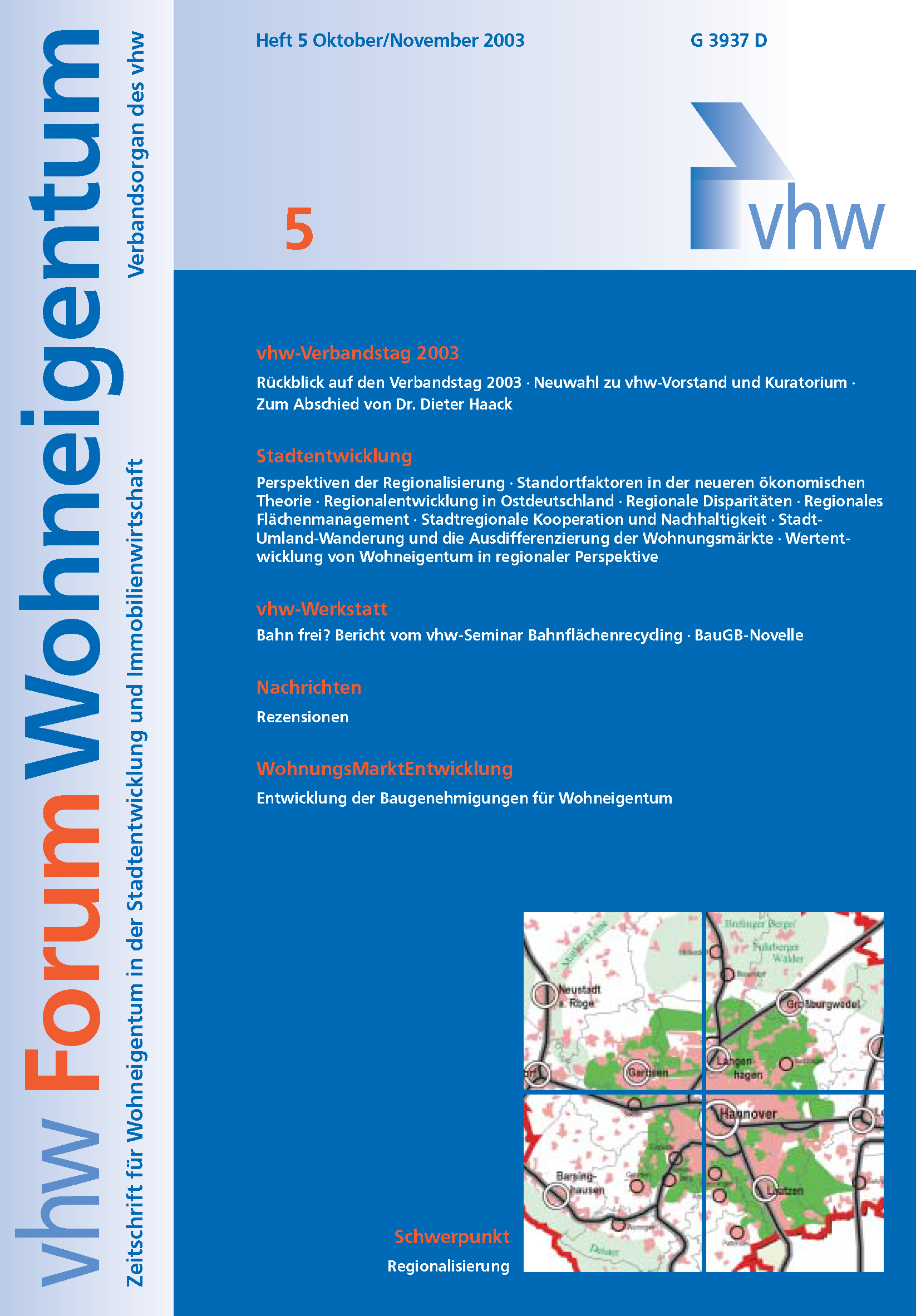
Erschienen in
Wichtige Indikatoren ökonomischer Leistungskraft zeigen immer noch große Diskrepanzen zwischen Ost- und Westdeutschland: Die Arbeitslosenquote ist im Osten mehr als doppelt so hoch wie im Westen. Im Osten erreichte das Einkommen aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 2000 nur 72 Prozent des Westniveaus, der Produktivitätsunterschied war noch größer. Der Aufholprozess Ostdeutschlands hat sich verlangsamt, ist teilweise ganz zum Stillstand gekommen. Eine bloße Betrachtung des globalen Gefälles zwischen Ost und West verdeckt jedoch erhebliche regionale Disparitäten innerhalb des Ostens, die sich in den neunziger Jahren vertieft haben. Im Folgenden wird über unterschiedliche Entwicklungspfade von Regionen an Hand von Ergebnissen des ENDOR-Projekts (Entwicklung der ostdeutschen Regionen) berichtet.
Beiträge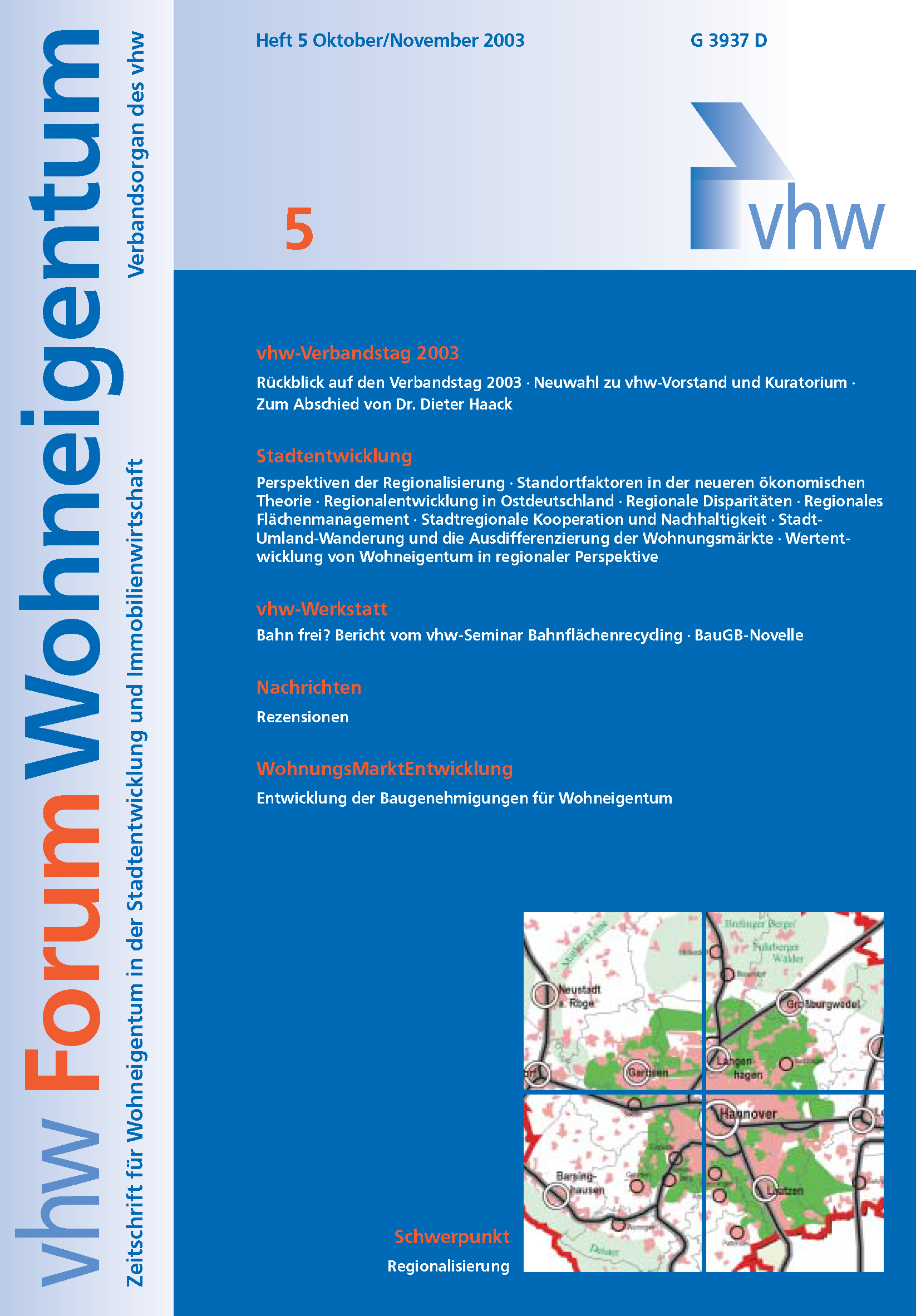
Erschienen in
Die fortschreitende Globalisierung, der europäische Integrationsprozess und neue Informations- und Kommunikationstechnologien haben den internationalen Standortwettbewerb verschärft. Ob Standorte im internationalen Wettbewerb um Firmen und hoch qualifizierte Arbeitskräfte erfolgreich sind, hängt von ihren Standortbedingungen ab. Im Folgenden wird dargestellt, welche Standortfaktoren in neueren ökonomischen Theorien der neuen Standorttheorie und der neuen Wachstumstheorie wesentlichen Einfluss auf die regionale Entwicklung nehmen. Hierbei wird begrifflich nicht zwischen Regionen und Standorten unterschieden, weil auch die betrachteten Theorien bezüglich dieser Begriffe keine inhaltliche Abgrenzung treffen.
Beiträge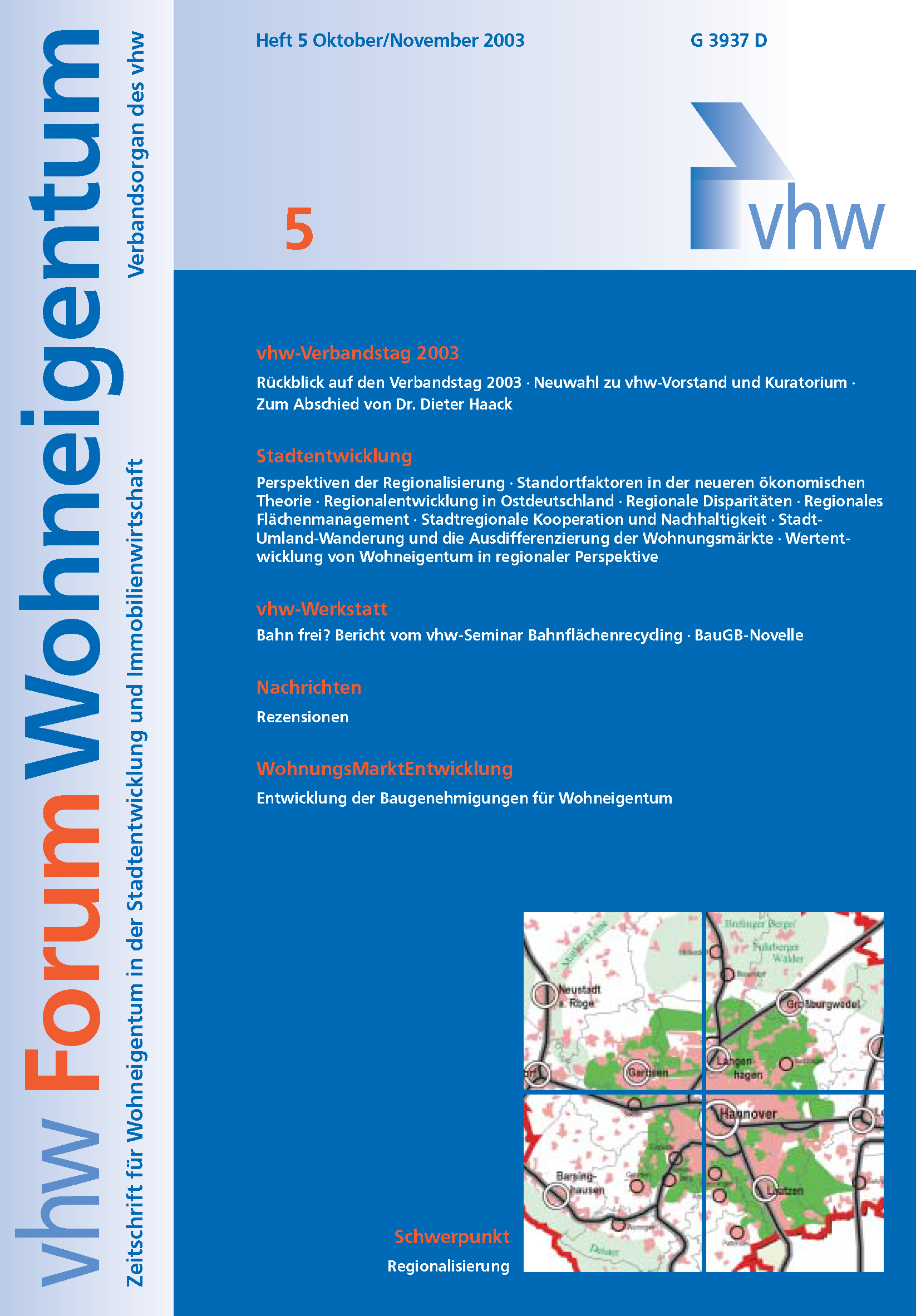
Erschienen in
Wie werden unsere Städte in 30 Jahren regiert und organisiert sein? Wird es sie in der heutigen Form noch geben oder werden wir ganz selbstverständlich in Stadtquartieren leben, die in Stadtregionen zusammengeschlossen sind? Kann diese oder eine möglicherweise ganz andere Zukunft vorausschauend in und von den Städten gestaltet werden und wie sehen die Spielräume und möglichen Entwicklungspfade aus? Keine leichten Überlegungen angesichts der bereits heute kaum lösbaren Probleme, denen Städte und Stadtregionen gegenüberstehen, und dennoch wichtige Fragen, die von den Beteiligten des Forschungsverbundes "Stadt 2030" aufgeworfen und bearbeitet werden.
Beiträge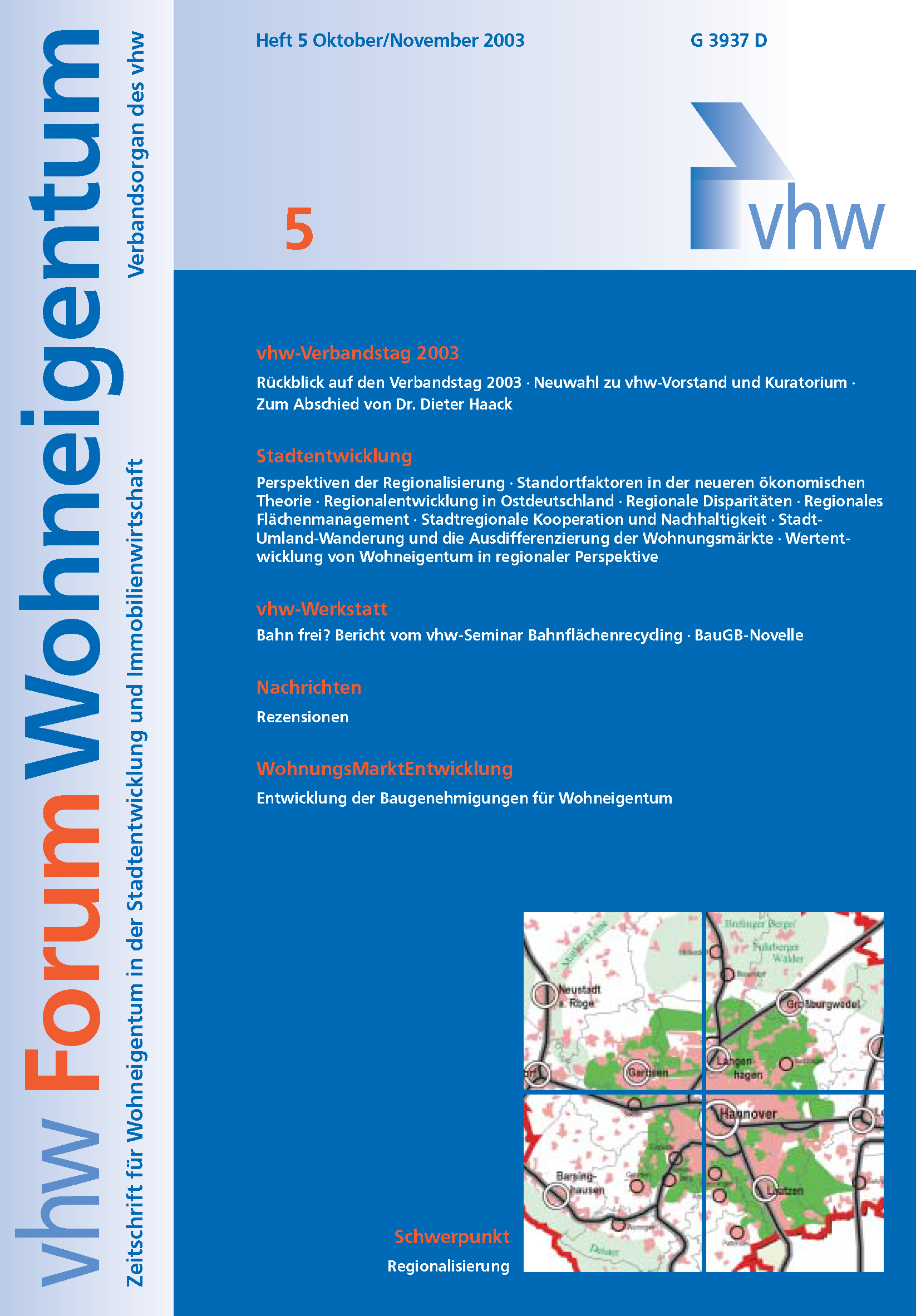
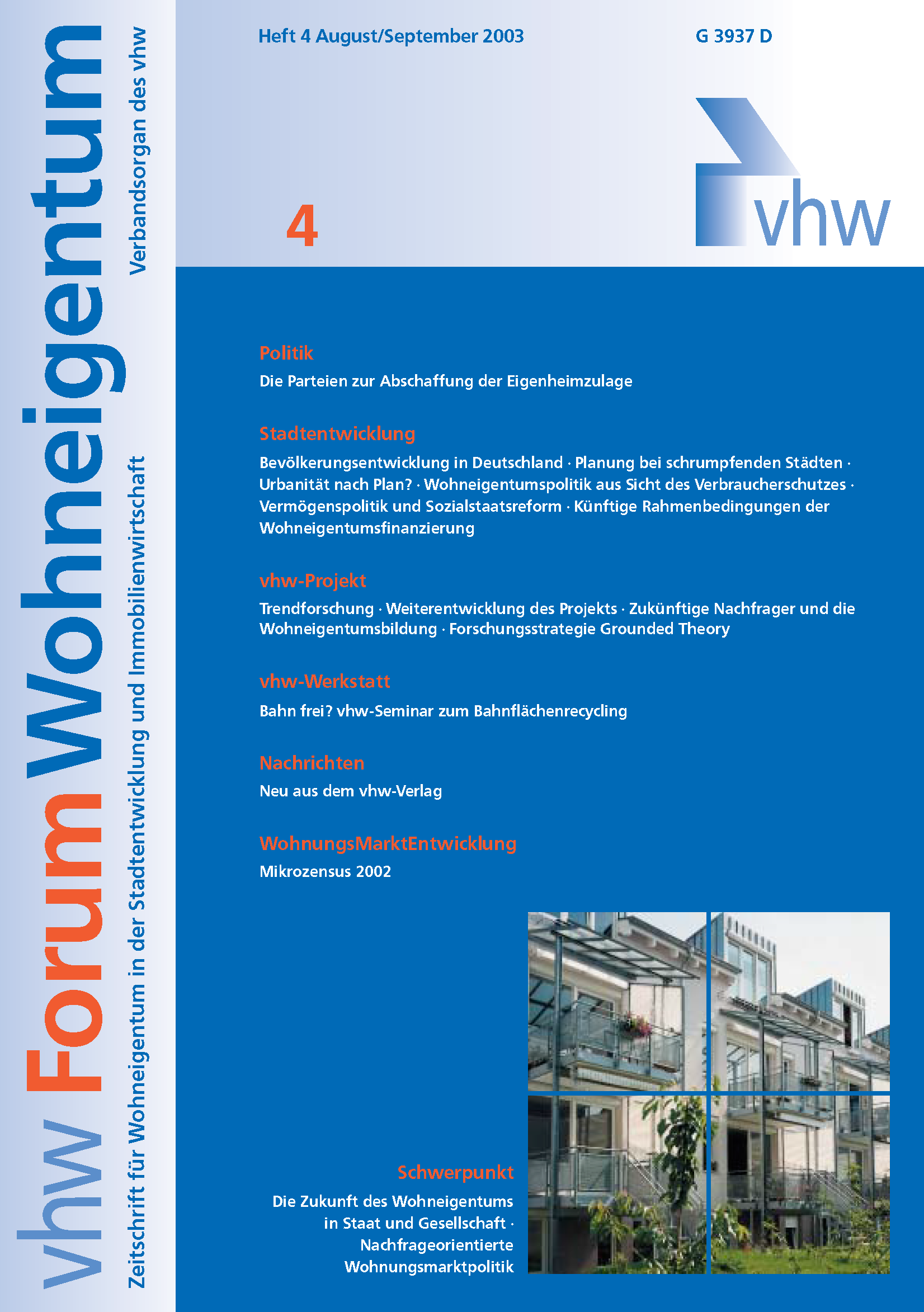
Erschienen in
Die im vier- bis fünfjährigen Turnus von den Statistischen Ämtern der Länder durchgeführten Untersuchungen zur Wohnungssituation liefern differenzierte Aussagen zur strukturellen Entwicklung des Wohnungsbestandes, zur Ausstattung der Wohnungen und nicht zuletzt zur Wohnungsversorgung der Haushalte und Familien in Deutschland. Seit August 2003 liegen nunmehr die Ergebnisse der Zusatzerhebung zum Mikrozensus vom April 2002 (MZZ) vor. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Diskussion über die Zukunft der Wohneigentumsförderung in Deutschland mit dem Beschluss der Bundesregierung, die seit 1996 bestehende Eigenheimzulage mit Wirkung vom 1. Januar 2004 vollständig zu streichen, richtet sich das Interesse besonders auf die jüngste Entwicklung der Wohneigentumsquote.
Beiträge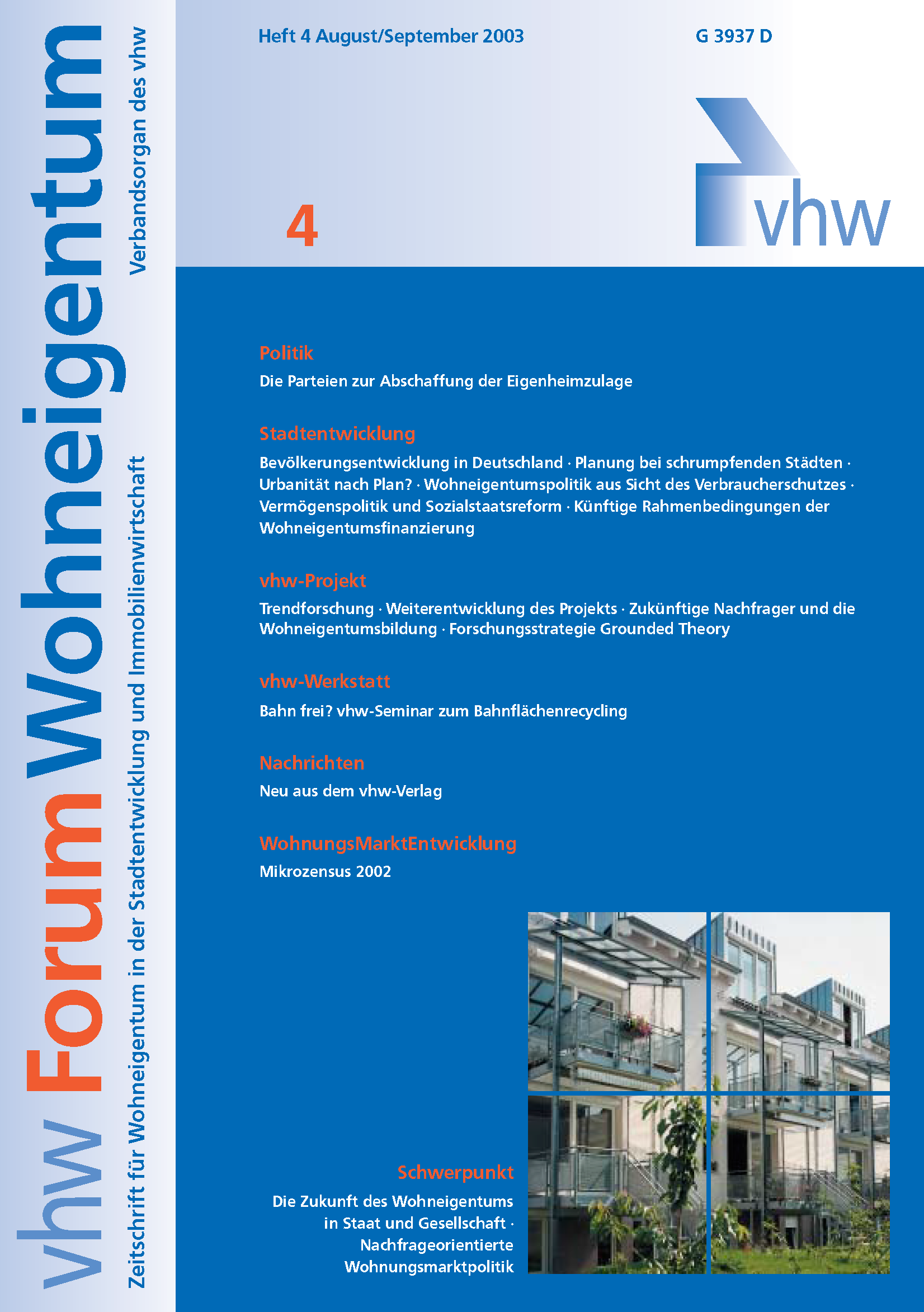
Erschienen in
Im Rahmen des vhw-Projekts "Nachfrageorientierte Wohnungspolitik" wird die sozialwissenschaftliche Forschungsstrategie der Grounded Theory verwendet, um Wohnungsmarktzusammenhänge in einem deutlich veränderten Wohnungsmarkt zu erforschen. In diesem Beitrag soll die Grounded Theory in ihren Grundzügen kurz skizziert und ein Einblick in ihre Verwendungsweise in diesem Forschungsprojekt gegeben werden. Abschließend werden die Resultate und Probleme beschrieben.
Beiträge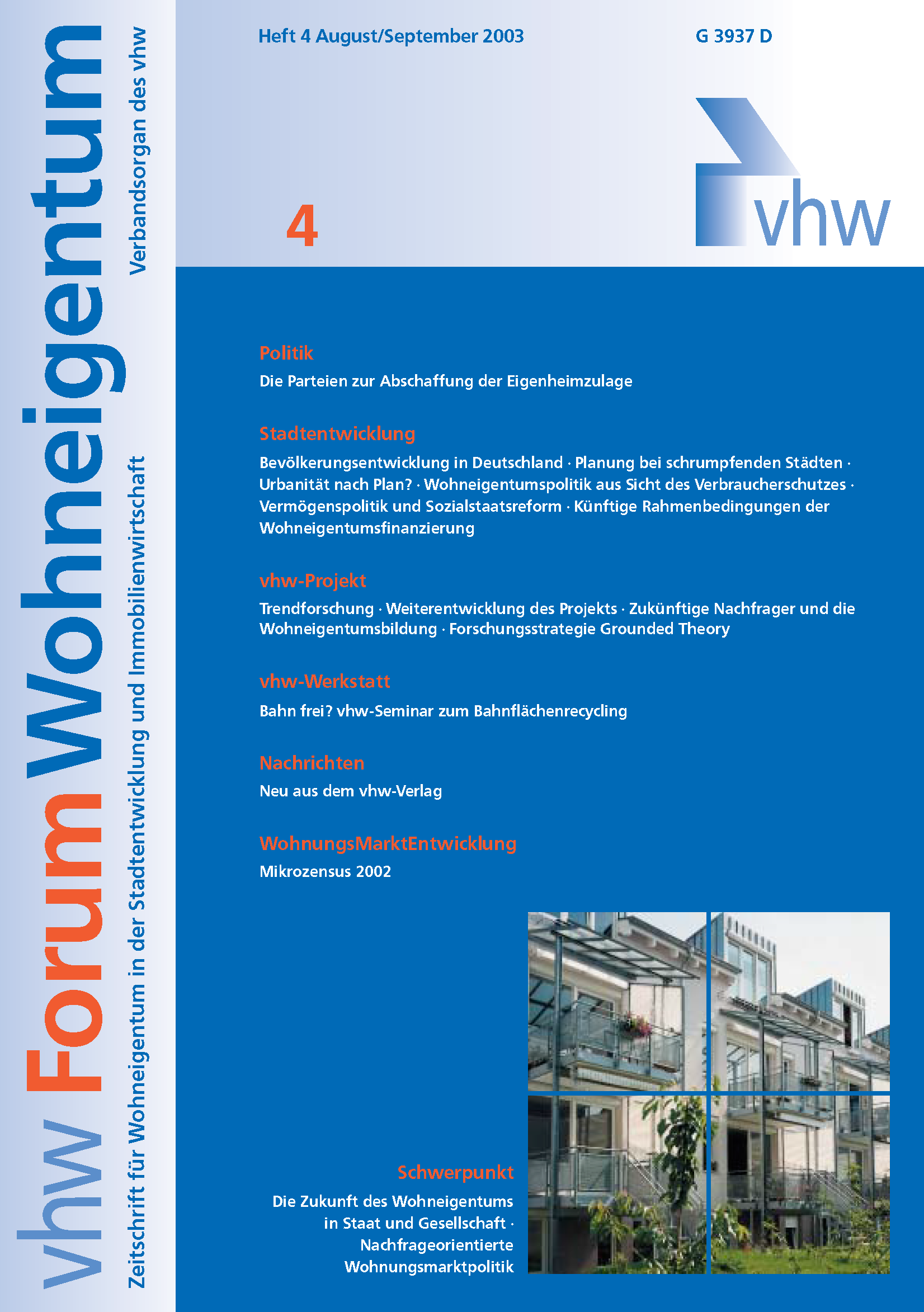
Erschienen in
Der Wohnimmobilienmarkt ist in der Krise. Zukunftsängste der Bürger und mangelnde Planungssicherheit bewirken eine ausgeprägte Zurückhaltung gegenüber größeren Anschaffungen. Zudem lässt sich der zunehmende berufliche Zwang zur Mobilität oft nicht mit dem Erwerb von Wohneigentum vereinbaren. Investitionsentscheidungen sind unter diesen Voraussetzungen auch für die Wohnungswirtschaft schwierig. Entscheidend ist es daher, die zukünftigen Marktentwicklungen realistisch abschätzen zu können und die Wünsche der Nachfrager zu kennen.
Beiträge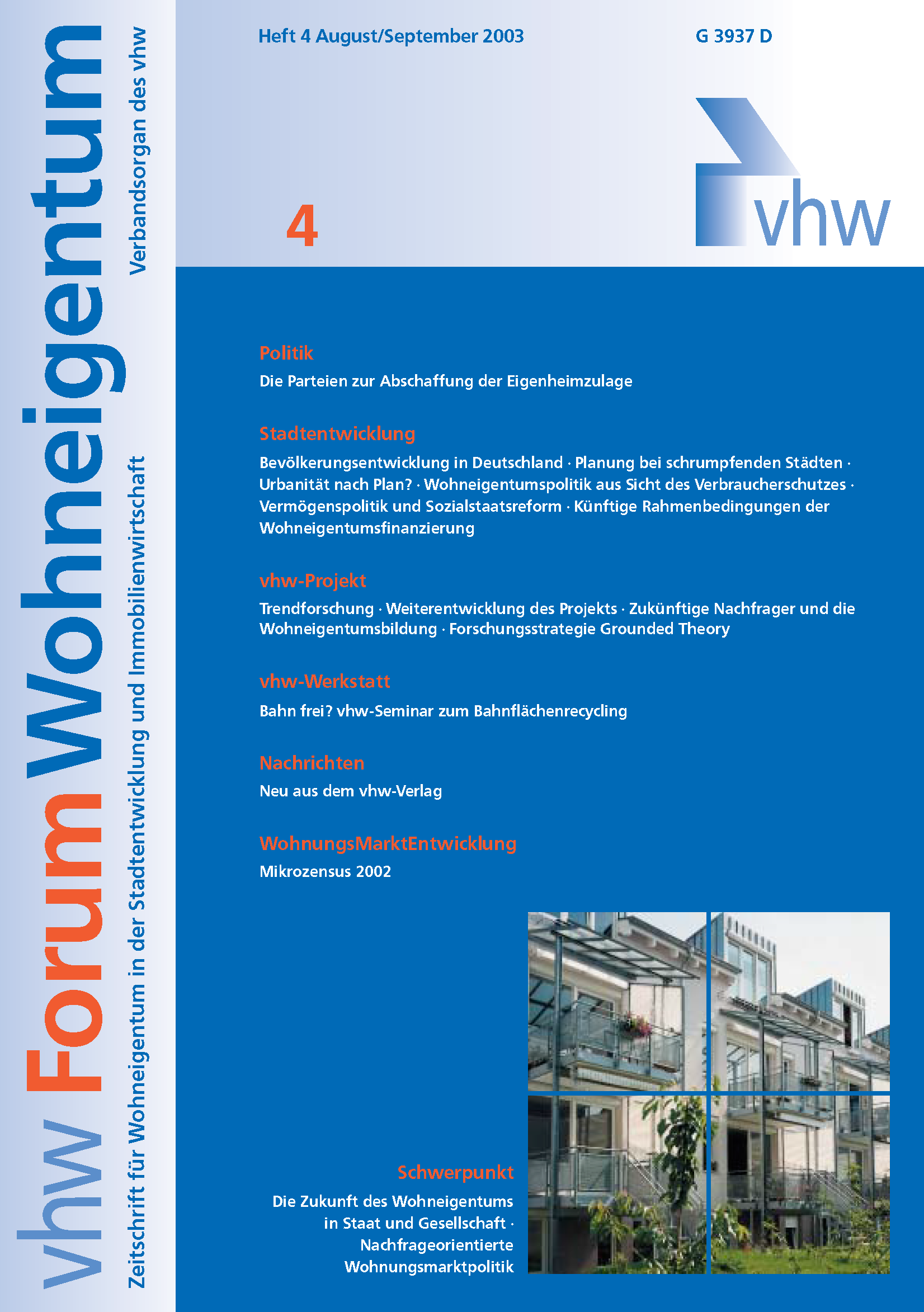
Erschienen in
Das Projekt "Nachfrageorientierte Wohnungspolitik" wurde im Juli 2002 vom vhw initiiert. Es knüpft an die im Jahr 1999 mit großen Erwartungen publizierte Studie "Mehr Transparenz auf dem Wohnungsmarkt" (vhw 1999) an. Mit diesem Projekt wird das wohnungspolitisch notwendige Ziel verfolgt, nachfragebezogene Interessen auf den differenzierter werdenden Wohnungsteilmärkten in Deutschland systematisch zu stärken, um so Handlungs- und Gestaltungskonzepte für die unterschiedlichen Akteure auf dem Wohnungsmarkt zu entwickeln. Dieser Beitrag vermittelt einen aktuellen Blick auf die Projektarbeit.
Beiträge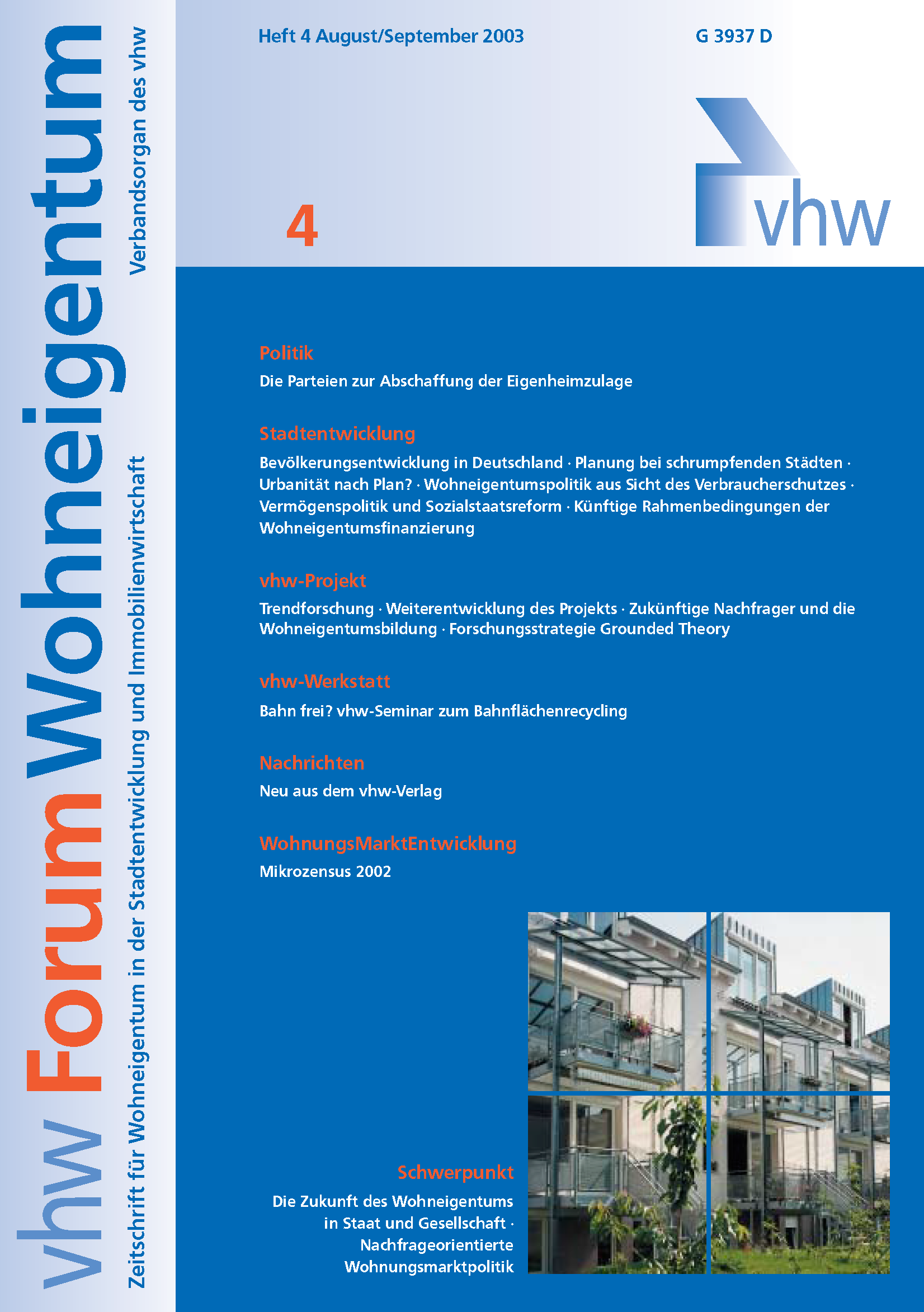
Erschienen in
Im Rahmen des im Jahr 2002 eingeleiteten vhw-Projektes "Nachfrageorientierte Wohnungspolitik", das im März 2003 der Fachöffentlichkeit vorgestellt wurde, beteiligt sich der Verband erstmals mit einem eigenen Exklusivfragenblock an der diesjährigen Trendforschung des Heidelberger Sinus-Institutes. Die auf diesem Wege gewonnenen Ergebnisse werden mit der parallel durchgeführten allgemeinen Trend- und Milieuforschung verknüpft. Über die Sinus-Milieus und die Mikrogeographie sollen die Ergebnisse auch auf die kleinräumige Ebene des operativen Wohnungsmarktgeschehens übertragen und dort als zusätzlicher Erkenntnisstrang über die qualitative Nachfrage für die Interpretation der örtlichen Wohnungsmarktzusammenhänge genutzt werden.
Beiträge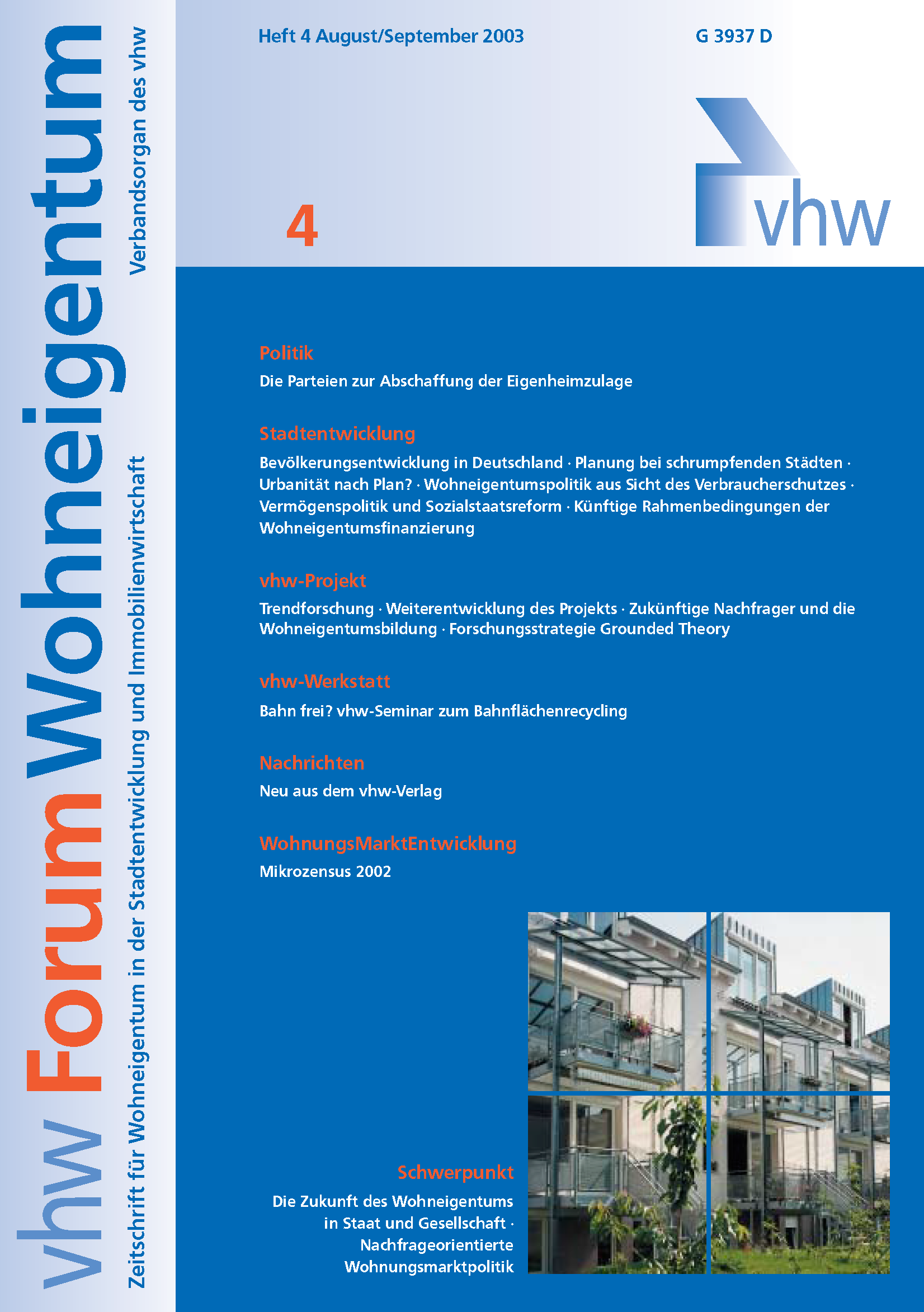
Erschienen in
Die Zukunft der Wohneigentumsfinanzierung ist völlig offen – zu wechselhaft sind die politischen Vorgaben und zu ungewiss ist die demographische Entwicklung. Hinzu kommen offene Fragen bei den internationalen Rahmenbedingungen auf Kapitalmarktseite und Trends zur Bürokratisierung aus Brüssel. Dennoch gibt es gute Gründe, auch in Zukunft an einen funktionierenden Wettbewerb und vielfältige Finanzierungsangebote zu glauben.
Beiträge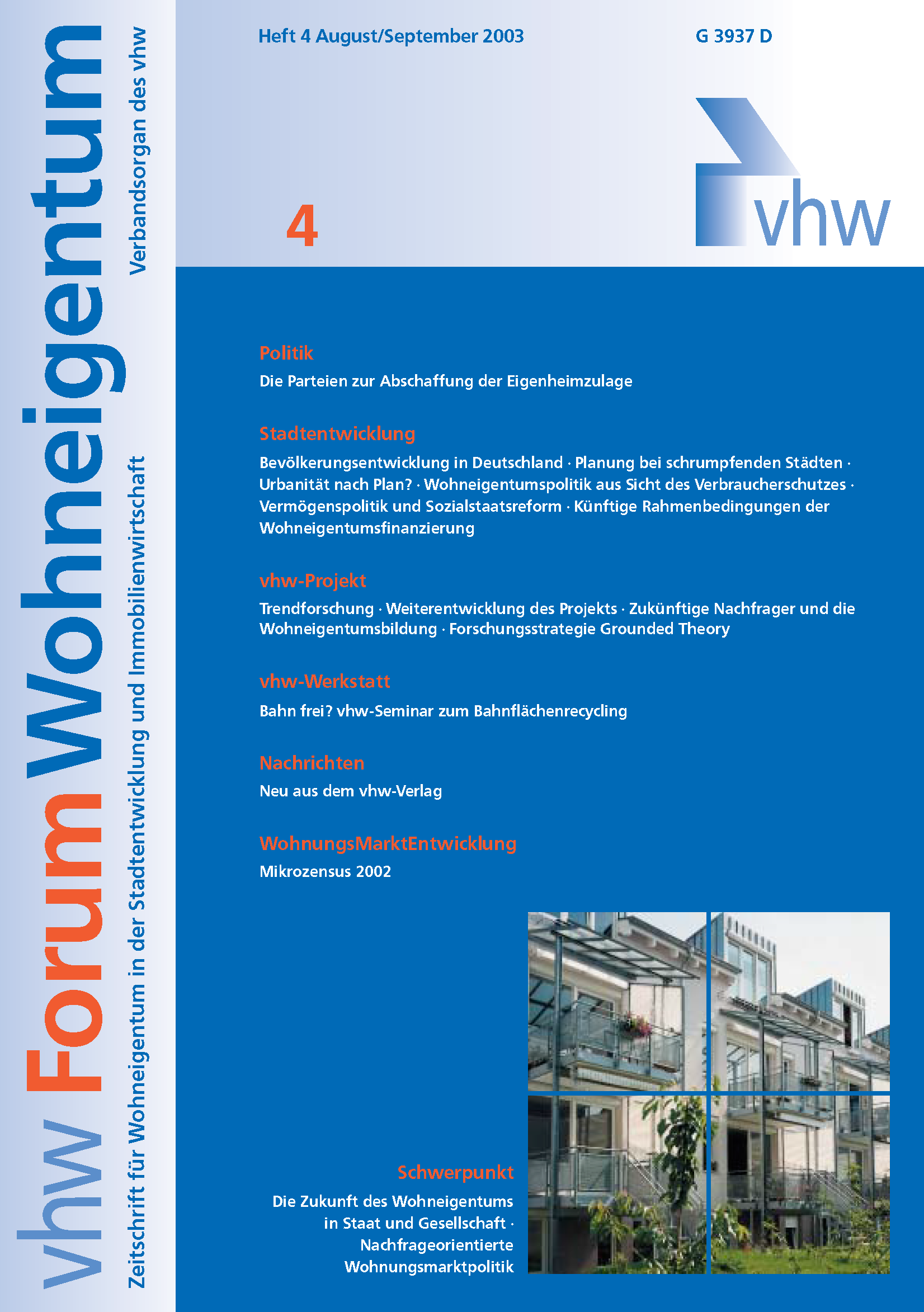
Erschienen in
Die öffentlichen Haushalte sind leer, die sozialen Sicherungssysteme in der Krise. Private Altersvorsorge wird in Zukunft unvermeidlich zu einem Grundpfeiler der Sozialpolitik werden. Als geradezu "klassische" Form der privaten Altersvorsorge muss das selbstgenutzte Wohneigentum gelten. Insofern sind die Pläne der Bundesregierung zur Kürzung der Wohneigentumsförderung problematisch – sollten sie umgesetzt werden, ist mit erheblichen Auswirkungen zu rechnen.
Beiträge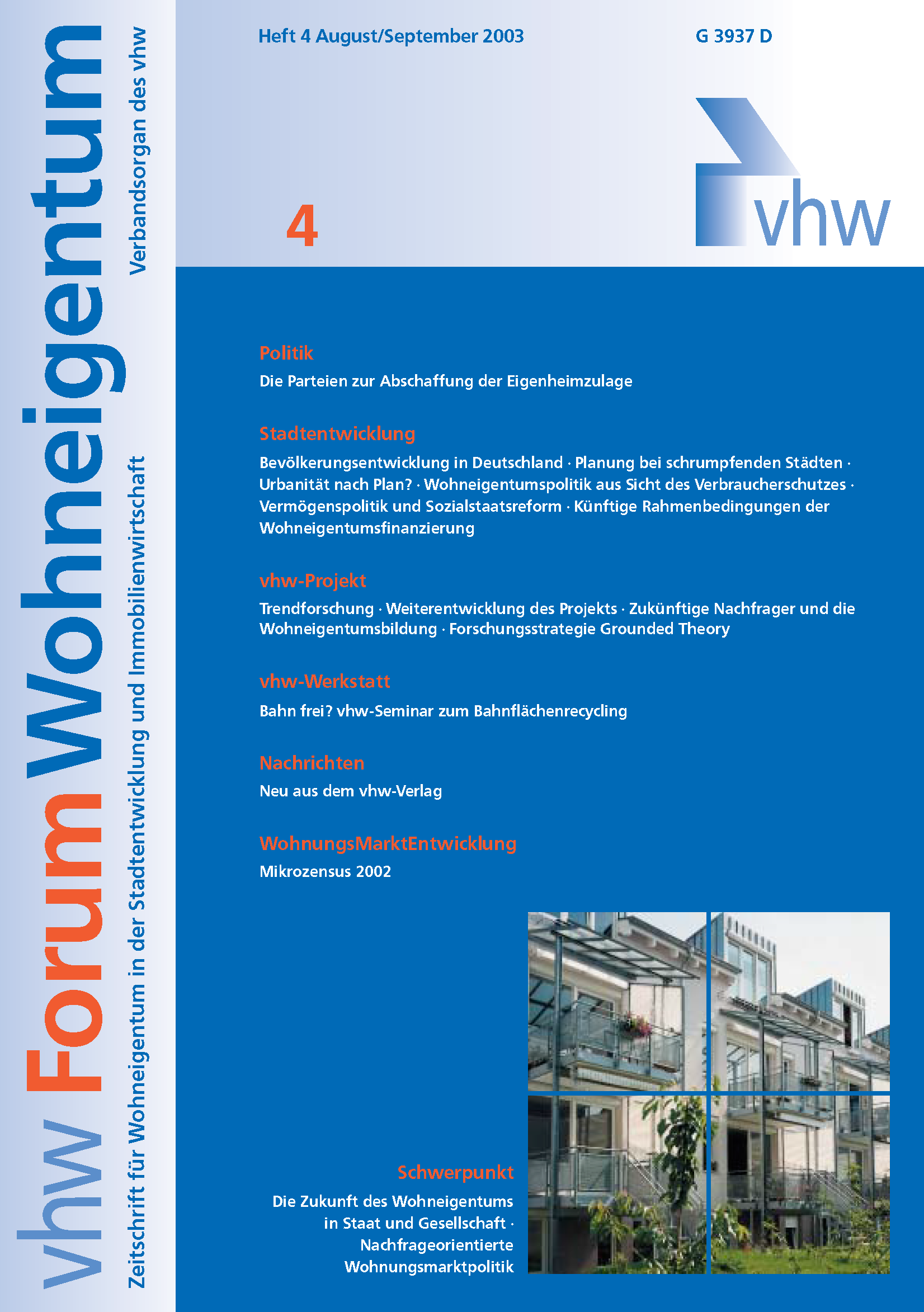
Erschienen in
Die politische Diskussion um die Zukunft des Wohneigentums ist seit Monaten in vollem Gange. Die Auswirkungen dieser Diskussion auf die Verbraucher sind bereits vor einer eventuellen Umsetzung bemerkbar: Durch die Verunsicherung der privaten Haushalte kommt es zu Vorzieheffekten. Für die Verbraucherverbände stellt sich die Frage: Welche Bedeutung hat die Schaffung von Wohneigentum für die Vermögensbildung und die Altersvorsorge und wie ist die Rolle des Staates hierbei zu bewerten?
Beiträge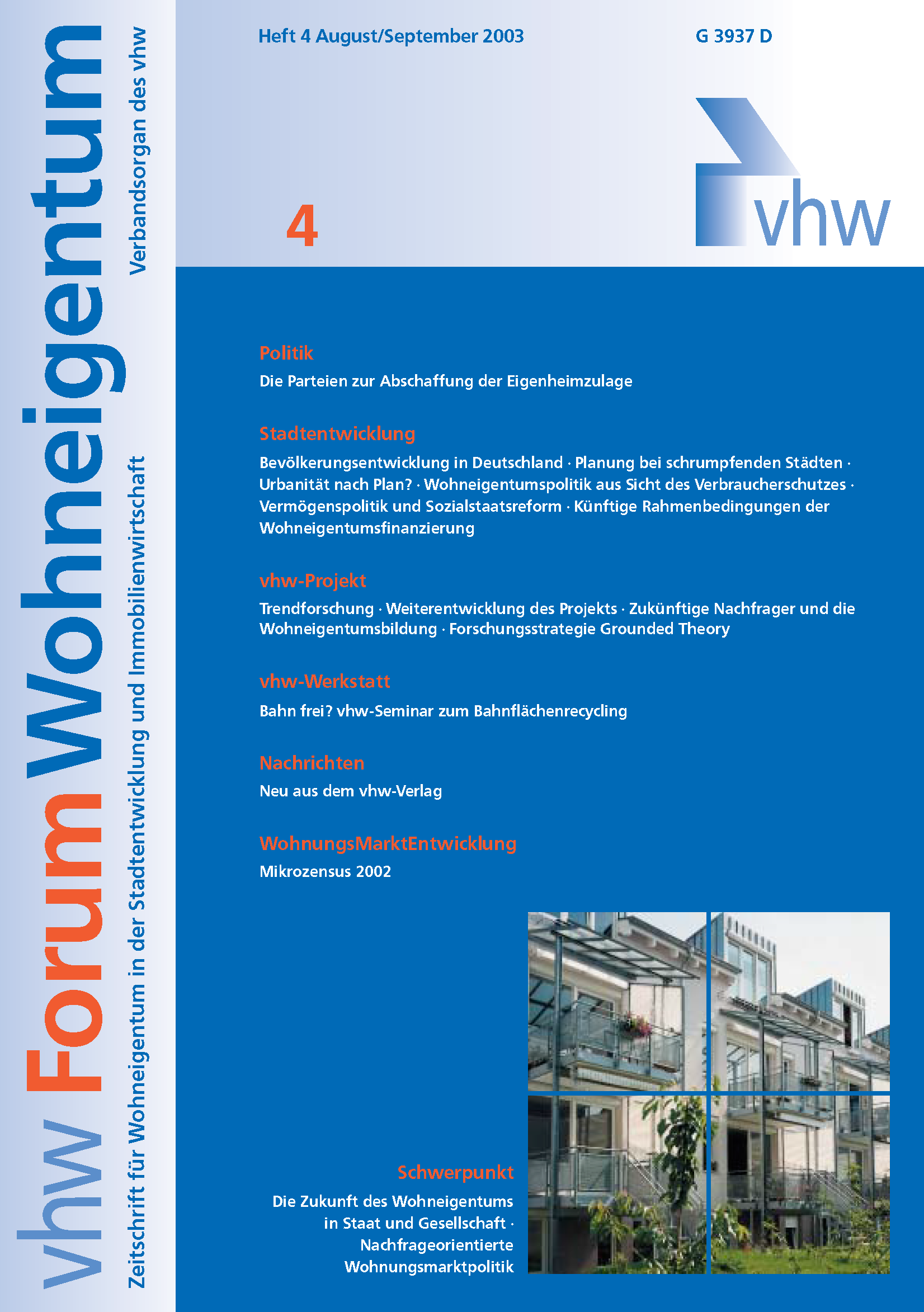
Erschienen in
"Richtige Stadt", das soll heißen: Mehr Vielfalt, mehr Kontraste auf engem Raum nebeneinander! Die These ist, dass durch Bauleitplanung und Investoren bislang zu viel für einen anonymen Markt geplant und optimiert wurde. Erst wenn für konkrete Personen und bestimmte Milieus geplant wird, kann die Wohnarchitektur so ausgeprägt und vielfältig werden wie die Wohnwünsche. Und erst wenn die Wohnhäuser nicht mehr nur zum "reinen Wohnen" taugen, kann sich in Neubauquartieren städtisches Leben entfalten.
Beiträge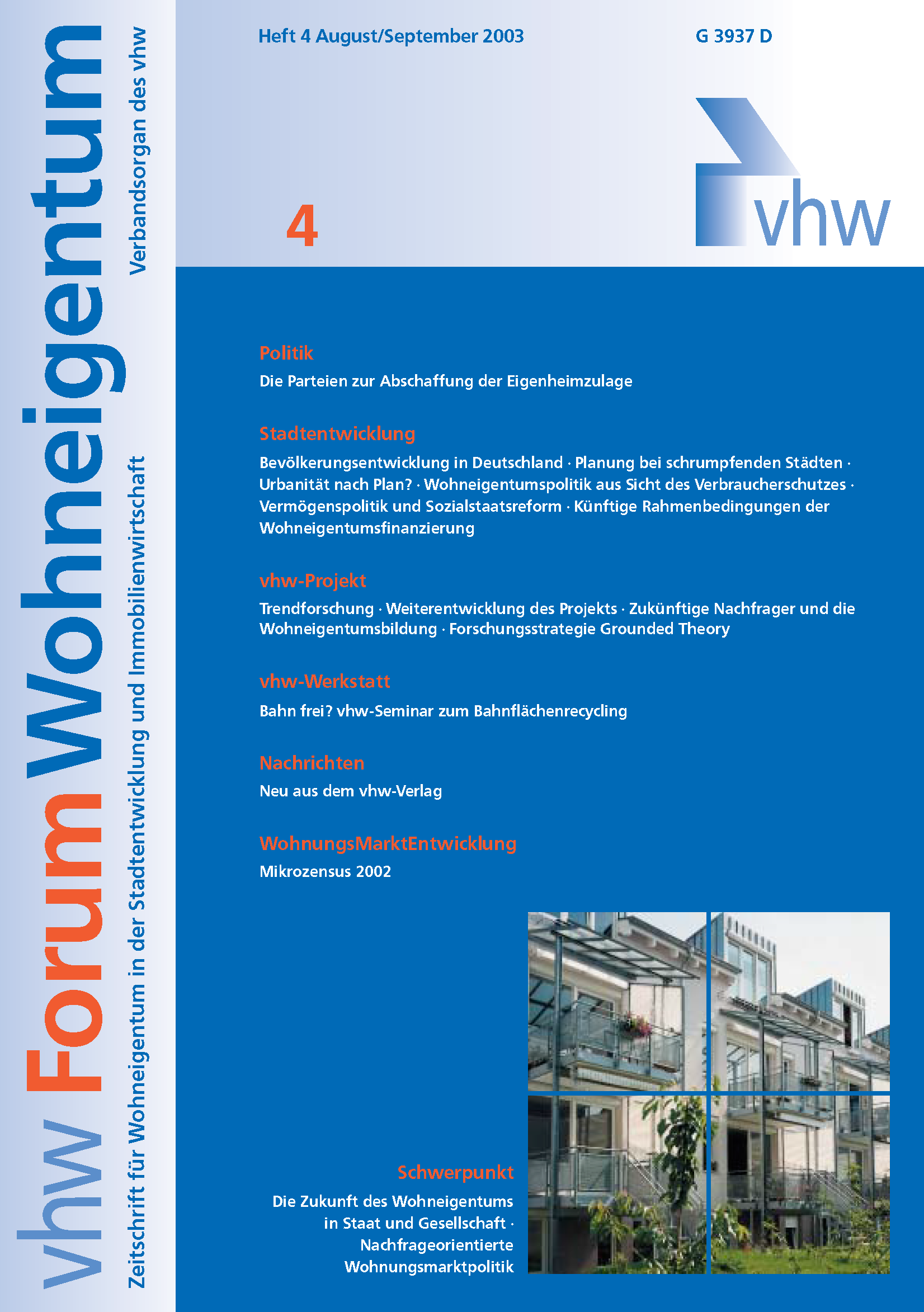
Mit zurückgehender Bevölkerung schrumpfen auch die Städte, millionenfacher Wohnungsleerstand ist die Folge. Auch viele Bereiche der technischen und sozialen Infrastruktur weisen zunehmend Überkapazitäten auf. Gleichzeitig sinken die kommunalen Einnahmen. Ein Paradigmenwechsel im Planungsverständnis ist nötig. Dabei erweist sich Angebotsplanung vielfach als schwieriger als Neuplanung. Doch der Schrumpfungsprozess bringt nicht nur Nachteile mit sich – er ermöglicht auch neue Angebotsqualitäten.
Beiträge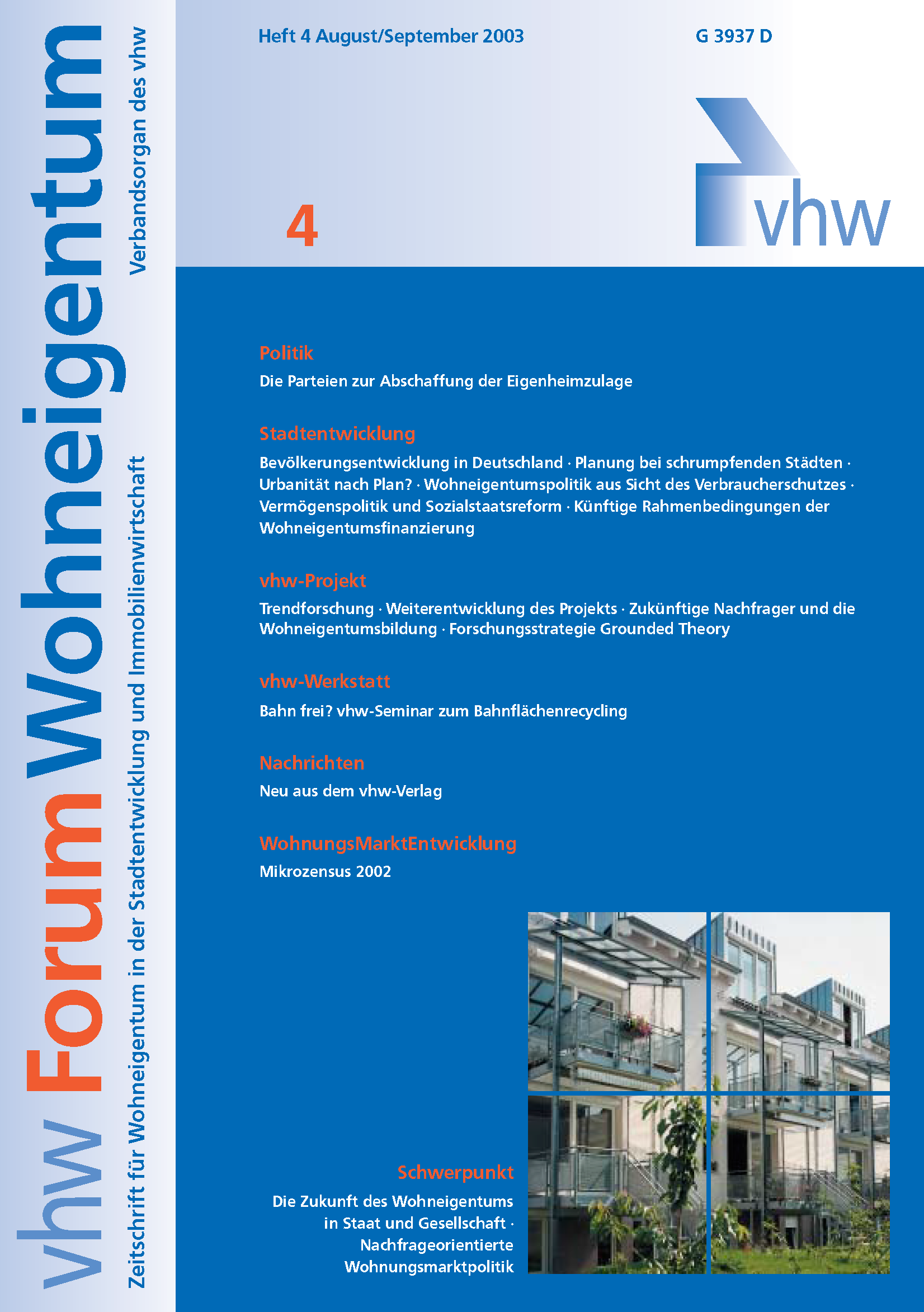
Erschienen in
Deutschlands Bevölkerung altert. Und sie wird im 21. Jahrhundert wahrscheinlich auch schrumpfen. In Teilen Deutschlands hat dieser Rückgang der Einwohnerzahl schon begonnen. Andere Regionen wachsen noch. Dies bewirkt einen regional sehr ungleichen Bedarf an zusätzlichem Wohnraum. Insgesamt ist in den kommenden Jahren mit weniger Nachfrage nach Eigenheimen und Wohnungen für Jungfamilien und mit einer steigenden Nachfrage im Segment des alten- und pflegegerechten Wohnraums zu rechnen. Zugleich wird sich das Interesse an Haus- und Wohnungseigentum als Anlageform vergrößern.
Beiträge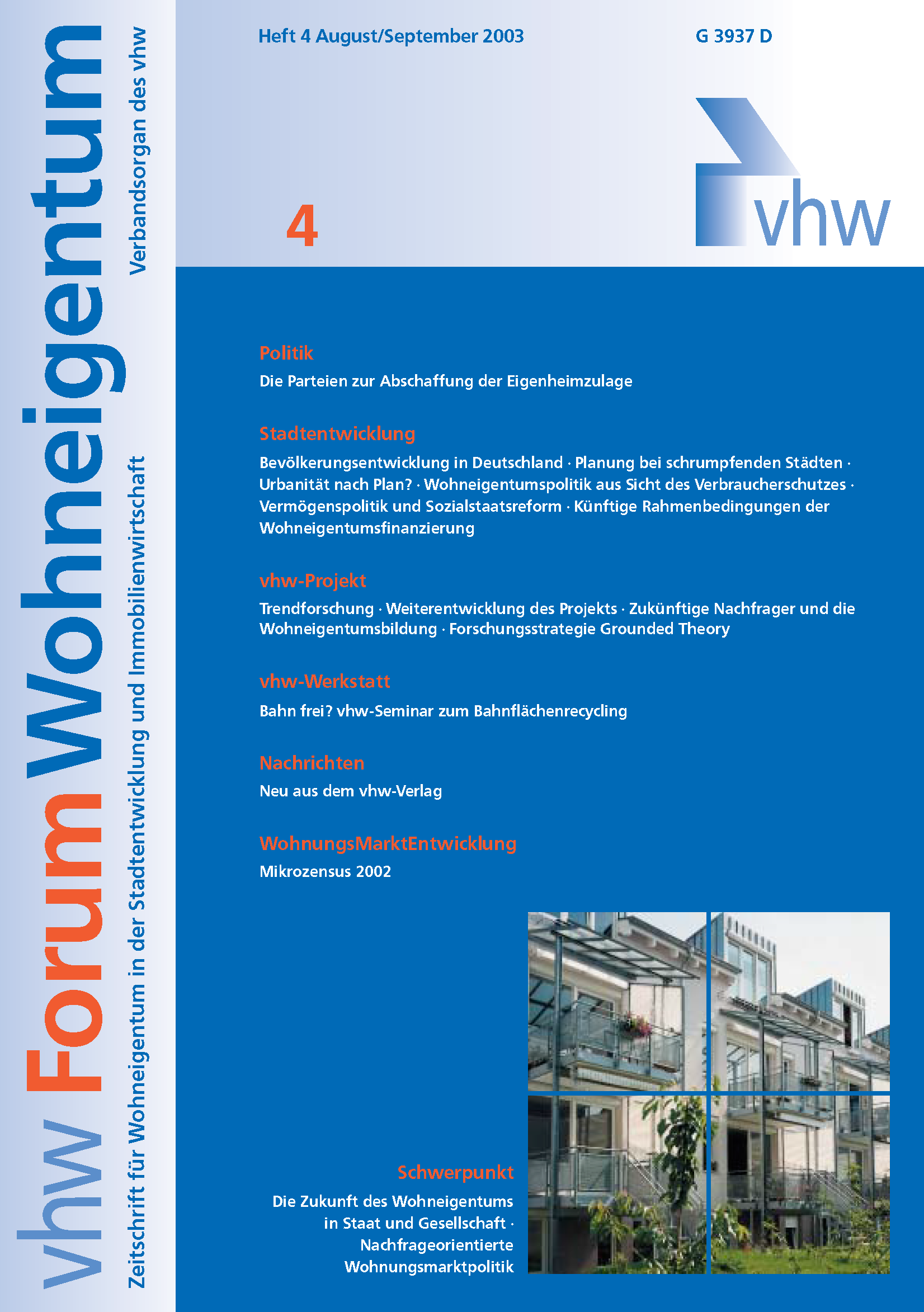
Erschienen in
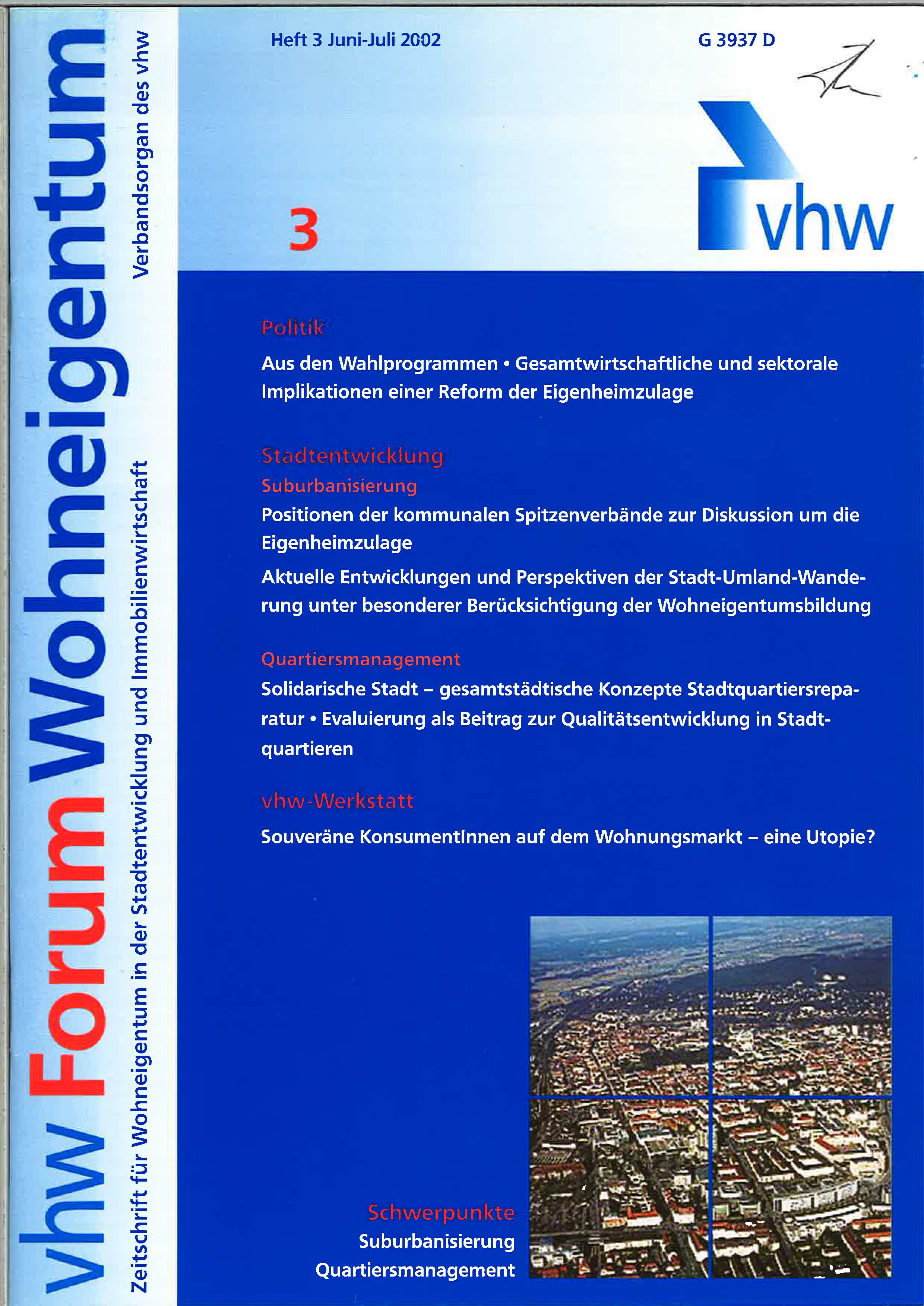
Erschienen in
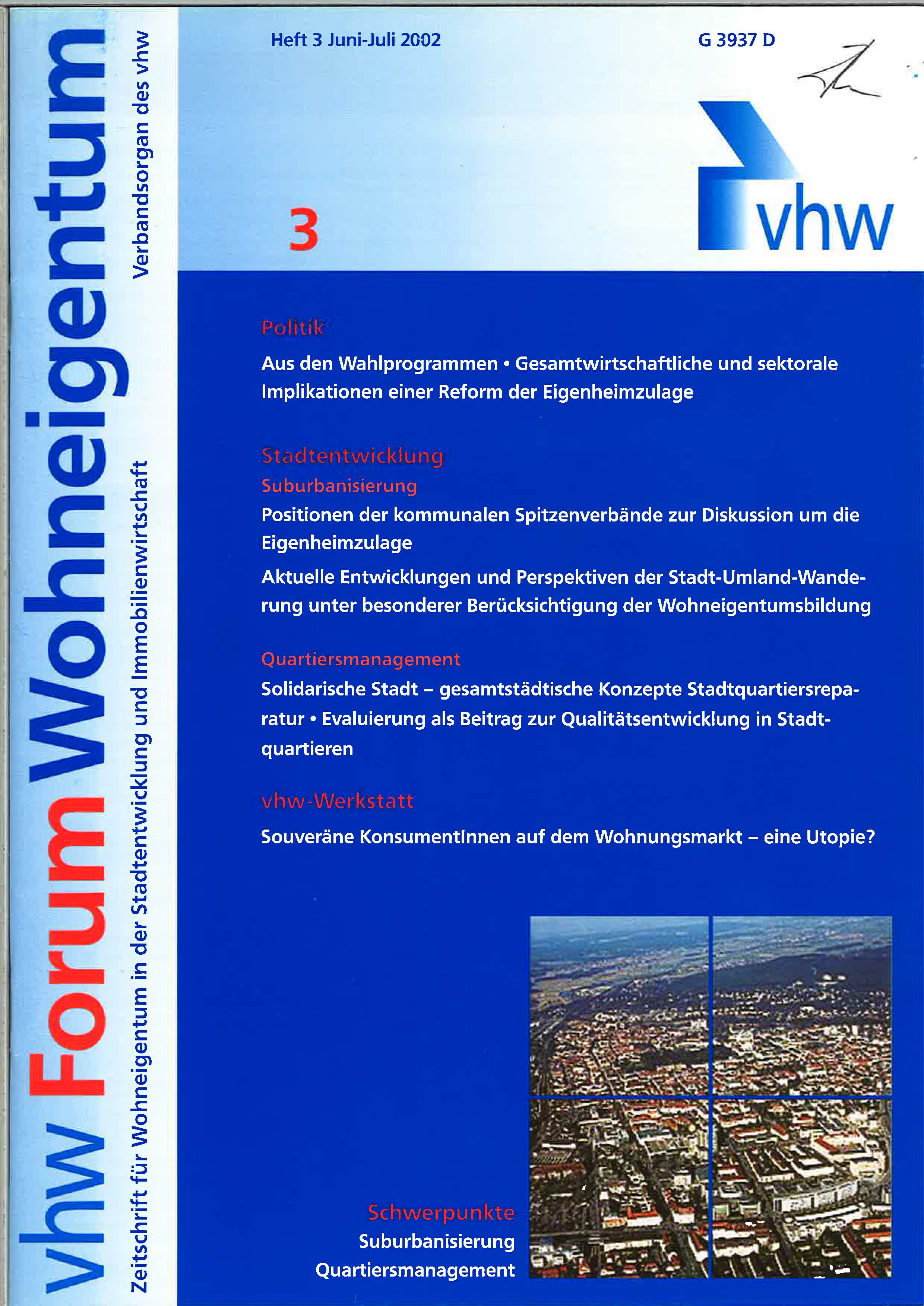
Erschienen in
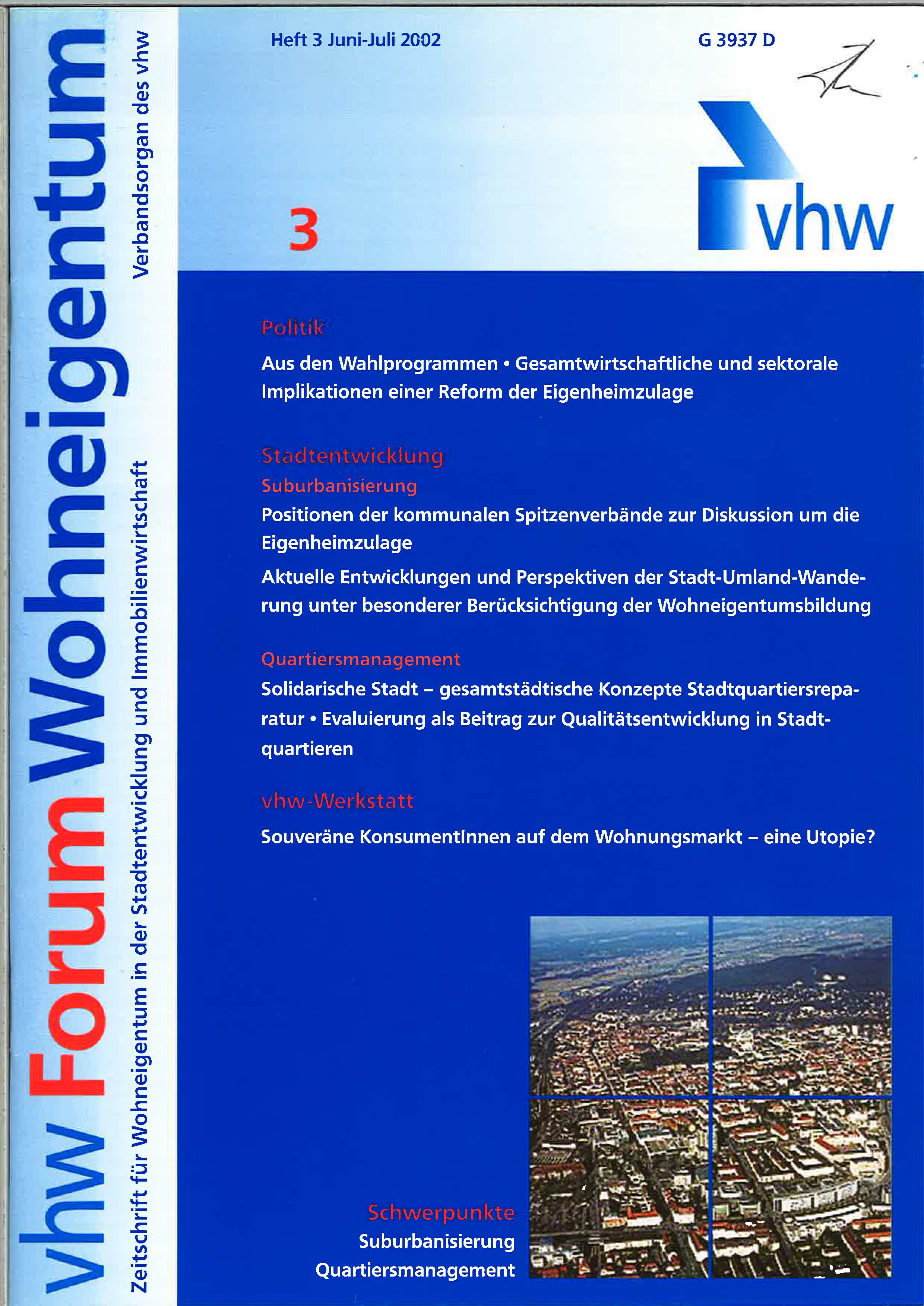
Erschienen in
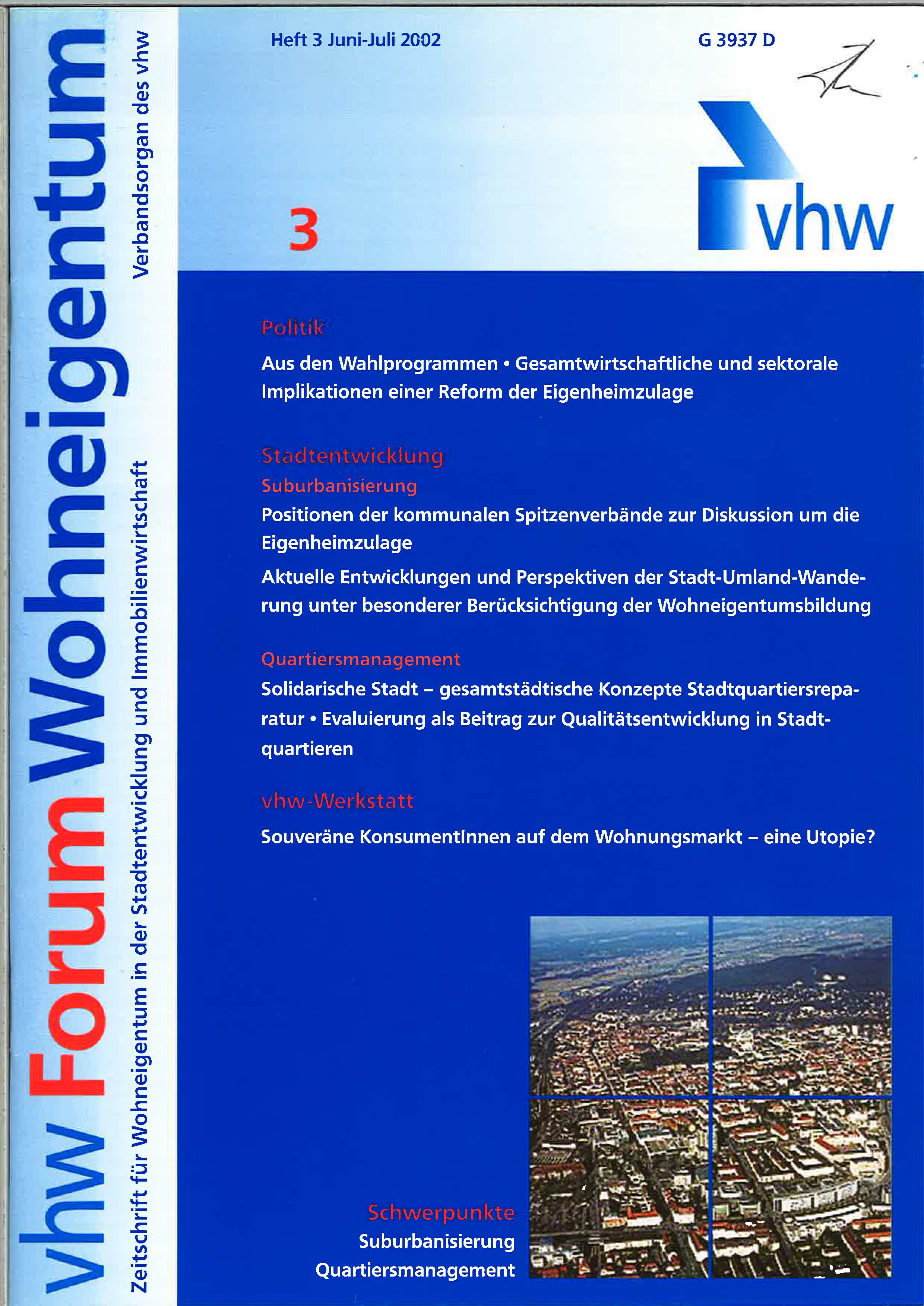
Erschienen in
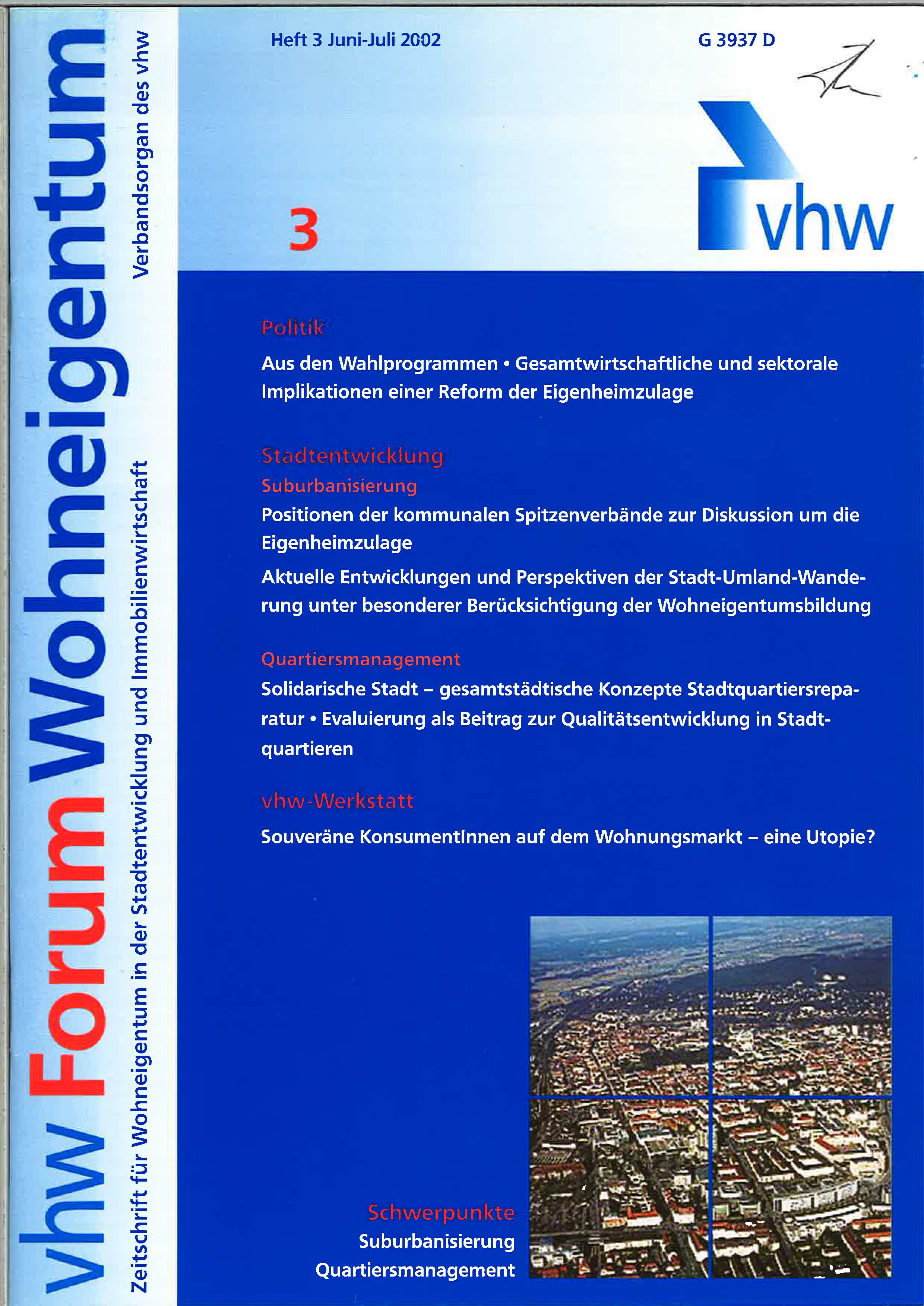
Erschienen in
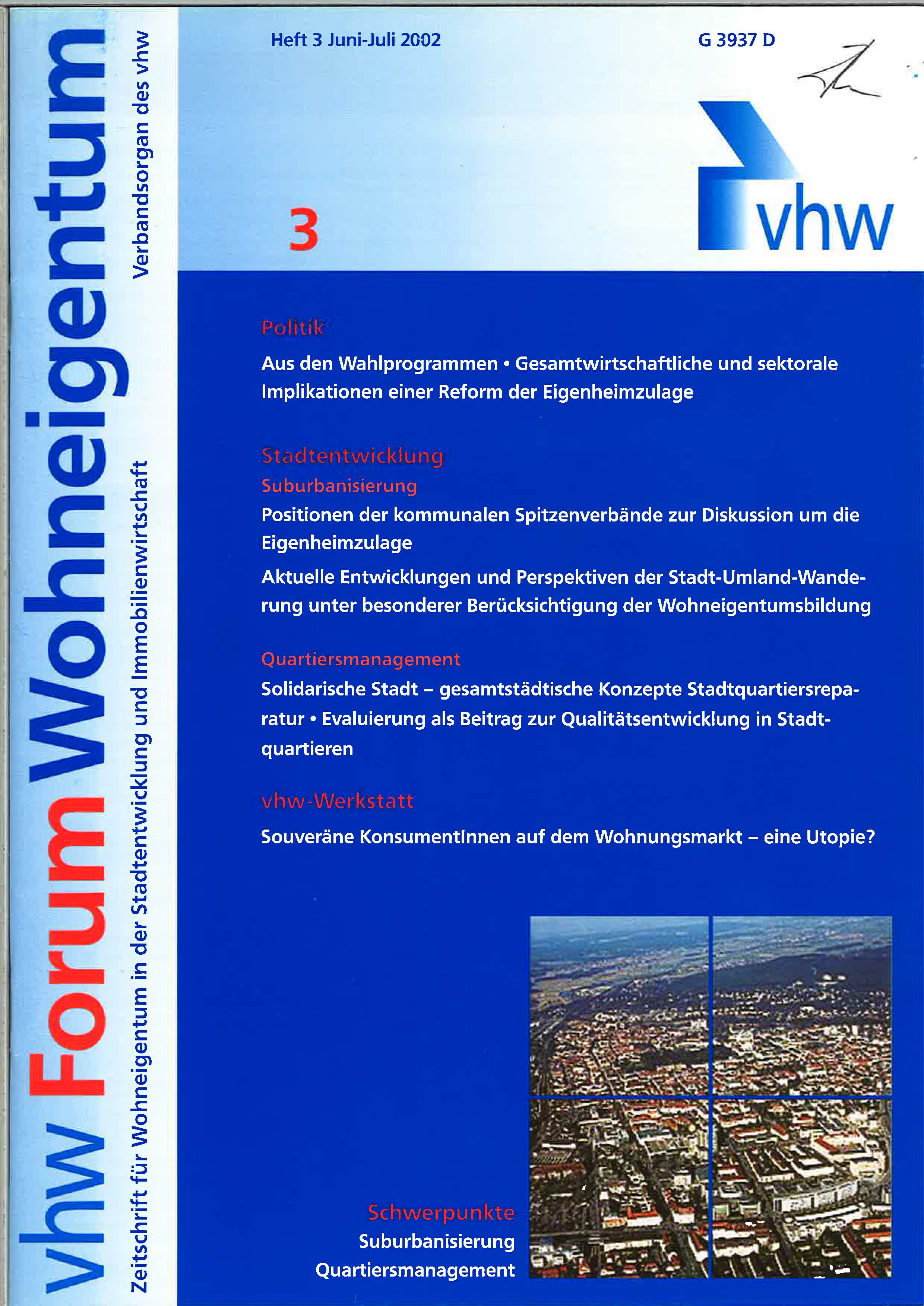
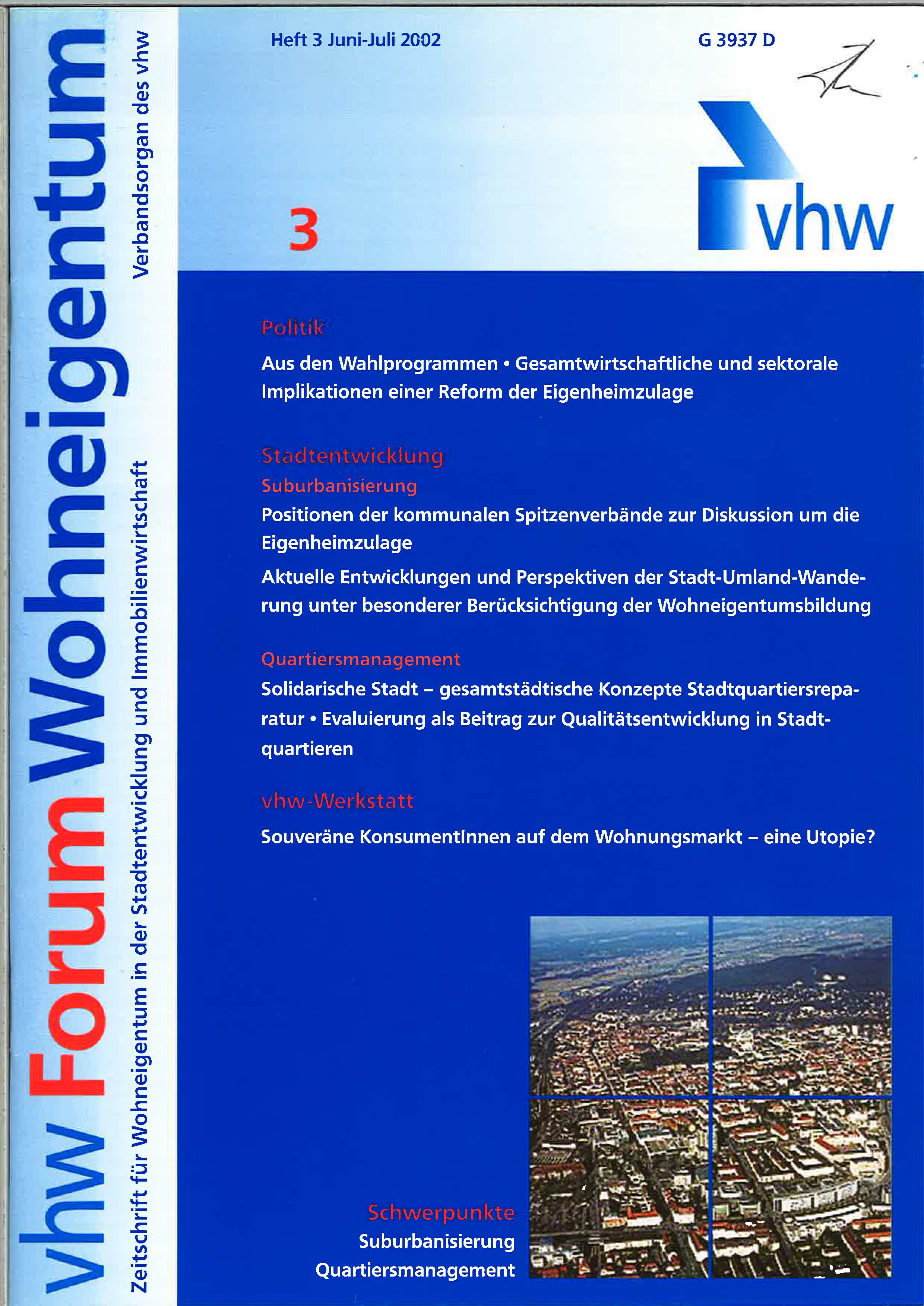
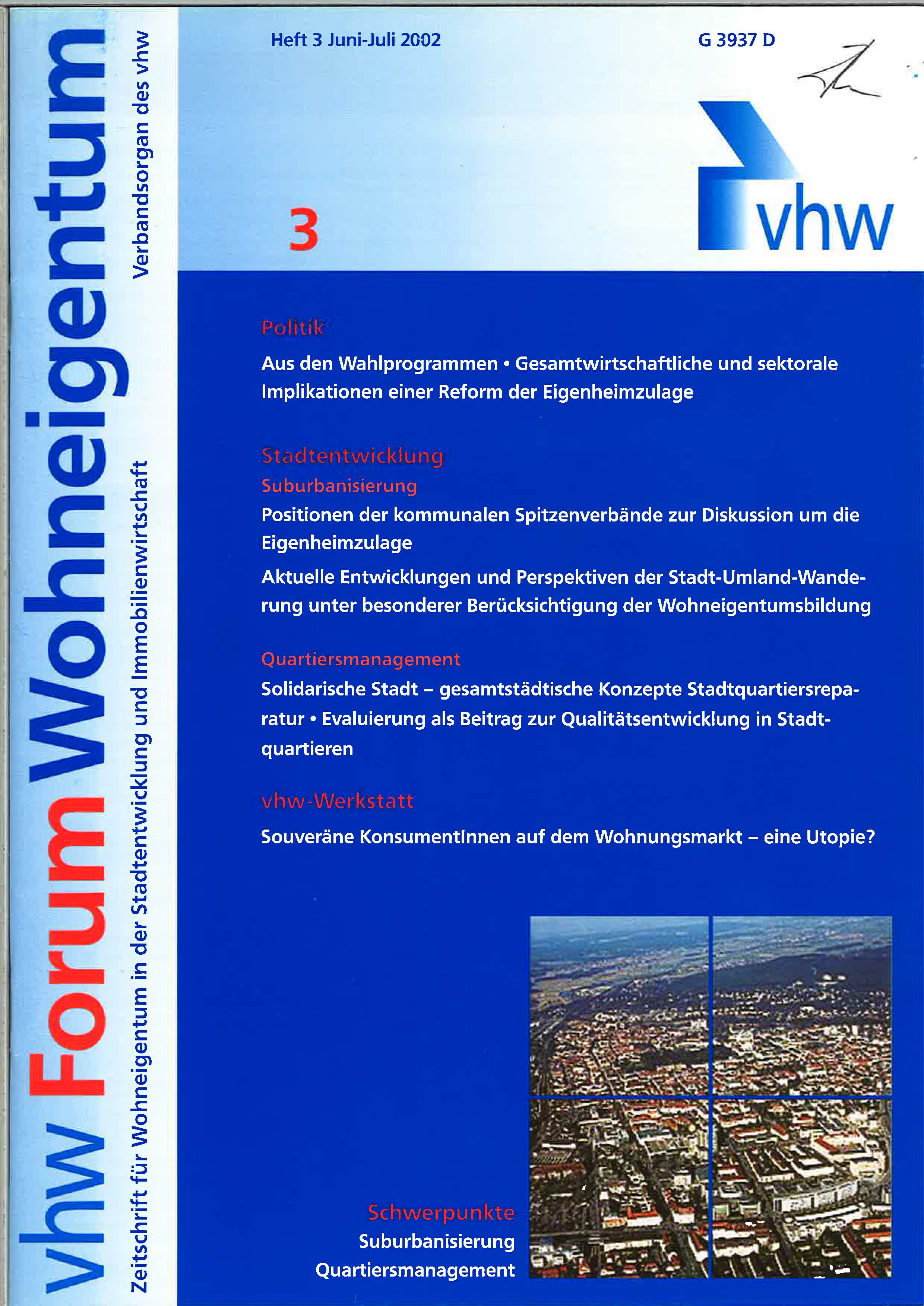
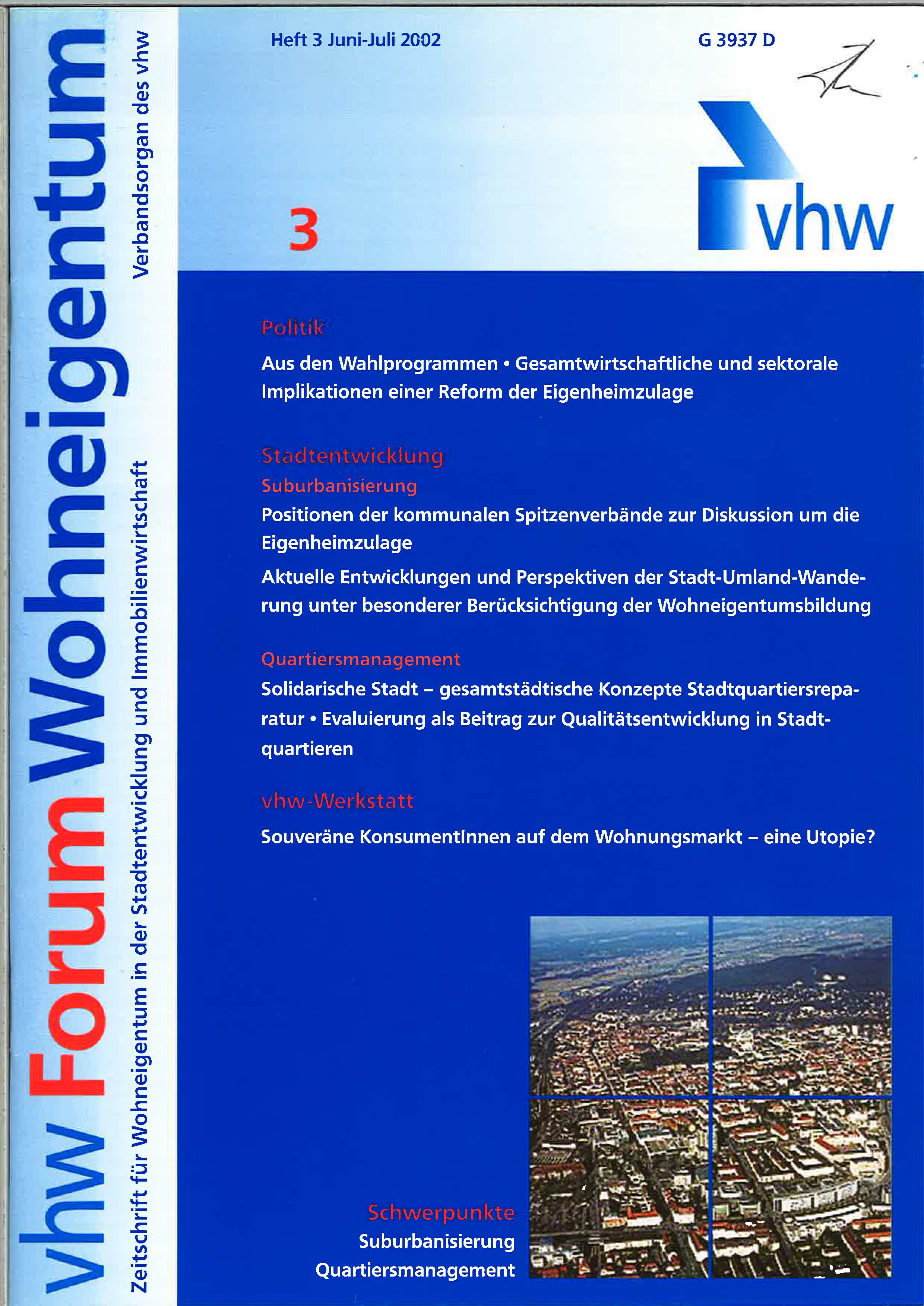
Erschienen in
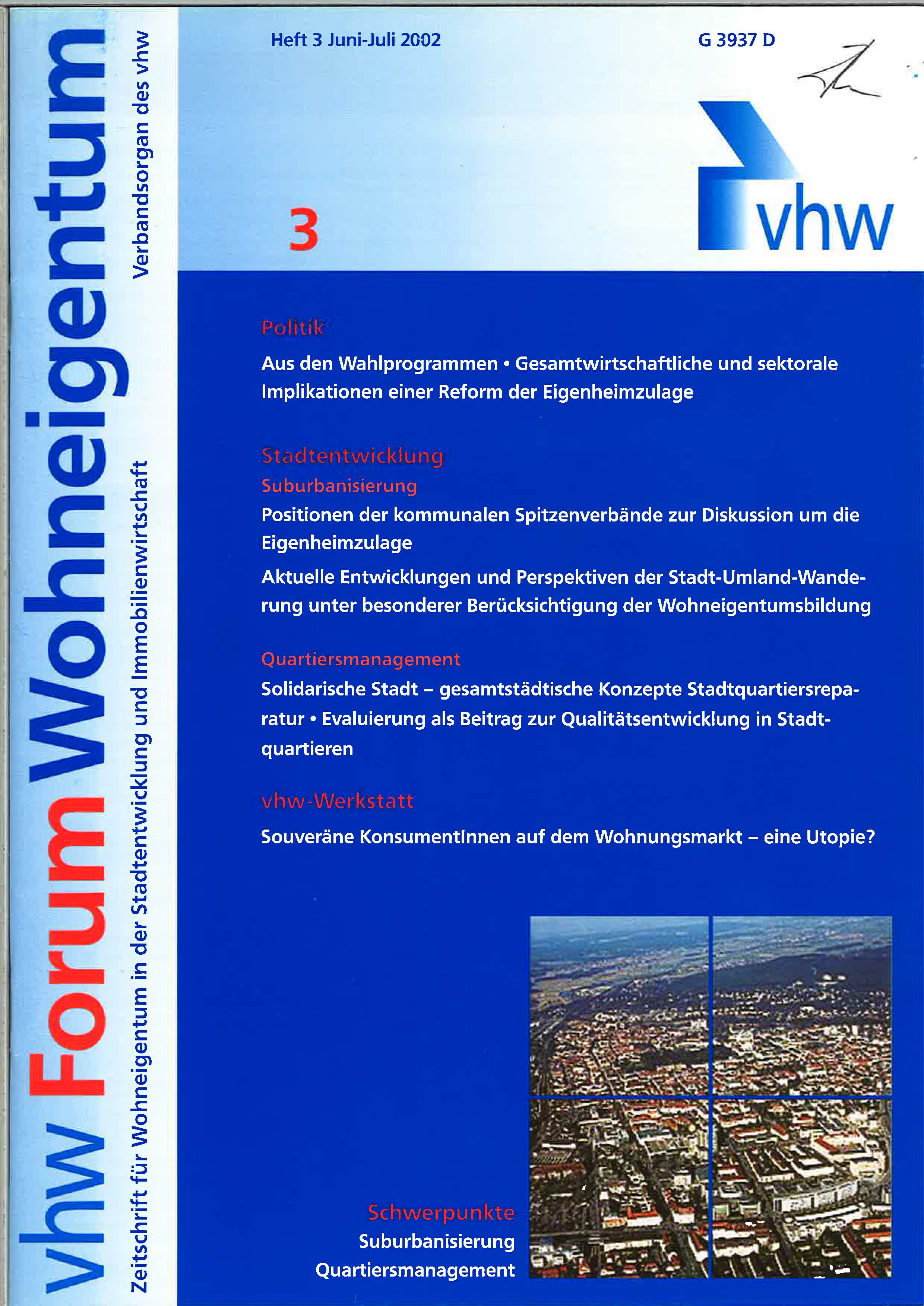
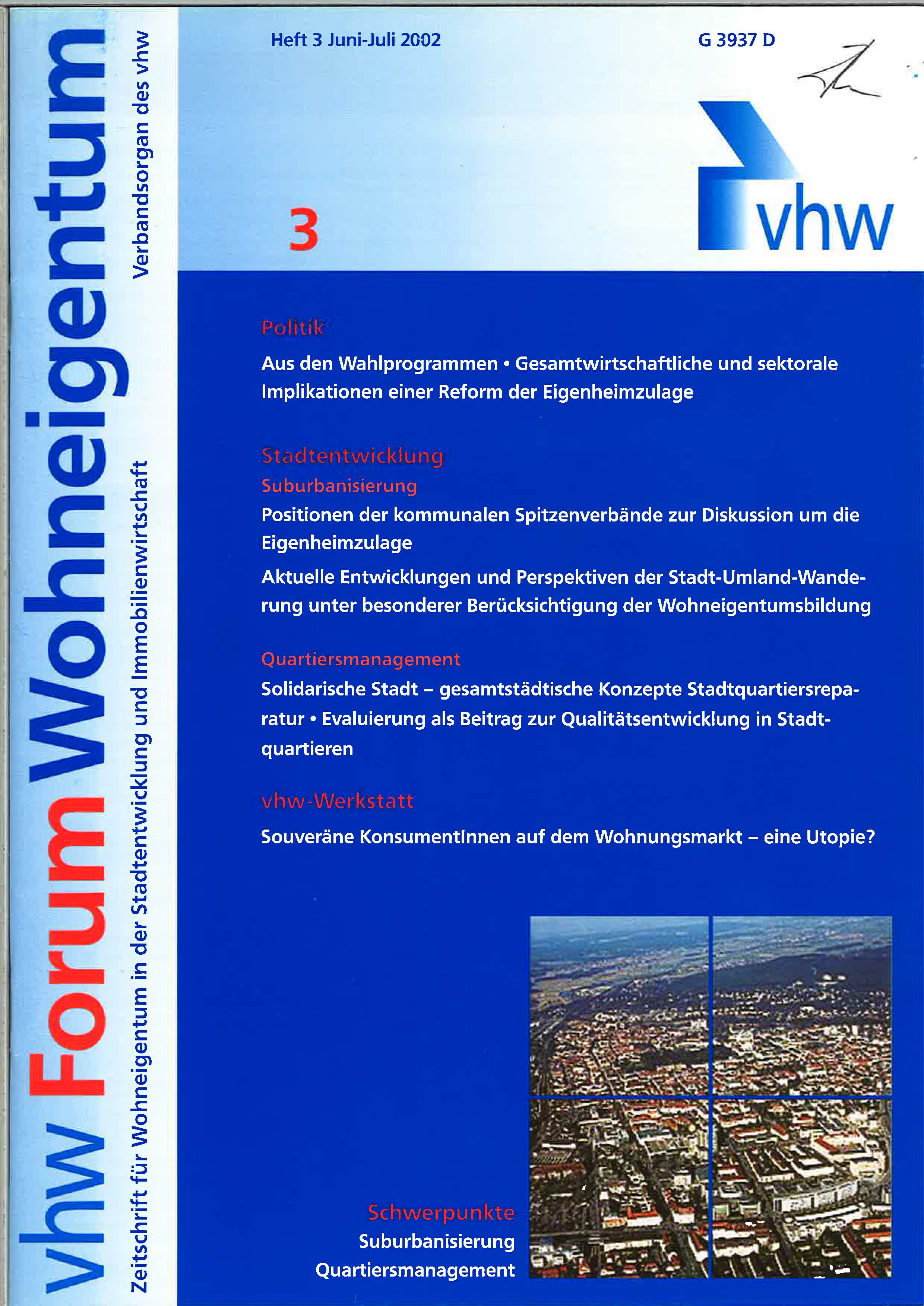
Erschienen in


Erschienen in



Erschienen in
