
Einzelpreis: 14,00 zzgl. Versandkosten
Unter den sich ändernden sozialstaatlichen Rahmenbedingungen und dem Leitbild der "Bürgergesellschaft" folgend führt die neue Verantwortungsteilung zwischen Staat, Wirtschaft, Organisationen des dritten Sektors und den Bürgern verstärkt zur Übernahme von Eigenverantwortung – ein Mehr an Partizipation an Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen. Damit die erweiterte Teilhabe der Bürger in den Bereichen Stadtentwicklung und Wohnen gelingen kann, ist es von entscheidender Bedeutung herauszuarbeiten, welche Voraussetzungen dafür bei den verschiedenen Akteuren geschaffen werden müssen und welche Folgerungen sich hieraus für die Gestaltung von Kooperations- und Kommunikationsprozessen ergeben. Mit dem Projekt "Bürgerorientierte Kommunikation" (s. Kapitel 1.3.4) nimmt sich der vhw dieser Aufgabe an. Diese Ausgabe des Forum Wohneigentum bietet einen ersten Überblick über die Entwicklung und den Stand der Diskussion zur bürgerorientierten Kommunikation. Darüber hinaus geben die Beiträge Einblicke in die Umsetzung von Partizipationsprozessen in Stadt und Quartier, wobei auch Beispiele aus dem europäischen Ausland herangezogen werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2014 Infrastruktur und soziale Kohäsion
Der vhw-Verbandstag 2014 war kein gewöhnlicher Verbandstag – dies drückte sich schon durch die Wahl des Veranstaltungsortes „AXICA-Kongresszentrum“ am Pariser Platz in Berlin – unmittelbar am Brandenburger Tor – aus. Dr. Peter Kurz, Verbandsratsvorsitzender des vhw, unterstrich zum Ende seiner Begrüßungsrede, dass dies der letzte Verbandstag in Verantwortung des Vorstands Peter Rohland sei und bedankte sich für 25 Jahre hervorragender Arbeit bei der strategischen Ausrichtung und Neuaufstellung des Verbands. Er bezog sich dabei insbesondere auf die zwei zentralen Säulen des vhw als großer Fortbildungsbetrieb für alle Themen der Stadtentwicklung sowie als Forschungs- und Beratungsinstitution für kommunale Politik und Verwaltung. Die Mitgliederversammlung des vhw wählte unmittelbar vor dem Kongress Prof. Dr. Jürgen Aring zum Nachfolger von Peter Rohland als Vorstand zum 1. Januar 2015.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2021 Digitalisierung als Treiber der Stadtentwicklung

Erschienen in Heft 6/2024 Urbane Resilienz
Mit Blick auf akute Krisen und langfristige Herausforderungen, wie den Klimawandel und das Ziel der Nachhaltigkeit von Kommunen, muss Kommunikation und Stadtentwicklung stärker als bisher zusammengedacht werden. Öffentliche Kommunikation auf lokaler Ebene ist jedoch komplexer und anspruchsvoller geworden, die Kommunikationskanäle differenzieren sich aus. Deshalb sollten Politik und Verwaltung der Frage nachgehen, wie die lokale Öffentlichkeit in ihrer Kommune funktioniert. Diese Bestandsaufnahme bildet die Grundlage für die Entwicklung geeigneter Kommunikationsstrukturen und -politiken, die die Resilienz von Stadtgesellschaften steigern können. Der „Digitale Monitor lokale Öffentlichkeit“ des vhw kann Städte und Gemeinden hierbei unterstützen.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2005 Bürgerorientierte Kommunikation / Teilhabe an Stadtentwicklung und Wohnungspolitik
Wohnungsunternehmen können ihre Wohnungsbestände nur dann langfristig erfolgreich bewirtschaften und damit unternehmerisch erfolgreich sein, wenn das Stadtquartier, in dem sie Häuser und Wohnungen besitzen, in der Konkurrenz zu anderen Quartieren bestehen kann. Das schaffen Wohnungsunternehmen allerdings nicht alleine, sondern nur mit der Unterstützung von kompetenten Partnern. Im Südostviertel in Essen haben sich einige Kooperationen gebildet. Ihr wesentlicher Motor ist das kommunale Wohnungsunternehmen der Stadt Essen, die Allbau AG. Ihr Sozialmanagement macht sich mit Partnern Gedanken um infrastrukturelle Aspekte im Stadtteil, aber auch um das Management von Integrationsprozessen. Ziel der Kooperationen ist es, die Lebenssituation der Bewohner zu verbessern, ihre Identifikation mit dem Stadtteil zu erhöhen, bürgerschaftliches Engagement zu fördern und interkulturelle Wohnkonflikte zu bearbeiten. Dabei steht vor allem die Kommunikation im Mittelpunkt, denn Integration ist nur dort möglich, wo auch miteinander gesprochen wird.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2005 Bürgerorientierte Kommunikation / Teilhabe an Stadtentwicklung und Wohnungspolitik
Erörterung, Partizipation, Bürgerbeteiligung, Mitwirkung, Kooperation, Bürgerorientierung... Es gibt viele Worte für einen an sich einfachen Vorgang: Planungs- und Politikprozesse werden geöffnet. Kommunikation findet nicht mehr nur zwischen Fachleuten in Ämtern und Büros, unmittelbar Beteiligten (Eigentümern, Investoren) und politischen Entscheidern statt. Vielmehr werden andere Akteure einbezogen – als Expertinnen und Experten des Alltags, als Planungsbetroffene oder auch als Kooperanden für mögliche gemeinsame Vorhaben. Diese Erweiterung des Beteiligtenkreises über die Fachleute und die politisch oder ökonomisch entscheidenden Akteure hinaus – hier vereinfachend mit einem Schlagwort aus der neueren Diskussion als "Bürgerorientierung" bezeichnet – hat eine lange Geschichte. Wer sich den Risiken starker Vereinfachung aussetzen will, kann diese Geschichte in sechs Entwicklungslinien bzw. -etappen zusammenfassen, die in diesem Beitrag nachgezeichnet werden: 1. Beteiligungsrechte: Angebote zur Partizipation2. Aktivierung: Aufsuchende Beteiligung3. Eigen-Aktivitäten: Potenziale der Zivilgesellschaft4. Entstaatlichung und Modernisierung: Mehr Bürgerorientierung und direkte Einflussmöglichkeiten?5. Marktprozesse: Mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten durch Nachfrageorientierung?6.Zwischen den Welten: Neue Partnerschaften?
Beiträge

Erschienen in Heft 5/2015 Intermediäre in der Stadtentwicklung
Ist aktuell von Großstadtentwicklung die Rede, so wird meist erwähnt, dass seit ein paar Jahren weltweit die Hälfte aller Menschen in Städten leben würde. Doch hat dies mit Europa zu tun, wo der Urbanisierungsgrad bereits seit geraumer Weile zwischen 70% und 80% beträgt? Indirekt schon, weil den Herausforderungen des städtischen Wachstums erneut über den technologischen Wandel begegnet werden soll – und hier winken Wachstumsmärkte in der ‚green economy‘. Neben den Strategien des forcierten Wettbewerbs zwischen den urbanen Regionen wird dieses mit Bildern von gigantischen Hochhaus-Skylines, mit sechs- bis achtspurigen Stadtautobahnen, aber auch begrünten Fahrrad-Highways gezeigt. Wer Bilder der „Stadt der Zukunft“ sehen will, muss auf die Homepages von Audi, Siemens oder SAP schauen, während die Zukunft der Automobilität von Google und Apple bestimmt werden wird.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2011 Von der sozialen Stadt zur solidarischen Stadt
"Politische Kommunikation in der Bürgergesellschaft", bei diesem Thema geht es um Überlegungen zu Aufbau und Pflege einer neuen Kommunikations- und Beteiligungskultur. Gemeint ist damit nicht, woran reflexartig gedacht wird, wenn von Kultur die Rede ist: Kultur im Gegensatz zu Zivilisation. Kommunikations- und Beteiligungskultur meint nichts Harmonisierendes, keine Gemeinschaftstümelei, zielt nicht primär auf Einhegung und Konfliktkanalisierung. Kommunikations- und Beteiligungskultur ist verortet im Kontext von politischer Kultur. Im Gegensatz zum normativen Verständnis bezeichnen die Sozialwissenschaften politische Kultur als das Gesamt politisch relevanter Einstellungen, Werthaltungen und Verhaltensweisen in einem Gemeinwesen.
Beiträge
Erschienen in


Erschienen in Heft 5/2014 Kommunikationslandschaften
Bürgerbeteiligung gehört in den deutschen Städten und Gemeinden bereits seit vielen Jahrzehnten zum „guten Ton“. Meist sind die Kommunen alleinige Verfahrensträger und die Verfahren sind an konkrete Projekte und vorgegebene Tagesordnungen gekoppelt. Alle Betroffenen werden eingeladen und man freut sich bei Politik und Verwaltung, wenn neben Experten auch viele Bürger anwesend sind. Die Teilnehmenden werden über die Pläne der Kommunen informiert, wodurch man, so die oft geäußerte und gerne auch sarkastisch zitierte Erwartung, den Bürger „mitzunehmen“ hofft. Manchmal wird zudem eine von über fünfzig komplexen, gleichwohl ähnlichen Beteiligungsformen durchgeführt, z.B. eine Charette. Anregungen und Bedenken werden von der Verwaltung in eine ggf. formelle Abwägung und Entscheidungsvorbereitung einbezogen, bevor das Ergebnis den Gemeinde- oder Stadträten zur verbindlichen Entscheidung übermittelt wird.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2014 Kommunikationslandschaften
An gesellschaftlichen Zeitdiagnosen gibt es gewiss keinen Mangel. Man sollte allerdings meinen dürfen, noch relativ à jour zu sein, wenn man über – zumindest vage – Bedeutungsvorstellungen von Schlagworten wie „Individualisierung“, „Informationsgesellschaft“ oder „Bürgerorientierung“ verfügt – oder zumindest weiß, wie man sich in Kürze dazu briefen lassen kann. Die Werkzeuge für diese Umbruchmomente scheinen sogar geläufig. Und trotzdem: Irgendwie driften Politik und Verwaltung auf der einen und Bürgerinnen und Bürger auf der anderen Seite immer mehr auseinander. So viel Know-how im Umgang mit der Bürgergesellschaft und trotzdem Vertrauenskrise.
Beiträge
Einzelpreis: 14,00 zzgl. Versandkosten
Wie können alle Gruppen an der Stadtentwicklung beteiligt werden? Die Vielfalt der Stadtgesellschaft – ihre unterschiedlichen Kulturen, Religionen, Sprachen, Ansichten, Milieus (!) und Arten der Kommunikation – ist vor dem Hintergrund dieser zentralen Frage nicht Hemmschuh, sondern vielmehr ein wichtiges Potenzial für ein gesellschaftliches Miteinander. "Kommunikation" erweist sich hier gleichsam als Schlüssel zu mehr Engagement, zu mehr Inklusion und damit auch zu mehr Beteiligung und Beteiligungsgerechtigkeit – damit nicht immer nur die "üblichen Verdächtigen" oder "Berufsbetroffenen" zu Wort kommen. Dies ist der Hintergrund des Schwerpunktheftes "Kommunikationslandschaften", in dem – wie immer – Autoren mit unterschiedlichen Blickwinkeln zu Wort kommen.
Beiträge
Einzelpreis: 14,00 zzgl. Versandkosten
Anknüpfend an Heft 6/2006 "Bürgerorientierte Kommunikation..." widmet sich diese Ausgabe des Forum Wohneigentum erneut dem Thema "Teilhabe in der Stadtentwicklung". Es werden Ergebnisse eines Workshops vorgestellt, der im Rahmen des vhw-Projektes "Bürgerorientierte Kommunikation" mit Vertretern der beteiligten Kommunen, Wohnungsunternehmen, intermediären (beratenden) Organisationen und des Lehrstuhls für Planungstheorie und Stadtentwicklung der Technischen Universität Aachen (RWTH), Prof. Dr. Klaus Selle, durchgeführt wurde (s. Kapitel 1.3.4). Zudem berichten einige der Workshopteilnehmer in weiteren Beiträgen über erfolgreiche und Erfolg versprechende Partizipationsprojekte aus der Praxis.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2005 Bürgerorientierte Kommunikation / Teilhabe an Stadtentwicklung und Wohnungspolitik
Den partizipativen Verfahren kommt eine zunehmende Bedeutung bei Entscheidungsfindungen in einer Fülle gesellschaftlicher Bereiche zu. Ausgeweitete Formen und Zahl der Arenen der Beteiligung bedeuten aber auch differenzierte und immer wieder neu herzustellende Formen der Kommunikation, die vor allem dann erfolgreich gestaltet werden können, wenn der Sinn der (Sprech-)Handlungen des Gegenüber wahrgenommen und vor dem eigenen Erfahrungshintergrund eingeordnet sowie das eigene kommunikative Handeln in einer Weise beeinflusst wird, um ein kooperatives Ziel anzustreben. Meist ohne es zu wissen, werden von den Akteuren und Akteur in Partizipationsverfahren qualitative Methoden empirischer Sozialforschung angewandt, indem die alltagsnahe Kommunikation systematisiert und Grundlage eines strategischen Partizipations-Kalküls wird.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2011 Neue Dialogkultur: Wir sprechen uns im Web 2.0
Das Internet ist in seiner Multimedialität die mächtigste Kommunikationsinfrastruktur, die die Menschheit jemals entwickelt und genutzt hat. E-Mail, Blogs und Soziale Netzwerke multiplizieren und beschleunigen unsere Kommunikation. In der Netzwerksgesellschaft (Castells 1996) verändern sich Kommunikation, Interaktion und Kollaboration, und es entstehen neue Herausforderungen für Partizipation, Planung und Politik. Das Netzwerk für urbane Kultur Urbanophil e.V. ist ein Netzwerk von jungen Stadtplanern, die sich über das Internet vernetzen, organisieren und agieren. Damit sind sie ein Teil einer neuen Öffentlichkeit, die Wegbereiter für neue Formen von Partizipation und Stadtentwicklung ist – die "digitalen Urbanisten". An drei Beispielen soll gezeigt werden, welche Auswirkungen dies für Stadtentwicklung zukünftig hat.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2014 Kommunikationslandschaften
Städte sind Orte der Kommunikation und seit Menschengedenken tauschen sich die Menschen in privaten und öffentlichen Räumen aus. Insbesondere durch das Internet haben sich die Raumstrukturen immer weiter ausgedehnt. Der Austausch ist nicht mehr an physische Orte gebunden, denn in den tendenziell weitgehend grenzenlosen Kommunikationsräumen erweitern sich auch die Interaktionsmöglichkeiten. Die Öffentlichkeit wird multimedial, multilingual und multiperspektivisch, wobei diese Entwicklung durch die Globalisierung und die Digitalisierung verstärkt wird. Noch nie hatte der Einzelne einen so breiten Zugang zu Informationen wie heute. Kommunikation macht frei, die Zivilgesellschaft gewinnt an Fahrt. Das bedeutet, dass Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sich neu austarieren müssen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2014 Wohnen in der Stadt – Wohnungspolitik vor neuen Herausforderungen
Die Energiewende kann nur als "Gemeinschaftswerk" gelingen, resümierte die Ethik-Kommission "Sichere Energieversorgung" 2011. In diesem Zusammenhang ist die Rede von einer "kooperativen Energiewende", die darauf fußt, dass sich viele Menschen, Gruppen und Institutionen für das Thema Energiewende einsetzen, z. B. indem sie ihren Energiebedarf senken, in energiesparende und erneuerbare Energien investieren sowie energiepolitische Maßnahmen unterstützen und aktiv mitgestalten. Dies gilt umso mehr im Wohnungsbestand, da hier noch nicht ausgeschöpfte Potenziale zur Minderung von CO2-Emissionen vorhanden sind. Vor dem Hintergrund einer breiten Beteiligung der Bürger stellt sich die Frage, welche Kommunikationsansätze Verhaltensänderungen in Richtung Energieeffizienz in Bestandssiedlungen forcieren.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2011 Von der sozialen Stadt zur solidarischen Stadt
Bürgerbeteiligung und Bürgerdialog werden als Vademecum moderner Partizipationsprozesse gehandelt, auch und gerade im Handlungsfeld Stadtentwicklung und Wohnen. Aus lebensweltlicher Perspektive stellt sich hier die Frage nach der Inklusion der einzelnen stadtgesellschaftlichen Milieus in diese Prozesse. Inwieweit sind sie faktisch beteiligt? Und inwieweit fühlen sie sich inkludiert? Wer wird derzeit erreicht und wo liegen die lebensweltlichen blinden Flecken der derzeitigen Praxis? Talkshow statt Teilhabe? Unsere These lautet: Derzeit werden noch nicht allen Milieus, die sich beteiligen möchten, passende Teilhabeformen angeboten.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2005 Bürgerorientierte Kommunikation / Teilhabe an Stadtentwicklung und Wohnungspolitik
Unter einem zunehmenden politischen und demographischen Druck verpflichten sich immer mehr Städte, allen Menschen mit Behinderungen und Mobilitätseinschränkungen die gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Dies bedeutet sowohl der uneingeschränkte Zugang zu Gebäuden und öffentlichen Einrichtungen als auch zu Informationen. In diesem Kontext leisten "Kommunikationsplattformen für barrierefreie Mobilität" im Rahmen des E-Government der Städte einen wichtigen Beitrag zur Realisierung dieser Verpflichtung. Sie bieten allen in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen vielfältige Informationen zur Barrierefreiheit von Gebäuden, Einrichtungen, vom Straßenraum und öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Die Informationssysteme richten sich gleichermaßen sowohl an die Bürger der Stadt als auch an Besucher und Touristen.
Beiträge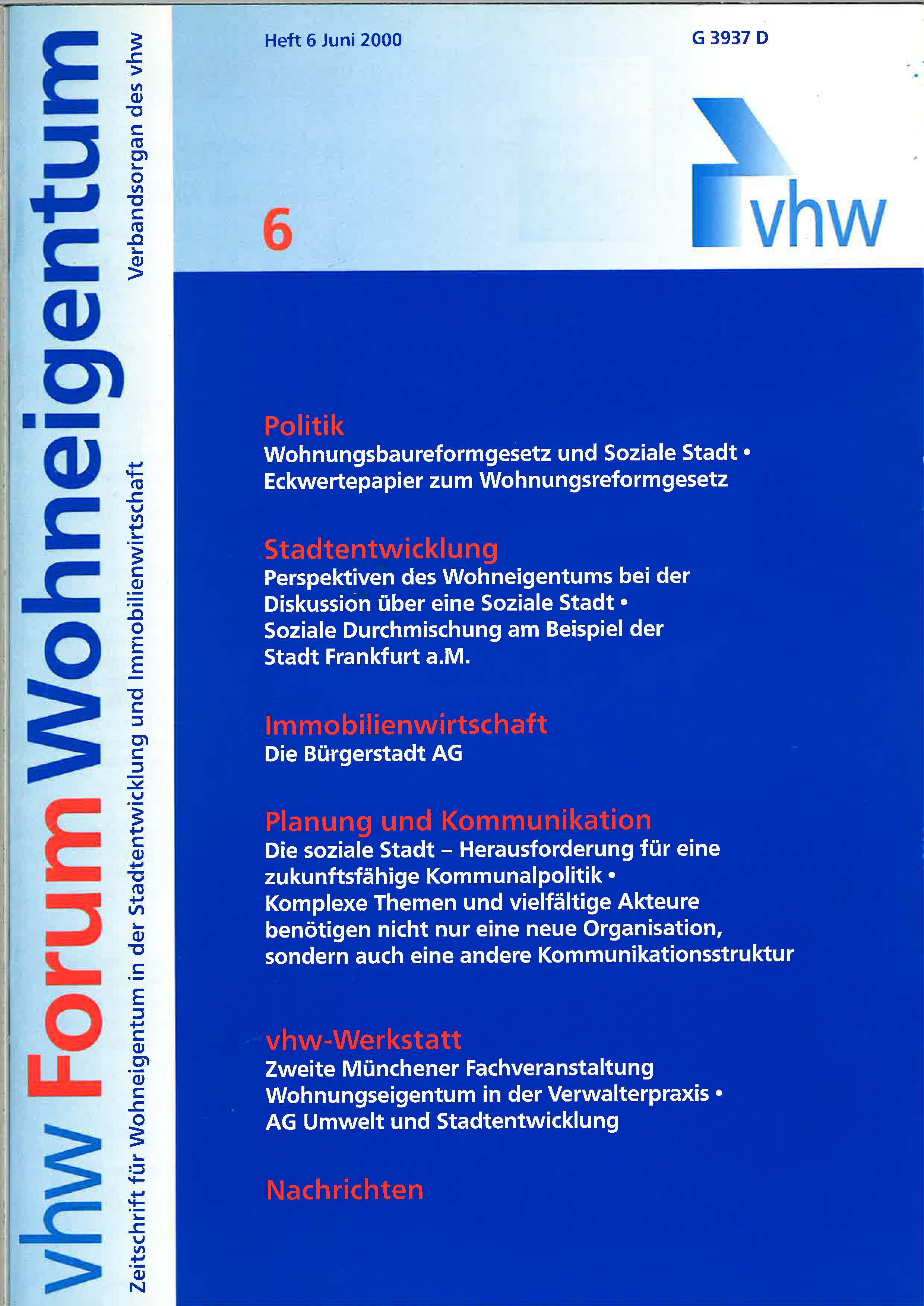
Erschienen in

Erschienen in Heft 5/2014 Kommunikationslandschaften
Während allerorten technologische Lösungen für die „Smart City“ vorgestellt, konzipiert oder erprobt werden, stellt sich immer mehr die Frage, wie die Bürger in und mit den neuen Technologie- und Kommunikationslandschaften agieren. Ist das der Beginn einer neuen Form von bürgergenerierter Stadtentwicklung? Für die großen Herausforderungen, mit denen die Städte im urbanen Zeitalter („urban age“) konfrontiert werden, sind vor allem die Informationstechnologien als Problemlöser in der öffentlichen wie politischen Wahrnehmung präsent. Mit dem Konzept der Smart City treten seit der letzten Dekade Forschungseinrichtungen und besonders Unternehmen wie Cisco, IBM, Siemens oder die Deutsche Telekom als Akteure und Motoren einer (energie)effizienten und klimaneutralen Stadtentwicklung auf. Eine Annäherung an den „Smart Citizen“.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2014 Kommunikationslandschaften
Lebendige Dörfer sind kommunikative Dörfer. Dorfgemeinschaften und Nachbarschaften funktionieren (noch) und organisieren Sorge füreinander – dies im Zusammenspiel von Nachbarschaft, Ehrenamt und öffentlicher Verantwortung. Kommunikation findet hierbei nicht im luftleeren Raum statt, sie verortet sich räumlich. In diesem Artikel soll daher der Blick auf die Kommunikationslandschaften in ländlichen Räumen geworfen und dargelegt werden, welche Anforderungen an die Weiterentwicklung von Kommunikationsgebäuden und Kommunikationsplätzen im Dorf bestehen. Ebenfalls beleuchtet wird, wie eine Kommunikationslandschaft mit Blick auf das Jahr 2030 aussehen sollte und welche Schritte dorthin in Dörfern unternommen werden können.
Beiträge
Einzelpreis: 14,00 zzgl. Versandkosten
Ausgabe 5/2011 des "Forums" lässt noch einmal den vhw-Verbandstag 2011 Revue passieren, indem neben Zusammenfassungen der Veranstaltung weitere Beiträge im Schwerpunkt Kommunikation das Thema "Mehr wissen - mehr wagen - mehr Dialog" vertiefen. Dabei stehen politiktheoretischen Beiträgen rund um das Thema Partizipation auch ganz konkrete Beiträge aus der kommunalen Praxis - etwa aus Essen und Ludwigsburg - gegenüber.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2022 Auswirkungen des Klimawandels und die Anforderungen an das kommunale Krisenmanagement
Unsere Gesellschaft ist vernetzter als je zuvor. So ist die Sicherheit unserer Lebensgrundlagen, Versorgung, Kommunikation oder globaler Lieferketten von extrem vielen Faktoren beeinflusst. Es sind dabei eine Vielzahl von potenziellen Schadenereignissen in den Blick zu nehmen, die sich überlagern, gegenseitig bedingen oder deren Ursache und Wirkung räumlich und zeitlich weit auseinanderliegen können. Naturgefahren wie Stürme oder Starkregen treten oft plötzlich auf und hinterlassen Bilder der Zerstörung. Aber auch weniger unmittelbar sichtbare Gefahren wie Hackerangriffe oder Pandemien können viele Menschenleben fordern oder die Handlungsfähigkeit von Städten, Staaten oder Kontinenten einschränken. Zudem wirken langfristige Belastungen als Treiber, Verstärker oder destabilisierend. Der Klimawandel ist dabei eine der größten Herausforderungen. Der Resilienzansatz hat in diesem Kontext stark an Bedeutung gewonnen. Es geht dabei um die Fähigkeit, Katastrophen und Krisen abfedern, aus ihnen lernen, sie antizipieren, sich besser vorbereiten und anpassen zu können. Hierbei spielen Merkmale wie Diversität, Redundanz, Multifunktionalität und Regenerationsfähigkeit von Infrastrukturen sowie institutionelle Strukturen eine bedeutende Rolle.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2022 Welche Dichte braucht die Stadt?
Die Stadt als nachhaltiges Modell für gesellschaftliche Entwicklung steht auf dem Prüfstand – mal wieder, möchte man sagen. Seit der Gründung der ersten überlieferten Städte Uruk im Südirak und bei den Sumerern wurde das den Städten zugrundeliegende System von Infrastruktur, sozialen Errungenschaften und kultureller Identität stetig weiterentwickelt. Ausschlaggebend für den Erfolg von Städten war ihre strukturelle Qualität sowie ihre Fähigkeit zur kulturellen Kommunikation und Partizipation und damit verbunden die Eigenschaft, sich ständig an neue Anforderungen anzupassen. Das Memorandum „Urbane Resilienz“ hat dies erst im letzten Jahr wieder aufs Neue beschrieben, gespiegelt an den aktuellen Herausforderungen und den Leitbildern der Neuen Leipzig Charta sowie der New Urban Agenda. Die international vereinbarten Sustainable Development Goals (SDG) gliedern die Anforderungen in fachliche Themenbereiche; räumlich hingegen treffen sich alle auf dem „Marktplatz der Städte“.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2020 Kommunales Handeln im europäischen Kontext
Unterschiede in Kompetenzen und Entscheidungsbefugnissen sowie im Zeitmanagement und den Kommunikationsformen sind wesentliche Herausforderungen beim Management europäischer Projekte. Da die Projektpartner aus ihren eigenen Systemen mit jeweils unterschiedlichen Funktionslogiken heraus handeln, müssen für eine erfolgreiche Kooperation gemeinsame Ziele definiert und Regeln der Zusammenarbeit und Kommunikation definiert werden. Neben den Chancen und Potenzialen beim Finden neuer Lösungsansätze ist aber auch eine Reihe interkultureller Herausforderungen zu meistern.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2021 Wohnen in Suburbia und darüber hinaus
Die Coronapandemie und die dadurch ausgelöste Wirtschaftskrise haben den Immobilienmarkt in Deutschland kaum getroffen. Gerade die Preise für Wohnimmobilien sind weiter gestiegen – wenn auch in einigen Segmenten nicht mehr ganz so stark wie noch in den Jahren vor der Pandemie. Vor allem gibt es jedoch Anzeichen für grundlegende strukturelle Veränderungen am Immobilienmarkt, die sich auch langfristig in unterschiedlichen Entwicklungen der Mieten und Kaufpreise für verschiedene Segmente je nach Lage und Objekttyp zeigen könnten. Ursächlich hierfür sind insbesondere Veränderungen in der Arbeitswelt. Die Lockdowns haben gezeigt, dass viele Menschen effizient und produktiv zu Hause arbeiten können. Zwar zeigen sich auch Grenzen des mobilen Arbeitens, weshalb das Büro ein zentraler Ort für Kommunikation und Austausch bleiben wird, doch in vielen Unternehmen wird zumindest ein größerer Teil der Belegschaft auch zukünftig zwei oder drei Tage von zu Hause aus arbeiten. Dies wird auch Folgen für die Wohnungsnachfrage haben.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2014 Zuwanderung aus Südosteuropa – Herausforderung für eine kommunale Vielfaltspolitik
Die verstärkte Zuwanderung aus den neuen EU-Mitgliedstaaten Bulgarien und Rumänien stellt einige Großstädte vor große Herausforderungen. Es bedarf innovativer Konzepte, um entstandene Problemlagen in den Kommunen anzugehen. Doch wenn Unterschiede in Sprache und Kultur die Arbeit mit Migranten erschweren, kommen die Angebote häufig nicht bei der Zielgruppe an. Eine neue Dienstleistung hilft bei Beratung und Behandlung: die Sprach- und Integrationsmittlung. Sprach- und Integrationsmittler (SprInt) sind zertifizierte Verständigungsprofis und sorgen für eine reibungslose Kommunikation zwischen Fachkräften und Migranten. Damit leisten sie einen konkreten Beitrag zur Integration und zur Chancengleichheit im Gemeinwesen. In vielen Bundesländern können Einrichtungen die Dienste der SprInt bereits über einen Vermittlungsservice buchen.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2012 Städtenetzwerk Lokale Demokratie – Zwischenbilanz
Die Situation scheint paradox: In Sachen Bürgerbeteiligung und Stadtentwicklung findet sich eine erstaunlich große Bandbreite partizipativer Verfahren. Trotzdem beteiligt sich in erster Linie eine privilegierte stadtgesellschaftliche Fraktion. Bürgerbeteiligung, die Chance zu direkter Mitbestimmung in lokalen Entscheidungsprozessen, wird ausgesprochen selektiv genutzt. Klassische Wahlen können hier im Vergleich durchaus höhere Beteiligungsquoten und eine ausgewogenere Mischung erzielen. Für eine inklusivere Bürgerbeteiligung gilt es das Potenzial der bereits zur Verfügung stehenden Dialogformen deutlich besser zu nutzen. In der Summe dominieren bis dato klassische Formen des Bürgerdialogs, wie Bürgerversammlungen oder Bürgergespräche. Hier gilt es mehr Vielfalt zu wagen. Auch in der Ansprache der zu Beteiligenden und in der direkten Kommunikation mit ihnen geht es um mehr Differenzierung, wenn der bildungsbürgerliche Bias des Status Quo überwunden werden soll.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2006 Partizipation in der Stadtentwicklung; Trendforschung
Stadtentwicklungsarbeit auf die sich abzeichnenden sozialräumlichen Folgen des wirtschaftlichen Strukturwandels von der Montan- zur Dienstleistungswirtschaft. Im besonders von diesem Umbruch betroffenen Stadtteil Essen-Katernberg wird im Rahmen des Quartiersmanagements die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren erfolgreich organisiert. Die Funktionsbereiche Stadtverwaltung und federführendes Amt für Stadtentwicklung wirken mit der intermediären Organisation ISSAB der Universität Essen und den Trägern der Stadtteilarbeit zusammen. Für den Erfolg der hier vorgestellten Stadtteilprojekte war die Einbindung der Bewohnerinnen und Bewohner Katernbergs unerlässlich. Der Beitrag macht deutlich, unter welchen Voraussetzungen die Teilhabe der Bürger in der Stadtteilentwicklung gelingen kann.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2012 Integration und Partizipation
Die umfangreiche Beteiligung von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie von lokalen Akteuren stellt ein wichtiges Erfolgskriterium für die gelungene Planung und Umsetzung eines Vorhabens bzw. einer Entscheidung dar. Doch lassen sich wirklich alle beteiligen und wie müssen solche Beteiligungsverfahren aussehen? Im "Handbuch zur Partizipation", das die L.I.S.T. GmbH im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung erarbeitet hat, werden die Chancen und Grenzen von Partizipation anhand von Berliner Praxisbeispielen dargestellt. Ein wichtiger Anspruch ist dabei die Inklusivität der Beteiligung – also die tatsächliche Beteiligung und Berücksichtigung aller von einer Planung betroffenen Bevölkerungsgruppen und Interessen. Beteiligungsprozesse sollen dabei auch Differenzen zwischen einzelnen Gruppen, die sich unterschiedlich erfolgreich artikulieren können, ausgleichen und eine Kommunikation auf Augenhöhe ermöglichen.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2020 Stadtmachen
"Komm, mach das Licht an!" – Unter diesem Motto wollen engagierte KulturQuartierPioniere in Thüringens erster Kulturgenossenschaft das ehemalige Schauspielhaus in Erfurt wieder zum Leuchten bringen. Zwei Dutzend engagierte Erfurterinnen und Erfurter gründeten 2012 einen Verein, um einen leerstehenden Ort mit kreativem Leben zu füllen und zum KulturQuartier zu entwickeln. Über einen kleinen Umweg kamen sie zum seit 2003 leerstehenden Schauspielhaus – ein Ort, der im emotionalen Bewusstsein der Erfurter präsent ist und eine dauerhafte Öffnung und Nutzung verdient. Mit der eigens gegründeten Genossenschaft und mittlerweile hunderten Engagierten soll dieses wieder zu einem pulsierenden Ort der Kunst, Kultur- und Kreativwirtschaft für die gesamte Breite der Gesellschaft werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2019 Vertrauen in der Stadtgesellschaft
Forderungen nach mehr Transparenz haben auch in der Stadtpolitik Konjunktur. Verbunden sind damit hohe Erwartungen. Der Deutsche Städtetag sieht in der Bereitstellung von Informationen, der Verbesserung der Kommunikation, des Dialogs und der Transparenz unabdingbare Voraussetzungen „um Akzeptanz für lokale Entscheidungen zu schaffen bzw. neu zu gewinnen“ (Deutscher Städtetag 2013). Mit seinem Projekt „Städtenetzwerk zur Stärkung der Lokalen Demokratie“ verband der vhw ähnlich große Erwartungen: „Je mehr es gelingt, Transparenz und partizipatorische Demokratieelemente in das repräsentative Demokratiemodell vor Ort einzubringen, desto mehr dürfte lokale Demokratie ihre Vorbildfunktion für das demokratische Gemeinwesen insgesamt einlösen können“ (Rohland/Kuder 2011).
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2005 Bürgerorientierte Kommunikation / Teilhabe an Stadtentwicklung und Wohnungspolitik
Das Internet als Plattform der Präsentation, der Information und der Kommunikation hat mittlerweile öffentliche Institutionen im Allgemeinen und die Stadtplanungsämter im Speziellen erreicht. War es vor wenigen Jahren noch die Ausnahme, Planungen oder Bürgerbeteiligungen mit Hilfe des hier zur Verfügung stehenden Mediums zu kommunizieren, sind entsprechende Angebote heute in großer Zahl und großer Vielfalt anzutreffen. Führt man sich vor Augen, dass diese Entwicklung auch dazu geführt hat, den Gesetzgeber zu veranlassen, in das Baugesetzbuch (BauGB) aufzunehmen, dass "bei der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (...) ergänzend elektronische Informationstechnologien genutzt werden (können)" (vgl. Runkel 2004), so lässt sich die im Thema gestellte Frage so beantworten: Die Bürgerbeteiligung im Internet ist keine Entscheidung des "Entweder – Oder". Es ist vielmehr ein entschiedenes "Sowohl - Als auch". Die Bürgermitwirkung ist ein unverzichtbares Element des kommunalen Planungshandelns und der freiwillige Einsatz sämtlicher Medien ist eine zusätzliche Möglichkeit, die Qualität eines an dem Primat der gerechten Abwägung gemessenen Planungsgeschehens zu erhöhen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2017 Gemeinwesenarbeit und Stadtentwicklung
Das System Stadt differenziert sich zunehmend aus. Die Zahl der Akteure aus Politik, Verwaltung, Bürgerschaft, Wirtschaft etc. und die Zahl der Einrichtungen, z. B. Gewerkschaften, Kirchen, Verbände, NGOs und andere Interessenvertretungen, die eine Teilhabe an Stadtentwicklungsprozessen einfordern, wächst, und damit auch die direkte Kommunikation zwischen Politik und Verwaltung sowie Zivilgesellschaft. Dabei geht es vor allem um Partizipation. Hannover ist gekennzeichnet durch eine in Jahrzehnten entwickelte, differenzierte Beteiligungskultur. Zentrales Element dieser Kultur ist das Bürgerbüro Stadtentwicklung Hannover (bbs). Denn Partizipation ist insbesondere dann erfolgreich, wenn es Scharnierstellen, Vernetzer, Bindeglieder wie das bbs gibt.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2013 Diversität und gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Stadt
Stadt- und Freiräume sind wesentliche Elemente unserer Städte. Unbebaute, öffentlich zugängliche Räume haben unterschiedliche Funktionen und dienen je nach Standort verschiedenen Akteurs- und Nutzerinteressen. Wer aufmerksam durch eine Stadt geht, dem entgeht kaum, dass ein innerstädtischer Platz etwas anderes bietet als eine neugestaltete Uferpromenade oder ein urbaner Park. Parallel zu einer wachsenden Wertschätzung von Stadträumen als Standort- und Adressfaktoren werden öffentlich zugängliche Räume intensiver von der diverser werdenden Gesellschaft genutzt. Sie ermöglichen heute vielleicht mehr denn je verschiedenen Gruppen: Begegnung und Kommunikation, Darstellung und Protest, Verweilen und Erholung, körperliche Ertüchtigung und Gesundheitsfürsorge und gemeinschaftliches Tun.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2015 Die Innenstadt als Wohnstandort
Die Veranstalter unseres kommunikativen Zusammenseins haben den Referenten ein eher knappes Zeitbudget zugemessen. Daher versuche ich, aus der Not eine Tugend zu machen und trage Ihnen mit beherztem Zugriff einfach einige Thesen vor, die Sie dazu animieren sollen, sich mit ihnen kommunikativ auseinanderzusetzen. Diese sieben Thesen beschäftigen sich mit den Schlagworten „communication matters“, „governance by and as communication“, „Orte oder Plätze von Kommunikation“, „Kommunikationsprozesse sind Interaktionsprozesse“, „communication needs translation“, „Kommunikationsmittler an Schnittstellen“ sowie „Kommunen als Intermediäre“.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2019 Digitale Verwaltung
Neue Medien und Technologien sorgen für eine immer einfachere und direktere Kommunikation sowie die leichte Zugänglichkeit von Informationen und Dienstleistungen. Dies betrifft insbesondere die sog. sozialen Medien, wie Facebook, YouTube oder andere Online-Dienste, die es den Nutzern ermöglichen, sich untereinander auszutauschen und Texte, Fotos und andere Inhalte zu teilen. Längst ist Social Media dabei kein reines Werbe- und Vermarktungsmedium mehr, sondern eine Möglichkeit der praktischen Umsetzung von Kundennähe. Dies betrifft keineswegs nur Unternehmen. Auch von Kommunen und der öffentlichen Verwaltung wird von Bürgerseite her erwartet, dass diese mit der technischen Entwicklung Schritt halten.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2013 Stadtentwicklung anderswo
Ansätze des Stadtteilmanagements, Quartiersmanagements oder auch Citymanagements sind seit Jahren als kooperative kommunale Steuerungsansätze in Gebrauch. Sie ergänzen die klassischen Planungsansätze ("oben" planen und "unten" umsetzen) durch horizontale Kooperationsbeziehungen und im besten Fall ist es mit ihrer Hilfe möglich, auch eine neue Qualität der Kooperation und Kommunikation zwischen der lokalen Ebene und der zentralen städtischen Planung zu implementieren. Durch die unmittelbare Orientierung räumlicher Managementansätze an den jeweiligen lokalen Herausforderungen und Rahmenbedingungen sind die Aufgabenfelder und Zugangsweisen von Stadtteilmanagement jedoch vielfältig und heterogen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2011 Neue Dialogkultur: Wir sprechen uns im Web 2.0
Wie andere neue Medien in ihrer jeweiligen Zeit trägt auch das Internet zum sozialen Wandel bei. Dadurch ist das Internet Werkzeug wie Treiber von breiten gesellschaftlichen Entwicklungen hin zur "vernetzten Individualität" und der Informations- bzw. Wissensgesellschaft. Neue "persönliche Öffentlichkeiten" treten neben professionelle Öffentlichkeiten und etablieren eigene Mechanismen für das Filtern von Aufmerksamkeit und Verbreiten von Informationen. Sie erlauben neue Formen der Partizipation und Teilhabe, erfordern aber auch gesellschaftliche Selbstverständigung darüber, wie diese neuen Kommunikationsräume gestaltet werden sollen. In jüngster Zeit haben insbesondere Social-Web-Anwendungen wie Facebook, Twitter oder Weblogs die Praktiken der Kommunikation verändert.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2011 Städtenetzwerk Lokale Demokratie
Die Werk-Stadt "Integration und Wohnen – unterwegs zur geteilten Stadt" im Rahmen des ersten Kongresses zum Städtenetzwerk fand mit rund 130 Teilnehmern aus Politik und Verwaltung, Wohnungswirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft statt. Moderiert wurde die Werk-Stadt von Elke Frauns vom büro frauns kommunikation, planung, marketing aus Münster. Referenten der Werk-Stadt waren die Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid, Beate Wilding, Bernd Hallenberg, Bereichsleiter Forschung beim vhw, Prof. Jens Dangschat von der Technischen Universität Wien und Hendrik Jellema, Vorstand der GEWOBAG Wohnungsbaugesellschaft Berlin.
Beiträge
Erschienen in
Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in den Stadtregionen Düsseldorf, Mittelfranken und Kiel setzte das vhw am 3. Juni im Hamburger Museum für Kommunikation seine Reihe von Regionalforen fort. Im Mittelpunkt standen dabei die regionale Wohnungspolitik und die Verflechtungen der Wohnungsmärkte.
Beiträge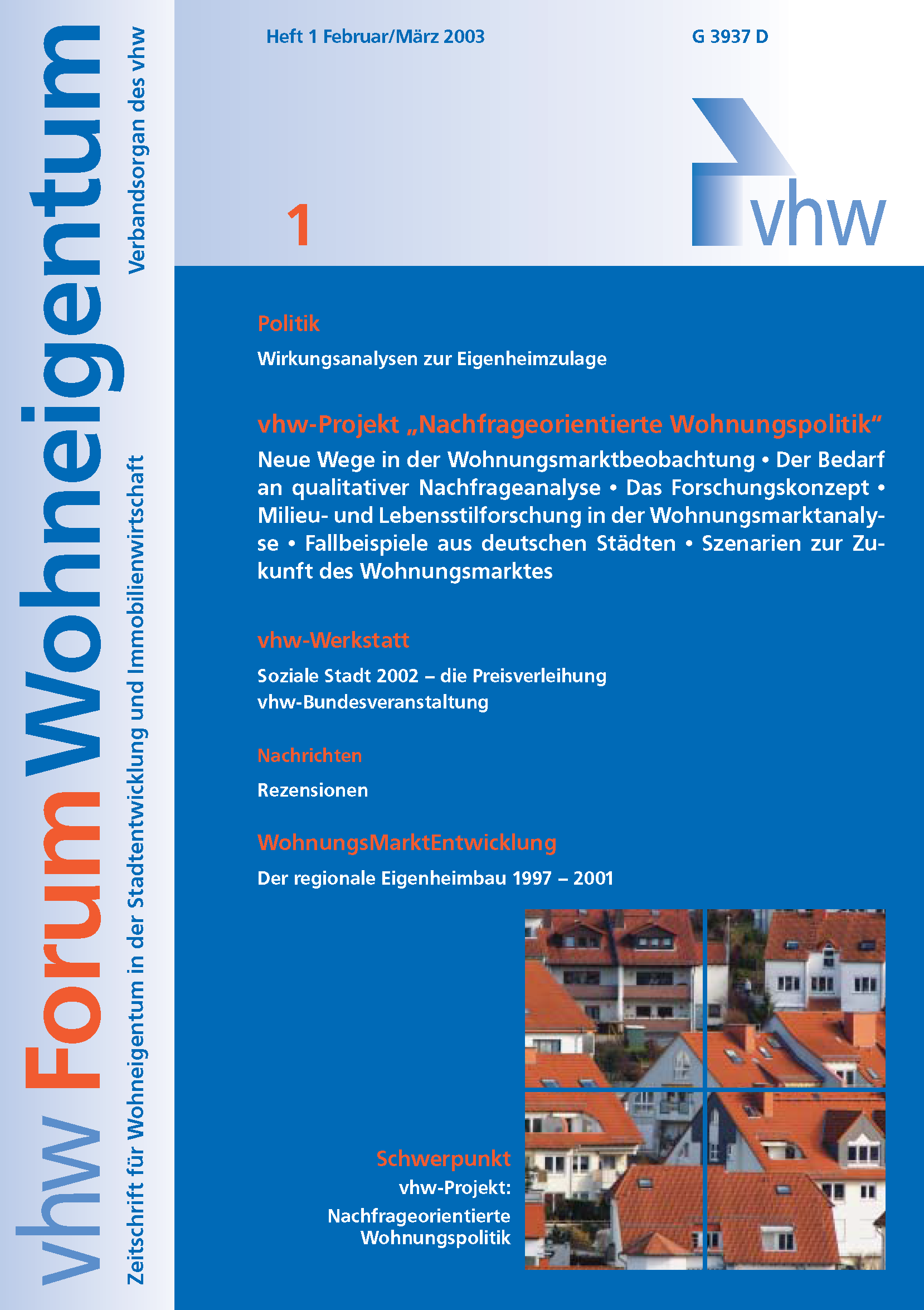
Erfolgreiche Produktplanung und Kommunikation, erfolgreiches Agieren im öffentlichen, wirtschaftlichen und politischen Raum setzt heute umfassende Zuwendung zum Verbraucher oder Bürger voraus. Auch im Wohnungsmarkt muss in Bezugs- und Zielgruppen gedacht werden – dies bedeutet weit mehr als die Klassifikation mittels herkömmlicher soziodemografischer Merkmale. Mit den Sinus-Milieus (Sinus Sociovision Heidelberg), die Menschen mit ähnlichen Wertprioritäten und Lebensstile klassifiziert, steht ein Modell zur Verfügung, das diesem Anspruch gerecht wird, erprobt ist, vielfach angewendet wird, empirisch abgesichert ist, Märkte und Lebensräume überspannt und in viele planungsrelevante Instrumente und Datenzusammenhänge übersetzt wurde.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2018 Meinungsbildung vor Ort – Chancen für Stadtentwicklung und lokale Demokratie
Seit dem Siegeszug von Internet und Smartphone spielen digitale Daten und Geräte eine immer wesentlichere Rolle in unserem Alltag. Interaktionen zwischen Technik, Wirtschaft und Gesellschaft bringen in immer schnellerer Folge neue Formen vernetzter und automatisierter Kommunikation hervor, die Arbeitswelt, mediale Öffentlichkeit, Bildung und Wissenschaft, aber auch Politik und lokale Lebenswelten vor grundlegende Herausforderungen stellen. Es geht damit heute längst nicht mehr nur darum, wie wir „das Internet“ in die etablierten Strukturen von Politik, Rechtssystem oder auch unseres Alltags integrieren, sondern darum, die durch Digitalisierung ausgelöste tiefgreifende Transformation unserer Gesellschaft auf allen Ebenen zu verstehen und positiv zu bewältigen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2018 Meinungsbildung vor Ort – Chancen für Stadtentwicklung und lokale Demokratie
Wenn Menschen wissen möchten, was in ihrer Familie passiert, dann setzen sie sich mit ihr zusammen oder greifen zum Telefon. Wenn sie wissen möchten, wie es ihrer Nachbarin geht, dann klingeln sie dort. Wenn sie aber daran interessiert sind zu wissen, was sich in ihrem Stadtteil oder ihrer Stadt ereignet, dann reichen interpersonale Kommunikationsformen in der Regel nicht mehr aus: Sie greifen auf entsprechende mediale Kommunikationsangebote zurück. Im Alltag der Menschen spielte lokale Kommunikation schon immer eine zentrale Rolle. Sie ist gebunden an und strukturiert durch den Ort, der im Mittelpunkt des Austauschs oder des Interesses steht.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2017 Vielfalt und Integration
Migration, Stadt und Diversität zusammenzudenken und dabei nicht nur zum Gegenstand, sondern zum Ausgangspunkt der Betrachtung zu machen, erfordert ein neues Herangehen, einen „kontrapunktischen Blick“ im Sinne Edward Saids. Es bedeutet, Altbekanntes gegen den Strich zu lesen und den konventionellen Migrationsdiskurs aus der Perspektive und Erfahrung von Migration neu zu denken, den Fokus auf nicht erzählte Geschichten, auf Verschränkungen und Übergänge zu richten, wodurch andere Ideen über Stadt und Vielfalt sichtbar werden. Migration und Vielheit, unverzichtbare Voraussetzung urbanen Lebens und urbaner Kommunikation, bilden den Ausgangspunkt meiner Überlegungen. „Stadt ist Migration, Stadt ist Vielfalt“ sind Grundgedanken, die hier schrittweise diskutiert werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2007 vhw Verbandstag 2007: Migration – Integration – Bürgergesellschaft
Im Neuköllner Rollbergviertel tut sich was. In der durch negative Medienberichte bekannt gewordenen Berliner Wohnsiedlung der STADT UND LAND Wohnbautengesellschaft mbH, die seit 1999 am Bund-Länder Programm "Soziale Stadt" teilnimmt, hat sich 2003 ein gemeinnütziger Verein gegründet. Bewohner und Freunde des Kiezes haben die beschriebenen Zustände nicht mehr hingenommen. Vor dem Hintergrund der gesamtgesellschaftlichen Debatten zu Migration, Integration, Chancengleichheit und gesellschaftlichem Wandel wollten die Gründungsmitglieder konkret handeln. Mit Grundsätzen, aber ohne parteipolitische Unterordnung, und vor allem mit viel Engagement, Pragmatismus und guter Laune. Mittlerweile ist der Förderverein Gemeinschaftshaus MORUS 14 e.V. ein Ort der Kommunikation, eine Plattform der Integration und des ehrenamtlichen bürgerlichen Engagements geworden, der aus der Siedlung nicht mehr wegzudenken ist. Er schenkt vielen Berlinern, mit oder ohne Migrationshintergrund, ein seltenes, kostbares Gut: Anerkennung und das Gefühl, sich gesellschaftlich wertvoll einzusetzen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2006 vhw Verbandstag 2006 "Mittendrin statt nur dabei – Bürger entwickeln Stadt"
Der vhw hat das neue Gesellschaftsverständnis von der Bürgergesellschaft im aktivierenden und ermöglichenden Staat zu einer Leitlinie seiner Verbandspolitik gemacht. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass auf die Bürger insbesondere im Bereich der Stadtentwicklung und der Wohnungspolitik erweiterte Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten zukommen. Im Jahr 2005 wurde deshalb das Projekt "Bürgerorientierte Kommunikation" gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung der RWTH Aachen unter Leitung von Professor Dr. Klaus Selle ins Leben gerufen. Eine Reflexion der ersten Schritte nach knapp einjähriger Arbeit.
Beiträge